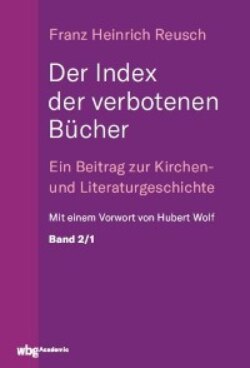Читать книгу Der Index der verbotenen Bücher. Bd.2/1 - Franz Reusch - Страница 14
6. Der Index Benedicts XIV. 1758.
ОглавлениеIm Jahre 1758 erschien eine neue Ausgabe des Index, welche von ganz besonderer Bedeutung ist, weil sie die Grundlage aller folgenden Ausgaben bis auf diesen Tag bildet. An der Spitze steht ein Breve Benedicts XIV. vom 23. Dec. 1757, worin es heisst: die bisherigen Indices seien nicht hinlänglich correct und für den Gebrauch bequem und ein neuer besser geordneter und von Fehlern gesäuberter Bedürfniss. Der Papst habe an die Herausgabe eines solchen schon bei der Publication der Bulle vom 9. Juli 1753 (S. 2) gedacht und die Index-Congregation damit beauftragt; der von dieser hergestellte Index werde hiemit bestätigt1). Dann folgen eine Vorrede des Secretärs der Index-Congregation Thomas Augustinus Ricchini, die Trienter Regeln nebst den Observationen Clemens’ VIII. und Alexanders VII. (und einer neuen Observatio zu Reg. 4 über das Bibellesen, s.u.) und die Instruction Clemens’ VIII., die erwähnte Bulle von 1753 und dann eine Zusammenstellung, die sich hier zuerst findet: Decreta de libris prohibitis nec in Indice expressis, später gewöhnlich Decreta generalia genannt. Da die verbotenen Bücher, heisst es in der Einleitung dazu, wegen ihrer grossen Zahl nicht alle einzeln im Index verzeichnet werden können, so hat man geglaubt, sie unter bestimmte Kategorieen ordnen und einen Index derselben nach den Materien, worüber sie handeln, anfertigen zu müssen, so dass man daraus erkennen kann, ob ein Buch, welches nicht im Index steht oder nicht unter die Regeln des Index fällt, unter die verbotenen zu zählen sei.
Ueber die Aenderungen, welche in dem Index selbst vorgenommen worden sind, heisst es in dem Vorwort Ricchini’s:
Bei dem Verzeichnen der Bücher haben wir mehr auf die Familiennamen als auf die Vornamen Rücksicht genommen. [In den älteren Indices sind die Vornamen vorangestellt und wird bei den Familiennamen auf jene verwiesen; z.B. Jacobi Augustini (sic) Thuani Historiae; Augusti Thuani vide Jacobi Augusti; Thuanus vide Jacobi Augusti, — bei Ben. nur: Thuanus, Jac. Aug., Historiarum u. s. w. (vollständiger Titel)]. Als Familiennamen haben wir auch angenommene Namen behandelt. [In der Vorrede vor dem Index von 1819 ist beigefügt: Die Bücher, deren Verfasser nur mit Anfangsbuchstaben bezeichnet sind, haben wir unter diesen aufgeführt]. — Thesen und Disputationen stehen nicht unter dem Namen der Schüler [Respondenten], sondern der Lehrer oder Praesides, welche in der Regel die Verfasser sind, — falls nicht bloss ein Name auf dem Titel steht oder der Schüler als wirklicher Verfasser bekannt ist. — Werden zwei Verfasser genannt, so steht das Buch unter dem Namen des ersten, werden mehrere genannt, unter dem Schlagworte des Titels. — Anonyme Schriften sind in das Alphabet eingereiht. Wenn einige Bücher, die nicht anonym erschienen sind, ohne Nennung des Verfassers verzeichnet werden, so ist dieses, wie in früheren Indices, so auch in diesem nicht ohne Grund geschehen [um den Verfasser zu schonen, wie bei Valerius Andreae, Scipio Maffei und vielleicht Fr. van Heussen; mitunter sind aber die Namen wohl aus purer Nachlässigkeit weggelassen]. — Bei den schon in dem Trienter oder Clementinischen Index stehenden Autoren und Büchern ist Ind. Trid. resp. Append. Ind. Trid. beigefügt, bei den seit 1596 verbotenen Büchern das Datum des Verbotes [mitunter mit einer genauern Bestimmung, wie bei dem Augustinus des Jansenius Bulla Urbani VIII. 6. Martii 1641 et Decr. (S. 0.) 23. Apr. 1654].
Ferner bringt Ricchini noch folgende Bestimmungen in Erinnerung: Wenn bei Büchern Ort und Jahr des Drucks angegeben wird, so gilt das Verbot nur für die betreffende Ausgabe, nicht auch für verschiedene oder verbesserte Ausgaben. Fehlt der Zusatz, so gilt das Verbot für alle Ausgaben (s.u. § 14). Von einem verbotenen Buche sind auch alle Uebersetzungen verboten (I S. 540). Wenn einem Verbote donec corrigatur oder donec expurgetur beigefügt ist, bleibt die Verbesserung der Index-Congregation vorbehalten (I S. 431). Ueber die Strafbestimmungen s. S. 7. Dass in diesem Index zahllose Fehler der früheren corrigirt sind, wurde bereits I S. 2 hervorgehoben.
Viele Berichtigungen, welche der Index Clemens’ VIII. Benedict XIV. oder Ricchini zu verdanken hat, sind bereits im 1. Bande erwähnt. Zu einigen hat J. G. Schelhorn die Veranlassung gegeben, welcher De consilio de emendanda ecclesia I, 46 (I S. 397) auf manche Fehler aufmerksam machte, worauf Card. Querini, Epist. 403, antwortete, seine Monita würden berücksichtigt werden (I S. 396. 238. 239). Manche schlimme Fehler sind freilich stehen geblieben, z.B. Barth. Conformi, Jo. Purpurei, Pasquillus Fagius, Th. Corbeau, Jo. Fabricius, G. Hantz, Jo. Host, Chr. Molhusensis, A. Munsholt, Hier. Pumekchius, Zeghelstein; vgl. I S. 515. — Einige bei Clem. stehende Autoren und Bücher sind weggelassen, wahrscheinlich nicht mit Absicht, sondern durch ein Versehen, z.B. Barth. Fontius, Onus Ecclesiae, Aequitatis discussio. — Von den durch Ben. vorgenommenen Berichtigungen und Modificationen der seit 1600 erschienenen Indices wird später die Rede sein.
In den Decreta generalia2) hat § I die Ueberschrift: „Verbotene Bücher, welche von Ketzern geschrieben oder herausgegeben sind oder sich auf sie oder die Ungläubigen beziehen.“ Er enthält folgende Nummern: 1. Agenden oder Gebetsformeln oder Officia derselben (I S. 513). — 2. Alle Apologieen, in denen ihre Irrthümer vertheidigt oder erläutert oder begründet werden. — 3. Bibeln, die von ihnen herausgegeben oder mit Anmerkungen, Argumenten, Summarien, Scholien und Indices von ihnen versehen sind (I S. 332). — 4. Bibeln oder Theile derselben, die von ihnen versificirt sind (I S. 332). — 5. Kalender, Martyrologien und Nekrologien derselben (I S. 513). — 6. Gedichte, Erzählungen, Reden, Bilder, Bücher, wodurch ihr Glaube und ihre Religion empfohlen wird (sie wegen ihres Glaubens und ihrer Religiösität gelobt werden; I S. 541). — 7. Alle Catechesen und Catechismen, welchen Titel sie auch haben mögen: ABC-Bücher, Erklärungen des apostolischen Glaubensbekenntnisses, der zehn Gebote, oder Unterweisungen in der christlichen Religion, Loci communes u. s. w. — 8, Colloquien, Conferenzen, Disputationen, Synoden, Synodalacten über den Glauben und Glaubenssätze, welche von ihnen herausgegeben sind und in welchen irgendwelche Erklärungen ihrer Irrthümer enthalten sind. — 9. Confessionen, Artikel oder Glaubensformeln derselben (I S. 420). — 10. Dictionarien aber, Vocabularien, Lexica, Glossare, Thesauri und ähnliche Bücher, die von ihnen verfasst oder herausgegeben sind, wie die von Heinrich und Carl Stephanus, Jo. Scapula, Jo. Jac. Hofmann u. s. w. werden nur gestattet nach Beseitigung dessen, was sie gegen die katholische Religion enthalten (I S. 337). — 11. Alle Bücher, welche Unterweisungen oder Riten der Secte der Muhammedaner enthalten (I S. 137). — Einige dieser Bestimmungen werden im Index selbst unter Apologia, Catechesis, Colloquium, Confessio, Disputatio wiederholt und dann die einzelnen Bücher der betreffenden Kategorie, die bis dahin im Index standen, weggelassen, z.B. Apologia Confessionis Augustanae (Ind. Trid.). Et caeterae omnes haereticorum apologiae. Vide Decreta § I n. 2.
§ II „Verbotene Bücher über bestimmte Gegenstände“ stellt Verbote zusammen, die meist erst im 17. und 18. Jahrhundert vor und nach erlassen waren und von denen noch die Rede sein wird. Aus dem 16. Jahrhundert stammen davon nur folgende: 7. Bücher, welche über Duelle handeln, Briefe, Schriftchen und Schriften, worin dieselben vertheidigt, angerathen, gelehrt werden. Wenn aber dergleichen Bücher geeignet sind, Streitigkeiten beizulegen und Verständigungen herbeizuführen, werden sie, wenn sie expurgirt und approbirt sind, gestattet (I S. 511). 13. Alle Pasquille, welche aus Bibelstellen zusammengesetzt sind; desgleichen alle Pasquille, auch geschriebene, und alle Schriften, in denen Gott oder den Heiligen oder den Sacramenten oder der katholischen Kirche oder dem apostolischen Stuhle irgendwie zu nahe getreten wird (I S. 268). — Auch die in § III „Verbotene Bilder und Ablässe“, und in § IV „Einige auf die h. Ritus bezügliche Verbote“ stehenden 12 bezw. 8 Verbote werden im einzelnen noch zur Sprache kommen.
1) Der Index erschien in zwei Ausgaben: Index Librorum prohibitorum SSmi D. N. Benedicti XIV. Pontificis Maximi jvssv Recognitus, atque editus. Romae 1758 Ex Typographia Reverendae Camerae Apostolicae. Cum Summi Pontificis privilegio. 5 Bl. XXXIX und 268 S. 4.* 6 Bl. XXXVI und 304 S. 8.* Beide Ausgaben haben ein Titelkupfer mit der Unterschrîft aus Apg. 19, 19 (I S. 8).
2) Vgl. A. J. P. I, 1219.