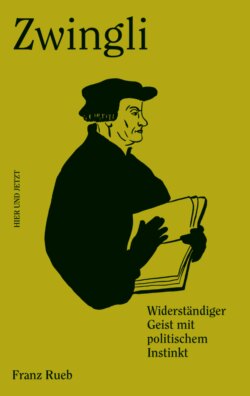Читать книгу Zwingli - Franz Rueb - Страница 16
EUROPÄISCHE PERSPEKTIVEN
ОглавлениеBevor wir uns Zwinglis Zeit als Pfarrer in Glarus zuwenden, wollen wir einen Blick auf das politische und religiöse Umfeld in Europa werfen, in dem er seine reformatorischen Ideen entwickelte.
Der Papst war im frühen 16. Jahrhundert nicht nur Oberhaupt der Kirche, sondern auch Machtpolitiker, der eigene und familiäre Interessen verfolgte. Julius II. (1503–1513) war im Kriegswesen sehr bewandert. Leo X. (1513–1521), ein Sohn des Hauses Medici in Florenz, war ein Förderer der Künste und der Wissenschaften, aber als wirklicher Vorsteher der Christenheit galt er nicht. Er liebte das Spiel und die Jagd.
1506 begann Donato Bramante mit dem Neubau des Petersdoms, der damit finanziert wurde, dass vor allem im Reich überall dem Volk das Geld aus den Taschen gezogen wurde.
Der Papst beanspruchte für sich, den Kaiser krönen zu dürfen. Dies wurde vom Kaiser und von den Kurfürsten aber zunehmend kritisiert. Der Kaiser stand, obwohl nach der Tradition eher Primus inter Pares als wirkliches Oberhaupt, über den anderen Königen und Fürsten und gab sich als Beschützer des christlichen Glaubens.
Auf dem Kaiserthron hatten sich die Habsburger installiert. Auf Maximilian I. folgte dessen Enkel Karl V. Seine Wahl zum König des Heiligen Römischen Reiches war nicht ohne Nebengeräusche verlaufen. Am 28. Juni 1519 kamen die deutschen Kurfürsten in Frankfurt zusammen. Es wurde lange verhandelt. Der französische König hatte für sich werben lassen. Das Haus Habsburg unternahm gewaltige finanzielle Anstrengungen, um die Krone an den jungen Karl zu bringen. Die Kurfürsten wurden mehrfach bestochen. Der Stimmenkauf kostete die Habsburger gegen eine Million Gulden, die aber brachte zum grössten Teil die Firma Fugger auf. Nur Friedrich der Weise von Sachsen liess sich nicht bestechen. Schliesslich wurde Karl I. als Karl V. einstimmig zum deutschen König gewählt. Er zählte bei seiner Wahl 19 Jahre. Geboren war er in Gent in den Niederlanden, dort galt er als Spanier, in Spanien als Deutscher. Seine Muttersprache aber war französisch, des Deutschen war er nicht kundig.
Die Rivalitäten zwischen dem Kaiser, den stärksten Fürsten im Reich und dem französischen König hatten sich schon unter den Vorgängern von Franz I. und Karl V. verschärft. In den oberitalienischen Kriegen waren die beiden Mächte aufeinandergeprallt. Wie der Kaiser sah sich auch der König von Frankreich als führender Beschützer des Christentums. Er nannte sich Allerchristlicher König. Der englische Herrscher galt als Verteidiger des Glaubens. Der spanische Monarch gab sich den Titel Allerkatholischste Majestät.
Um seinem Anspruch als westliches Oberhaupt des Christentums gerecht zu werden, kämpfte Karl V. erbittert gegen die Osmanen, litt aber dauernd unter Geldknappheit und war beim Bankhaus Fugger gewaltig verschuldet. Zudem versuchte er immer wieder die Reichsverwaltung zu reformieren. Das gelang schon deswegen nicht, weil das Reich keine eigenen Behörden besass.
Die Reichsfürsten sowie die grossen europäischen Länder protestierten wiederholt und sehr heftig gegen die ständigen Geldsammlungen Roms. Der englische Monarch Heinrich VIII. bekam ein Viertel der in England gesammelten Summe. Der französische König Franz I. erhielt ebenfalls seinen eher bescheidenen Anteil. Kaiser Karl V. bezog ein Darlehen vom Papst. Aber alle Länder waren jahrelang ausgepresst worden und wütend. Nur das Reich war strukturell zu schwach, hoffnungslos zersplittert, darum wurden die deutschen Länder erbarmungslos ausgesaugt. Daran hatte das Augsburger Bankhaus Fugger – als Geldeintreiber – starken Anteil.
Der Bettelmönch Johann Tetzel, der sich seit dem Jahr 1500 ausschliesslich dem Ablasshandel gewidmet hatte und dadurch in den deutschen Ländern sehr berühmt geworden war, wurde jeweils an den Stadttoren von frommen Bürgern mit Musik und Fahnen und Kerzen empfangen, die Ablassbulle lag bei der Prozession auf einem Goldkissen. Tetzel erzählte, der Papst habe mehr Macht als alle Apostel, alle Engel und alle Heiligen zusammen, der Papst sei gleich Christus.
Friedrich der Weise, Kurfürst von Sachsen, war kein Ablassgegner, er hatte in der Wittenberger Schlosskirche 19 000 Heiligenreliquien zusammengetragen. Die in Sachsen gesammelten Ablassgelder für einen Kreuzzug gegen die Türken verwendete Friedrich schliesslich für den Ausbau der Universität Wittenberg. Und Tetzel hielt eine Brandrede gegen Luther.
Am 31. Oktober 1517 um die Mittagszeit hatte Martin Luther, zu der Zeit durchaus noch ein guter Katholik, seine 95 Thesen am Portal der Wittenberger Schlosskirche gegen den Ablass angeschlagen.
Am Pranger stand seit Jahren die verschwenderische Hofhaltung der Kirchenfürsten, die Korruption in der Kurie, die Sittenlosigkeit Papst Alexanders VI., die Heftigkeit Julius II., und die Sorglosigkeit Leos X. Die Kirchenreform scheiterte zum x-ten Mal. Das alles geschah etwa zur gleichen Zeit mit der Entdeckung Amerikas, der Wiederentdeckung der Antike, der Erfindung des Buchdrucks, der Ausbreitung der Bildung und der Übersetzung der Bibel ins Deutsche. Die Reformation wäre ohne diese neue Technik, den Buchdruck, die Verbreitung geistiger Erkenntnisse, gar nicht möglich gewesen. Luther und Zwingli gehörten zu den Ersten, welche die neue Erfindung zur vollen Wirkung brachten.
In der Welt der Gelehrten dominierte der Humanismus. Der grösste damalige deutsche Theologe – Martin Luther – war vom humanistischen Gedankengut aber kaum beeinflusst. Zwar führte Luther mit Erasmus von Rotterdam ein Streitgespräch in schriftlicher Form über den freien Willen. Aber er hatte mit der Haltung des Erasmus wenig gemein.
Die Humanisten getrauten sich, scheinbar unverrückbare Wahrheiten infrage zu stellen. Konrad Celtes fragte provokant: «Lebt die Seele nach dem Tod weiter?» Und: «Gibt es wirklich einen Gott?» Eoban Hesse, ebenfalls ein Humanist, schrieb Liebesbriefe von Magdalena an Jesus. Mutianus Rufus gab seinen Schülern zu bedenken, «die Satzungen der Philosophen höher als die der Priester zu schätzen». Seelenmessen hielt er für wertlos, das Fasten für ausgesprochen unangenehm, die Ohrenbeichte für deprimierend. Die anständigen Griechen und Römer seien Christen gewesen, ohne es zu wissen.
Wohl der sanfteste Gelehrte der Zeit war Johannes Reuchlin. Er war der grosse Hebräist der humanistischen Epoche, 1491 wurde er Professor der hebräischen Sprache an der Universität Heidelberg. Und ausgerechnet diesem Mann wurde sehr übel mitgespielt. Aber er wurde, ohne es zu wollen, zum Helden der deutschen Renaissance und des Humanismus. 1508 veröffentlichte der ehemalige Jude Johannes Pfefferkorn, inzwischen zum Katholizismus konvertiert, den Judenspiegel, der die Juden aufforderte, Christen zu werden. Pfefferkorn verlangte die Unterdrückung aller hebräischen Schriften. Das Verbot und die Verbrennung der hebräischen Bücher wurden allgemein gutgeheissen. Reuchlin war allein auf weiter Flur. Er nannte Pfefferkorn einen Esel ohne Verständnis für diese Literatur.
Pfefferkorn gab nun einen Handspiegel mit der Behauptung heraus, Reuchlin sei von den Juden gekauft worden. Papst Leo X. liess mehrere Gutachten über diesen Sachverhalt erstellen. Inzwischen wurde von Pfefferkorn bei der Inquisition ein Verfahren eingeleitet. Das bischöfliche Gericht in Speyer plädierte jedoch unerwartet für Reuchlin auf Freispruch. Andererseits liessen mehrere Universitäten Reuchlinsche Schriften verbrennen. Die ganze Prominenz des Humanismus setzte sich für den Gelehrten ein: Erasmus, Pirckheimer, Peutinger, Oekolampad, Hutten, Mutianus, Eoban Hesse, sogar Luther und Melanchthon. Ganze 53 Städte veröffentlichten proreuchlinsche Erklärungen.
1515, im Jahr der Schlacht von Marignano, gaben drei Humanisten ein sensationelles Buch heraus: Die Dunkelmännerbriefe. Sie gingen in die Literaturgeschichte der Satire ein, ein brillantes Briefwerk. Die Gelehrten Europas lachten sich fast tot, als sie diese fingierten Briefe lasen. Das Buch war eine Art Bestseller. Briefe, die Eoban Hesse, Crotus Rubeanus und Ulrich von Hutten an die reaktionären Theologen in Köln geschrieben haben, in denen die Argumentation zum Schreien war, in einem leicht verblödeten Latein, in geschraubter Scholastik, in dämlichem Stil, inhaltlich die Hauptthemen der Reformation betreffend: Reliquien, der Papst, der Ablasshandel. Nun verbot Leo X. dieses Buch, verurteilte Reuchlin, 65-jährig, zum Tragen der gesamten Kosten. Er verschwand aus der Öffentlichkeit.
Es gab noch eine weitere sehr wichtige Veränderung: die Rolle der Ritter in der Gesellschaft. In der neuen Welt war kein Platz mehr für sie, diese Schicht wurde aus der Gesellschaft herausgespült, und zwar sang- und klanglos. Der grosse und mächtige Ritter Franz von Sickingen und der jüngere Ulrich von Hutten waren eigentlich lebendige Anachronismen. Die Ritterschaft war untergegangen, aufgrund von wirtschaftlichen und sozialen Veränderungen. Der Boden hatte aufgehört, der entscheidende Besitz zu sein. An seine Stelle trat der bewegliche Besitz: das Geld.