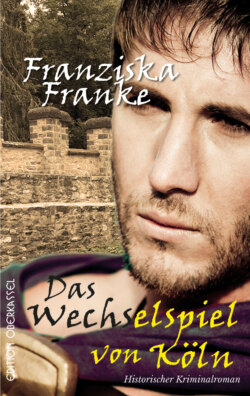Читать книгу Das Wechselspiel von Köln - Franziska Franke - Страница 7
Kapitel 4: Agrippina
ОглавлениеSo gleichmäßig wie das Niederprasseln des Regens, der uns seit Tagen zu schaffen machte, tauchten die Marinesoldaten ihre Ruderblätter in die schlammig-grauen Fluten des Stroms ein. In dichter Folge waren am linken Ufer römische Kastelle an unserer Liburne vorbeigezogen. Mit jeder Meile, die wir in Richtung Norden fuhren, sank die Temperatur und der Wind wurde schärfer. Wie die meisten Römer hasste ich die bedrohliche Unabwägbarkeit der Gewässer. Nur wenn es meine Geschäfte erforderten, hatte ich mich bisher den schwankenden Planken eines Schiffs anvertraut. Die schiere Vorstellung, beruflich zur See zu fahren, überstieg meine Phantasie. Das Schwanken des Bootes! Die hirnerweichende Monotonie der Ruderschläge! Das schweißtreibende Bedienen der Riemen! Die permanente Gefahr, Schiffsbruch zu erleiden, von den Barbaren auf dem anderen Rheinufer mit Speeren beworfen oder von Piraten gekapert zu werden! Kein Wunder, dass man bei der Marine zwei Jahre kürzer dienen musste als bei den Legionen.
Meine Verletzung hatte sich als harmlose, wenngleich schmerzhafte Fleischwunde erwiesen, die leider noch immer nicht völlig verheilt war. Doch nicht nur meine lädierte Schulter, das wechselhafte Wetter und der nicht vorhandene Komfort an Bord des Militärschiffs machten mir zu schaffen. Seit dem Überfall beschäftigte mich Tag und Nacht die Frage, ob ich den Wegelagerern zufällig in die Falle geritten war. Je mehr ich darüber nachdachte, umso mehr gelangte ich zu der Überzeugung, dass sie nicht wahllos irgendwelchen Reisenden aufgelauert hatten, sondern es auf mich abgesehen hatten. Sonst hätten sich die Schurken an der Landstraße postiert und nicht an der Abzweigung zu meinem Landgut. Ihr Anschlag war misslungen, aber ich musste wahrscheinlich mit einem zweiten Versuch rechnen. Wollte man meine Bemühungen, den Tod des Geldwechsler aufzuklären, durchkreuzen? Sicherlich war es kein Zufall, dass man mich nur einen Tag, nachdem ich mit dieser Aufgabe betraut worden war, überfallen hatte. Aber wie hatten die Halunken das erfahren? So wenig mir die Vorstellung behagte, musste ich wohl davon ausgehen, dass irgendjemand in der Militärverwaltung es ihnen mitgeteilt hatte.
Während ich noch dumpf vor mich hingrübelte, bemerkte ich, dass der Kapitän, ein vierschrötiger alter Haudegen, uns anblickte.
»Wir sind am Ziel«, informierte er uns knapp.
Gedankenverloren wie ich war, hatte ich gar nicht bemerkt, dass wir gerade einen weißgetünchten Leuchtturm passierten, der auf einer Landzunge stand. Er bewachte den Eingang eines breiten Hafenbeckens, in das wir hineinsteuerten.
Ich war auf das atemberaubende Panorama einer großen Stadt gefasst, aber hinter den Landestegen, die mit rechteckigen Eichenbohlen befestigt waren, zeichneten sich nur einfache Baracken vor dem trüben Himmel ab. Vergeblich blickte ich mich nach der Zivilsiedlung um. Auch Lucius reckte seinen Hals und schaute angestrengt in die Ferne. Einige Sekunden lang war ich wie vor den Kopf gestoßen, dann begriff ich, was geschehen war: Unsere Liburne lief gerade in den Militärhafen ein, der südlich der Veteranenkolonie lag. Hier befanden sich auch ein Hilfstruppenlager und das Hauptquartier der in Germanien operierenden Flotte.
»Ich dachte eigentlich, dass sie uns in die Stadt befördern«, schimpfte ich laut vor mich hin.
»Willst du nicht mit dem Kapitän sprechen?«
Wie immer, wenn es Schwierigkeiten gab, fand es Lucius selbstverständlich, dass ich mich darum kümmerte.
»Ich möchte die Marinesoldaten lieber nicht während des Landemanövers ablenken. Die Schifffahrt ist auch so ein gefährliches Geschäft«, brummte ich und beugte mich über die Reling.
Das Schiff verlor an Fahrt und wir legten sanft am Kai an. Die Ruder wurden eingezogen und eine Leine an Land geworfen, mit der die Liburne an den Kai gezogen und vertäut wurde. Die Landebrücke – eigentlich nur eine Planke – wurde auf das Deck herabgelassen. Kaum hatte sie den Boden berührt, eilte der Kapitän schon mit langen Schritten an Land. Ihm folgte ein finster dreinblickender Mann von Mitte fünfzig, der es während der Fahrt nicht für nötig befunden hatte, unsere Existenz zur Kenntnis zu nehmen. Man hatte uns gesagt, er sei ein ehemaliger Römischer Beamter, sein genauer Rang war mir entfallen. Angeblich hatte er sich in Germanien niedergelassen, aber ich konnte mir nicht vorstellen, dass er das freiwillig getan hatte.
»Wann kommt der Kapitän zurück?«, wandte ich mich an den Navigator, einen wettergegerbten Griechen.
»Keine Ahnung! Wohl nicht vor morgen Früh.«
Ich sah, wie die Männer auf dem Kai für den Kapitän und den Beamten auseinander traten.
»Und wie sollen wir dann in die Veteranenkolonie gelangen?«, fuhr ich den Offizier an.
»Man hat uns befohlen, euch mitzunehmen. Von einem Fuhrdienst war nicht die Rede.«
Der Navigator drehte sich jäh um und ließ uns einfach stehen.
»Ich finde, man hätte uns wenigstens Pferde zur Verfügung stellen sollen«, maulte Lucius, der bisher wie erstarrt neben mir gestanden hatte.
»Wem sagst du das«, stimmte ich verärgert zu. »Offenbar hat der Legat versäumt das anzuordnen. Aber Jammern hilft nichts. Wenn wir hier nicht übernachten wollen, werden wir wohl in die Stadt laufen müssen.«
Mein Bruder murmelte einige unverständliche Worte vor sich hin. Aber er folgte mir, als ich zum Deck hinunterstieg, um mein Gepäck zu holen. Als wir mit unseren Taschen und Ranzen an Land gingen, nieselte es. In Germanien war es nie sehr hell, aber diesen Tag empfand ich als besonders fahl und düster.
Sobald ich meine Füße auf festen Boden gesetzt hatte, kehrte mein Appetit zurück, der mir unterwegs abhandengekommen war. Hilfe suchend blieb ich einen Augenblick stehen und schaute mich um. Am Nachbarkai wurde gerade ein Schiff mit Baumaterial beladen und es wimmelte nur so von Soldaten. Aber niemand nahm Notiz von uns.
Wir verließen den Hafen und gelangten zu einer ausgebauten Straße, der wir folgten.
»Ich hätte nicht gedacht, dass ich mein Gepäck durch die Gegend schleppen muss«, brummte ich vor mich hin.
»Wenn dir dein leichter Seesack zu schwer ist, würdest du einen kläglichen Legionär abgeben«, kommentierte Lucius amüsiert. »Was meinst du, was wir außer unserer Rüstung während des Marsches herumschleppen müssen? Kleidung, Kochgeschirr und sogar unseren Proviant.«
»Deshalb hätte ich auch im Traum nicht daran gedacht, mich anwerben zu lassen«, entgegnete ich und ließ meinen Blick schweifen. Breit wälzte sich der graue Strom durch die flache Landschaft, die dem Auge nichts bot, an dem es sich hätte festhalten können. Argwöhnisch beäugte ich die dichten Büsche am Wegrand, hinter denen sich eine Räuberbande hätte verbergen können. Wenn man hier mitten in der Einöde überfallen wird, gibt es keine Rettung mehr, durchfuhr es mich. Beunruhigt verlangsamte ich meine Schritte und blickte zurück.
»Keine Sorge, du bist in Begleitung eines Soldaten«, meinte Lucius grinsend und ich schämte mich für meine Ängstlichkeit. Die Halunken, die mir aufgelauert hatten, waren wohl kaum unserem Schiff gefolgt.
»Ein Soldat, der im Büro mit Papyrusrollen kämpft«, ergänzte ich finster.
Einige Minuten später sah ich am Wegrand einen mit Moos überzogenen, verwitterten Meilenstein. Sein beklagenswerter Zustand erstaunte mich nicht. Auch meine Kleidung war inzwischen ganz klamm.
»Ich kann nur den Namen Vespasian entziffern. Aber es interessiert mich nicht, wer den Stein hat setzen lassen, sondern wie weit es noch bis zur Veteranenkolonie ist!«, sagte ich mürrisch, nachdem ich die verwaschene Inschrift auf der Vorderseite zu lesen versucht hatte. »Hoffentlich sind es nicht mehr als zwei Meilen.« Anklagend zeigte ich auf meine feinen Sandalen, die von einer Lehmschicht bedeckt waren. »Für diesen Gewaltmarsch könnte ich auch Armeesandalen gebrauchen.«
»Du kannst dich ja rekrutieren lassen«, brummte Lucius. Ich warf ihm einen vernichtenden Blick zu und wir setzten unseren Weg fort.
Nach einer Weile säumten Gräber beide Seiten der Straße, was ein gutes Zeichen war, denn Grabanlagen befanden sich selten weit von den Ortschaften entfernt. Manche der Monumente waren mit steinernen Masken geschmückt und auch sonst waren viele aufwändiger als die Grabdenkmäler von Mogontiacum.
Als sich die Veteranenkolonie endlich am Horizont abzeichnete, bestaunte ich ihre gewaltige Stadtmauer aus sorgfältig zugeschlagenen grauen Steinquadern. Sie war von einem Graben umgeben und besaß zahlreiche Tore und runde Wehrtürme. Ihre Aufgabe war nicht nur, die Barbaren abzuwehren, sondern die Mauer sollte auch die Macht und den Glanz des Römischen Reiches demonstrieren.
Je näher die Stadt rückte, desto zahlreicher wurden die Töpfereien. Am späten Nachmittag erreichten wir endlich ein protziges Stadttor mit flankierenden Türmen, das durch Architrave und umlaufende Bögen gegliedert war. Der mittlere Torbogen trug zur Feldseite die Lettern CCAA, wohl als Gedächtnisstütze für vergessliche Besucher. Die dahinterliegende Straße war völlig gerade, was in Mogontiacum eine Ausnahme war, denn die Wege unserer Heimatstadt folgten den natürlichen Gegebenheiten. Der Rauch unzähliger Herdfeuer stieg in den grauen Himmel. Kein Lüftchen rührte sich. Ein Unwetter lag in der feuchten Luft.
»Die Stadt ist noch beeindruckender, als ich erwartet habe«, entfuhr es Lucius, als wir das Tor passiert hatten. Perplex starrte er auf den gepflasterten Boden. Dergleichen gab es in Mogontiacum nur auf dem Forum.
»Hat nicht der Kaiser verordnet, dass Händler, Totengräber und Barbiere nur bis zu ihrer Türschwelle Kunden anwerben dürfen? Trotzdem haben sie die halbe Straße mit ihren Verkauf ständen zugebaut«, knurrte ich und beäugte die kosmopolitische Menschenmasse, die sich durch die für diesen Andrang viel zu engen Straßen quetschte. Man sah jede erdenkliche Haut- und Haarfarbe. Römische Kleidung war vorherrschend, aber dazwischen mischten sich auch keltische, levantinische und sogar orientalische Trachten. Die Köpfe der einheimischen Frauen wurden von auffälligen, fast kreisförmigen Hauben eher verschandelt als verschönert. Es handelte sich bei den Damen wohl um Ubierinnen, denn ich hatte an Bord der Liburne erfahren, dass die Ansiedlung vor Gründung der Veteranenkolonie Oppidum Ubiorum hieß.
»Diese Verordnung wird wahrscheinlich nicht einmal in Rom eingehalten«, meinte mein Bruder, sich ebenfalls mit skeptischer Miene umblickend. »Weißt du eigentlich, wo der Decurio wohnt?«
Ein junger Bursche rempelte mich an und ich griff automatisch nach meinem Geldbeutel, der aber weiterhin an meinem Gürtel baumelte.
»Im Villenviertel am Rheinufer«, entgegnete ich dann. »Mehr weiß ich leider auch nicht.«
Vor uns ertönte der scheppernde Klang einer Kapelle, die auf einem kleinen Platz spielte. Nachdem wir uns durch die das Spektakel begaffende Menge geschoben hatten, passierten wir eine Querstraße, die fast so breit wie die Hauptstraße war. Wie die folgenden Straßen, die unseren Weg kreuzten, war sie so gerade wie ein Zollstock. Offenbar verliefen alle Straßen der Veteranenkolonie rechtwinklig zueinander.
»Hier sieht es überall gleich aus«, beanstandete ich, denn allzu viel Symmetrie war mir nicht geheuer.
»Wenigstens verläuft man sich nicht so leicht, wenn man angeheitert nach Hause geht«, bemerkte mein Bruder.
Trotz der gepflasterten, schnurgeraden Straßen mussten die meisten Einwohner in Agrippina mit engen Streifenhäusern vorliebnehmen, deren Schmalseiten in lückenloser Reihe bis zur Straße reichten. Erst als wir uns dem Rheinufer näherten, lagen vor uns weitläufige kommunale Bauten. Auch ein mächtiger Tempel, der auf einem Podest stand, ragte in den trüben Himmel. Sicherlich handelte es sich um das Kapitol.
Ein junger Straßenhändler mit schmierigen, dunklen Locken, der mit einem Bauchladen voller Happen die Straße abschritt, erregte meine Aufmerksamkeit. Wenigstens sah seine Ware ansprechender aus als der Verkäufer. Zwar vermied es ein vornehmer Römer, auf der Straße zu essen, aber hier kannte mich schließlich niemand.
»Zwei von diesen geräucherten Fischen, bitte«, sprach ich den Straßenhändler an, bevor er an mir vorbeieilen konnte.
»Gute Idee!«
Es passierte selten genug, dass Lucius und ich einer Meinung waren.
»Was schulden wir dir?«, fragte ich den schwarzhaarigen Händler und er nannte einen exorbitanten Preis.
Lucius wollte protestieren, aber ich machte eine abwehrende Handbewegung.
»Kennst du zufällig den Weg zum Haus des Decurio Junius Petronius?«, erkundigte ich mich, nachdem ich bezahlt hatte. »Angeblich ist es nicht weit vom Rheinufer entfernt.«
Der Gesichtsausdruck des Händlers schwankte zwischen Amüsement und Widerwillen.
»Ihr seid wohl nicht aus Agrippina?«, fragte er gönnerhaft zurück.
Wenigstens wusste ich jetzt, dass die Einheimischen sich weder mit dem vollen Namen der Veteranenkolonie abplagten, noch die hässliche Abkürzung verwendeten.
»Nein, wir kommen aus Mogontiacum.«
Der Straßenhändler taxierte uns mit verächtlicher Miene. Ich fragte mich, ob die barsche Reaktion unserem Gastgeber in spe oder unserer Heimatstadt galt.
»Kennst du den Decurio?«, erkundigte ich mich vorsichtig.
»Selbstverständlich, den kennt hier jeder.«
Sein Tonfall zeigte, dass das Gespräch für ihn damit zu Ende war.
»Und wie komme ich zu seinem Haus?«, hakte ich nach.
»Ihr müsst zum Capitol gehen, dann das Forum überqueren und weitergehen, bis ihr einen kleinen Platz mit einem Weihestein der Aufanischen Matronen erreicht. Dort folgt ihr einem Weg in Richtung Rhein bis zu seinem Ende. Dann biegt ihr links um die Ecke. Das Haus des Decurio ist das dritte auf der rechten Straßenseite«, erläuterte der Straßenhändler erstaunlich präzise und wünschte uns dann mit spöttischem Grinsen einen schönen Abend. Wir vertilgten im Gehen unseren Fisch, der trockener war als er aussah, aber wenigstens den schlimmsten Hunger stillte.
»Ich brauche dringend einen Becher Wein«, sagte ich und steuerte die nächste Schenke an.
»Wollen wir den Wein nicht lieber auf Kosten unseres Gastgebers trinken? Die Höflichkeit gebietet es ihm, uns einen Willkommenstrunk anzubieten«, sagte Lucius mit halbvollem Mund. »Leider bin ich etwas knapp bei Kasse.«
Das war sicherlich eine schamlose Untertreibung. Wie ich ihn kannte, hatte er seinen Sold für mehrere Monate im Voraus verspielt. Ich wies Lucius nicht darauf hin, dass ich unsere Mahlzeit auf die Spesenrechnung setzten wollte, denn er sollte für seinen Leichtsinn büßen.
Leider entpuppte sich die Taverne als miese Spelunke und ich verließ augenblicklich den Schankraum.
»Vielleicht sollten wir uns doch lieber am Forum einen guten Schluck genehmigen«, murmelte ich draußen.
Die Schatten wurden bereits länger, als wir endlich den gewaltigen, von einer halbrunden Exedra abgeschlossenen Platz erreichten. Die meisten Bauten waren mit Marmor verkleidet, dessen Weiß mit dem Hellgrau des Himmels verschmolz. In der Mitte des Forums, das von Ladengeschäften gesäumt wurde, stand ein vergoldetes Bronzestandbild des Kaisers auf einem hohen Podest. Später erfuhr ich, dass man in Agrippina die Handwerker außerhalb der Stadtmauern verbannt hatte, teils wegen der Brandgefahr, die von manchen Werkstätten, wie Töpfereien, Glashütten oder Schmieden ausging, und teils damit die Reisenden bereits vor Betreten der Stadt die heimischen Produkte bewundern konnten. Trotz dieser Beschränkungen war das Forum alles andere als beschaulich: Von Ochsen gezogene Karren mit Lebensmitteln polterten über das Steinpflaster und Müßiggänger standen plaudernd, streitend oder lachend in kleinen Gruppen auf dem Platz. Zwischen ihnen rannten Kinder laut jauchzend herum. Wie mochte es hier erst zur fünften Stunde zugehen, wenn sich in Mogontiacum das Forum am meisten füllte?
Wir kehrten in einer Taverne ein, wo wir unsere von der Wanderung und dem Nieselregen in Mitleidenschaft gezogene Kleidung auf Vordermann brachten.
»Gerade Straßen, rechte Winkel! Langsam komme ich mir vor wie im Legionslager!«, beschwerte sich nun auch mein Bruder, als wir die Wirtschaft verließen.
»Vielleicht ertragen die Veteranen nach zwanzigjährigem Dienst nichts anderes?«, bemerkte ich, ein Gedanke, der mir unterwegs mehrmals in den Sinn gekommen war.
Mit den letzten Strahlen der Sonne erreichten wir das Haus des Decurio: Ein schmuckes Atriumhaus, das es jedoch nicht mit den Prachtbauten der Nachbarschaft aufnehmen konnte. Ohne die hohe Stadtmauer hätte es jedoch einen schönen Blick auf den Rhein geboten.
»Iss und trink nichts, das der Hausherr nicht vorher gekostet hat«, ermahnte ich Lucius, bevor ich anklopfte.
»Meinst du, der Decurio vergiftet jeden, der ihn zufällig besucht?«
»Denk dran, dass wir Freunde des Legaten sind. Auch kannten wir den verstorbenen Bankier und werden uns nach ihm erkundigen. Aber nimm bitte auf keinen Fall das Wort Mord in den Mund. Das würde unseren Gastgeber argwöhnisch machen«, fuhr ich fort, ohne die unqualifizierte Frage meines Bruders zu beantworten.
»Das ist ganz schön kompliziert«, erwiderte Lucius lachend.
»Am besten überlasse ich dir die Konversation.«
Ich widersprach nicht, sondern pochte mit dem ringförmigen Türklopfer gegen das Portal.