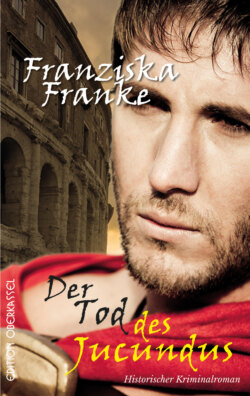Читать книгу Der Tod des Jucundus - Franziska Franke - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1. Das Fest der Anna Perenna
ОглавлениеJedes Jahr, wenn sich der Tod des Viehhirten Jucundus jährt, opfere ich Wein vor dem Grabstein, den ihm sein Patron Marcus Terentius errichten ließ. Dann betrachte ich die in die Vorderseite des Steins eingemeißelte bukolische Szene: Ein Hirte mit einer Peitsche und zwei Bäume sind darauf zu sehen sowie fünf Tiere, bei denen es sich wohl um einen Schäferhund und vier Schafe handeln mag. Aber der Steinmetz war kein begnadeter Künstler, weshalb ich mir nicht ganz sicher bin. Jedoch für die entlegene Provinz Obergermanien mochte sein Talent wohl reichen, denn die anderen Grabsteine, die die Ränder der Ausfallstraße säumen, sind auch nicht von wesentlich höherer Qualität.
An diesen Jahrestagen erinnere ich mich stets an den Abend, an dem ich von einer zweiwöchigen Geschäftsreise zurückkam. Der Winter neigte sich endlich seinem Ende zu und ich hatte daher die Weinberge inspiziert, die unser Handelskontor an der Mosel besitzt. Wie immer hatte es mich mit Stolz erfüllt, dass wir inzwischen unseren Moselwein sogar nach Rom lieferten. Um die steigende Nachfrage befriedigen zu können, hatten wir einige Weinberge dazugekauft, deren Kultivierung ich in den vergangenen zwei Wochen überwacht hatte. Nun reiste ich als Passagier auf einer Prähme zurück. Das ist ein Schiff mit flachem Boden, dessen kastenförmiger Rumpf an Bug und Heck abgeschrägt war. Der Vorzug derartiger wenig elegant aussehender Schiffe ist, dass sie auch ohne Hafenanlage am Ufer landen können und das ist sehr praktisch, denn solche Hafenanlagen waren an der Mosel meist nicht vorhanden. Aber auch auf dem Rhein zu navigieren ist schwierig. Denn flussabwärts verengt sich das Tal des Stroms, wodurch das Wasser reißend wird und es drohen Stromschnellen und Klippen.
Am Horizont zeichneten sich bereits die breite Rheinbrücke und die Mauern des Legionslagers Mogontiacum ab, das sich auf einer Anhöhe am Rheinknie erhob. Den Germanen auf der anderen Rheinseite sollte es signalisieren, wer das Land auf dem linken Rheinufer beherrschte. Die Zivilsiedlung mit ihren kommunalen Bauten, ihren Tempeln und dem Forum war hingegen erst später um das Legionslager herum entstanden. Doch inzwischen war Mogontiacum eine richtige Stadt.
Ich freute mich, dass der Kapitän meines Handelsschiffes es geschafft hatte, die Stadt vor Beginn der Dämmerung zu erreichen. So würde ich früh nach Hause gehen können, da ich mich müde und abgespannt fühlte. Die Stadt kam immer näher und ich bemerkte, dass die Mauer, die das Legionslager umgab, in der Zwischenzeit frisch geweißt worden war. Ob man sich wohl die Mühe gemacht hatte, auch die Mannschaftsbaracken zu renovieren? Wohl kaum, zumal die Steinbauten erst vor zehn Jahren Holzbaracken ersetzt hatten.
Während ich mir diese Frage stellte, kam mir ins Bewusstsein, dass ich zwar unzählige Amphoren und Fässer an die Legionen geliefert, aber noch niemals das Lager von innen gesehen hatte, da es nur Angehörige der Armee betreten durften. Sicherlich hatte ich nichts versäumt, denn die römischen Legionslager wurden unter rein praktischen Gesichtspunkten errichtet. Ästhetik spielte dabei eine untergeordnete Rolle. Aber es ärgerte mich trotzdem, dass ich mich mit der Rolle eines Zaungastes begnügen musste. Die Wachsoldaten mussten mich mittlerweile für einen besseren Fuhrknecht halten.
Trotz dieser finsteren Gedanken musste ich zugeben, dass die Umfassungsmauer mit ihren Toren eindrucksvoll war. Die zur Zivilsiedlung gelegene Porta Praetoria mit ihren beiden Türmen war das prächtigste der Tore, denn die Rheinfront war sozusagen die Schauseite des Lagers.
Bei meiner Ankunft lagen mehrere Schiffe im rechteckigen Hafenbecken vor Anker. Das kam nicht häufig vor, obwohl Mogontiacum ein wichtiges Handelszentrum war. Trotzdem war der Ort aber eine typische Soldatenstadt geblieben, deren öffentliches Leben von den Legionären bestimmt wurde. An diesem Nachmittag ging es jedoch am Hafen recht lebhaft zu.
Unser Schiff wurde am Kai vertäut und die Hafenarbeiter schoben eine breite Planke auf das Schiffsdeck, die wir als Laufsteg benutzen konnten. Es war ein gutes Gefühl, wieder festen Boden unter den Füßen zu haben. Die Hände hinter dem Rücken verschränkt, pfiff ich eine Melodie vor mich hin, die abrupt verstummte als ich den unglücklichen Jucundus erblickte. Aber ich greife vor, denn damals war er noch munter und guter Dinge. Vielleicht sollte ich aber an dieser Stelle erwähnen, dass Jucundus und ich Freigelassene desselben Herrn waren. Daher teilten wir viele, wenn auch nicht immer besonders angenehme Erinnerungen.
»Marcus!«, rief er mir schon aus der Ferne zu und ruderte dabei wild mit den Armen in der Luft herum.
Einen Augenblick lang erwog ich, in eine andere Richtung zu blicken, denn mir war nicht nach einem Schwätzchen zumute. Verschwitzt wie ich war, hätte ich lieber sofort die Therme aufgesucht. Jedoch war es schlechterdings nicht möglich, jemandem an dem kleinen Hafenbecken auszuweichen.
Also kapitulierte ich vor dem Unvermeidlichen: Damit Jucundus nicht weiterhin soviel Aufmerksamkeit auf sich lenkte, winkte ich zurück und gab damit zu erkennen, dass ich ihn sah. Mein ehemaliger Mitsklave bahnte sich seinen Weg durch die Matrosen und Schauerleute, die am Hafen Säcke, an Stangen befestigte Transportamphoren und sorgfältig verschnürte Bündel von den Schiffen schleppten oder Fässer auf hölzernen Laderampen herunterrollten. Die Fuhrleute mit ihren Wagen warteten schon auf sie. Andere Waren gingen den umgekehrten Weg: Sie wurden von Händlern auf die Schiffe verladen.
Meinem früheren Mitsklaven folgte mit einem Schritt Abstand ein finster dreinblickender junger Mann in schmuddeliger Kleidung, bei dem es sich nur um einen Sklaven handeln konnte. Ich fragte mich, ob Jucundus, der die Herden fremder Gutsbesitzer weidete, sich einen Sklaven gekauft haben könnte. Aber ich verwarf diesen Gedanken wieder. Das dürfte wohl jenseits seiner Verhältnisse liegen.
Als Jucundus mich fast erreicht hatte, schlug mir ein strenger Geruch entgegen, der von seinem Umgang mit den Tieren herrührte und den er wohl auch mit drei Durchgängen in der Therme nicht hätte loswerden können. Beim Anblick seiner grob gewebten, mehrfach geflickten Tunika, die einfach zu nennen ein Euphemismus gewesen wäre, beglückwünschte ich mich dazu, Weinhändler geworden zu sein.
Hoffentlich umarmt er mich nicht, dachte ich schlecht gelaunt, denn ich trug eine frisch gewaschene Tunika aus feinem weißem Tuch. Schließlich musste ich bei meinem Beruf immer repräsentativ gekleidet sein. Aber glücklicherweise hob der Viehhirte nur die Hand zum Gruß. Die strahlende Miene des Jucundus stand in starkem Gegensatz zum mürrischen Gesichtsausdruck des Sklaven.
»Ich bin gerade auf dem Weg in die Taverne«, verkündete mein ehemaliger Mitsklave. »Heute ist der Tag der Anna Perenna und den will ich natürlich würdig begehen.«
Ich stutzte einen Augenblick lang, denn zuerst konnte ich mit dem Namen der Göttin nichts anfangen, aber dann besann ich mich: Anna Perenna war eine der kleineren Gottheiten im großen Pantheon unseres Götterhimmels. Ihr zu Ehren wurden Frühjahrsfeste gefeiert, die wohl eher den Namen von Gelagen verdienten. Die Anhänger der Göttin glaubten nämlich, noch so viele Jahre vor sich zu haben, wie sie Becher Wein am Tag der Anna Perenna tranken. Glücklicherweise hing ich keinem derartigen Aberglauben an, denn ich war noch zu jung, als dass ich so viele Trinkgefäße hätte leeren können, wie ich noch Jahre zu leben hoffte.
»Vorher muss ich aber noch einen Abstecher ins Handelskontor machen, um einen Blick in die Rechnungsbücher zu werfen«, wandte ich ein und hätte selbst nicht zu sagen vermocht, ob das nicht eher eine Ausrede war, um Jucundus abzuwimmeln. Manchmal war es mir regelrecht peinlich, mit dem stets ungekämmten Viehhirten zusammen gesehen zu werden. Man konnte schließlich nie wissen, ob man Kunden begegnete. In die Therme hätte er mir folgen können, aber in meiner Schreibstube war ich höchstwahrscheinlich sicher vor ihm.
»Du kannst ja nachkommen, wenn du mit der Arbeit fertig bist. Ich fange schon mal an. Schließlich habe ich heute Abend noch viel vor«, bot Jucundus mir an und zeigte auf eine der heruntergekommenen Schenken, an denen im Hafenviertel, das oberhalb der sumpfigen Uferzone des Rheins lag, kein Mangel bestand. Wahrscheinlich konnte er sich keine andere leisten.
»Ich werde sehen, was sich machen lässt«, erklärte ich absichtlich ziemlich vage und ließ meinen ehemaligen Mitsklaven einfach an dem mit Pfählen befestigten Hafenbecken stehen.
Aus praktischen Gründen befand sich unser Handelskontor wie die meisten Lagerschuppen und Kontore der Stadt in der Nähe des Hafens. Daher war es für mich kein großer Umweg, tatsächlich dort vorbeizuschauen. Draußen stand ein leerer Wagen, den ich nicht kannte, dem ich aber keine besondere Bedeutung beimaß.
Ich drückte die Klinke der Eingangstür herunter, aber es gelang mir nicht, die Tür aufzuziehen. Erstaunt stellte ich fest, dass sie abgeschlossen war. Seit wann schloss sich Respectus, mit dem ich das Handelskontor führte, während der Arbeit ein? Dies war ein hochgradig geschäftsschädigendes Verhalten! Schließlich sollten die Kunden nicht abgeschreckt werden, wenn sie das Lager zu betreten wünschten.
Ich klopfte mit den Handknöcheln an die hölzerne Tür, aber niemand reagierte. Warum hörte Respectus mich nicht? Dass mein Bruder offenbar schon Feierabend gemacht hatte, war nicht weiter erstaunlich, aber wo mochte Respectus sein? Es passte gar nicht zu ihm, unser Kontor vorzeitig zu schließen. Gewöhnlich arbeitete er bis spät in die Nacht und kaum graute der Morgen, war er auch schon wieder in seiner Schreibstube. Er machte üblicherweise seinem Namen Respectus alle Ehre.
Missmutig kramte ich den Schlüsselbund aus meinem Bündel, suchte nach dem richtigen Schlüssel, drehte ihn im Schloss herum und öffnete die Tür. Drinnen war die Luft abgestanden und staubig. Es roch nach vergossenem Wein und dem Harz alter Fässer. Offenbar war während meiner Abwesenheit nicht ordentlich gelüftet worden.
»Guten Abend! Ich bin wieder da«, rief ich in vorwurfsvollem Tonfall durch die mit Weinfässern und Amphoren angefüllte Eingangshalle, die uns als Verkaufsraum diente, denn noch immer war ich davon überzeugt, dass sich Respectus im Handelskontor aufhielt.
Keine Antwort.
»Wo bist du Respectus?«, rief ich erneut, diesmal noch unfreundlicher.
Missmutig machte ich mich auf den Weg zu seinem Arbeitsraum, der sich am linken Ende der Halle befand.
Ich riss die Tür auf und wollte schon meinen Partner fragen, ob er neuerdings schlecht höre. Aber ich erstarrte mitten in der Bewegung, denn Respectus saß nicht an seinem Schreibtisch, wovon ich mit der größten Selbstverständlichkeit ausgegangen war. Zutiefst irritiert schaute ich in alle anderen Räume, aber er war nirgends zu finden.
Es kostete mich einige Mühe, aus seinen Papieren klug zu werden, zumal seine Schrift schwer lesbar war. Schließlich gab ich es auf und verließ meinen Arbeitsplatz zur achten Stunde. Während ich die Lagerhalle durchquerte, hörte ich ein polterndes Geräusch, das vom Speicher herunterdrang.
Ich blieb stehen und spitzte die Ohren, aber von oben kam kein weiterer Laut. Trotzdem erwog ich, auf dem Dachboden nach dem Rechten gesehen, denn ich vermutete Respectus könnte vergessen haben eine Dachluke zu schließen. Aber ich überlegte es mir anders, da ich meine Kleidung nicht verschmutzen wollte. Wir verwendeten den Speicher nämlich nur zum Einlagern von Weinen, die wir erst in einigen Monaten verkaufen wollten. Ansonsten überließen wir ihn den Spinnen, Ratten und Fledermäusen. So lang ich mich entsinnen konnte, war dort oben niemals gefegt worden.
Morgen ist auch noch ein Tag, dachte ich und riss die Haustür auf. Draußen war bereits schwarze Nacht und ein eisiger Wind blies mir ins Gesicht. Schon wollte ich mich auf den Heimweg machen, als ich mich plötzlich an die Begegnung mit Jucundus erinnerte und ein schlechtes Gewissen bekam. Schließlich hatte ich ihn am Flussufer regelrecht abgewimmelt, obwohl er mich immer freundlich behandelt hatte, zumindest seit wir beide Freigelassene waren. Mit einem leisen Seufzer rang ich mich dazu durch, seiner Einladung Folge zu leisten.
Ich lenkte also meine Schritte in Richtung Hafen. Als ich die große Säule passierte, die man zu Ehren aller Götter errichtet hatte, roch die Luft nach Teer und ich hörte die Möwen, die am Strom in den Wind schrien. Drohend erhob sich auf der Säule die triumphale, überlebensgroße Bronzefigur des Staatsgottes Jupiter, die mit Gold überzogen war.
Im fahlen Licht des Vollmonds sah ich aus einem Schornstein Dampf entweichen, ein untrügliches Zeichen dafür, dass sich im dazugehörigen Haus eine Badeanlage befand. Die Vorstellung, es mir im wohlig-warmen Caldarium gut gehen zu lassen, übte eine geradezu unwiderstehliche Anziehungskraft auf mich aus. Warum hatte mein ehemaliger Mitsklave bei meiner Ankunft am Hafen herumspazieren müssen? Ob er mir dort aufgelauert hatte? Oder war Jucundus zufällig vorbeigekommen, da sich die Taverne in der Nähe des Hafenbeckens befand?
Es kostete mich einige Überwindung, die Schenke in dem baufälligen Eckhaus zu betreten, denn durch die Fenster drang das Grölen betrunkener Legionäre. Einen Augenblick lang blieb ich unschlüssig vor der Tür stehen. Dann rief ich mir ins Gedächtnis, dass ich als Weinhändler derartigen Besäufnissen eigentlich eine positive Seite abgewinnen sollte. Ich gab mir einen Ruck und trat ein.
Das Innere des Lokals hielt, was das Äußere versprach: Von dem mit Binsen bestreuten Lehmboden bis zur niedrigen Decke aus groben Sparren war die Schenke so mies, wie eine Schenke nur sein konnte. Zwei Fässer waren hinter dem Ladentisch aufgestellt. Ein Mischkrug hing an einem Haken und ich vermutete, dass an diesem seltsamen Festtag der Wein stark verdünnt getrunken wurde, um die Anzahl der Gläser zu steigern.
Im Schankraum lungerten betrunkene Soldaten herum und ich wollte schon wieder gehen, da ich kein bekanntes Gesicht erblickte. Aber dann erkannte ich in der hintersten Ecke Jucundus, der mit meinem Bruder Lucius becherte. Er hätte mich vorwarnen sollen, dann wäre ich nicht gekommen, da ich aus verschiedenen Gründen nicht gut auf meinen Bruder zu sprechen war. Hinter Jucundus stand der mürrische Sklave. Also war Jucundus tatsächlich sein Herr. Ich war ehrlich gesagt ziemlich beeindruckt, dass der Hirte mittlerweile einen Sklaven sein eigen nannte, auch wenn dieser sicher ein Restposten des zwielichtigsten Sklavenhändlers am Rhein gewesen war. Er war nämlich recht schmächtig und hatte dünnes, aschblondes Haar, das seine großen Ohren kaum bedeckte.
Die widerspenstigen braunen Locken seines Herrn hingegen erweckten wie immer den Eindruck, als sei dieser soeben aus dem Bett aufgestanden. Dies und die Liebe zum Rebensaft hatte er mit meinem sauberen Bruder gemeinsam.
Als ich mich auf einen der wackligen Stühle fallen ließ, versiegte das Gespräch am Tisch und ich fragte mich, worüber man gerade gesprochen hatte. Lucius wich meinem Blick aus und ich suchte nach einem Vorwand, mich sogleich wieder zurückzuziehen. Doch Jucundus wusste dieses Vorhaben zu verhindern, indem er mir eine Portion des Tagesgerichtes und einen Becher Wein bestellte, der für mich eine Enttäuschung gewesen wäre, wenn nicht schon die altersschwache Einrichtung meine Erwartungen heruntergeschraubt hätte. Wenn ich eine derart schale Brühe verkaufen würde, hätte ich den Weinhandel schon längst an den Nagel hängen können. Missmutig würzte ich mein Essen – lauwarmes Geflügel und Fladenbrot vom Vortag - mit einer besonders großen Portion Garum.
Dann musterte ich die Umgebung: Offensichtlich kamen die Kunden weder wegen der Qualität des Weines noch wegen des Wirtes, der bärbeißig in die Runde starrte. Auch empfahl es sich, nicht zu genau die Sauberkeit der Tische zu überprüfen. Dazu bestand allerdings auch kaum Gelegenheit, denn nur vier kleine Öllämpchen funzelten in den Ecken des Raumes.
Allenfalls die Tochter des Wirts mit ihrem hübschen, wenn auch leicht einfältigen runden Gesicht, die die Gäste bediente, könnte den einen oder anderen Gast hergelockt haben. Trotz des frischen Wetters trug sie eine dünne Untertunika, die an den Schultern von billigen Spangen zusammengehalten wurde und darüber ein ärmelloses Gewand, das sich über dem Gürtel bauschte. Diese frühlingshafte Aufmachung wurde von einem Paar zierlicher Sandalen abgerundet.
Schnell war mein Weinbecher geleert, dessen Inhalt ich gebraucht hatte, um das fettige Essen herunterzuspülen. Aber ich konnte mich nicht überwinden, einen neuen Wein zu bestellen, weil er so grässlich schmeckte. Ich ließ also meinen Blick gelangweilt durch den Schankraum schweifen und spielte dabei mit meinem Trinkgefäß. Auf dessen Rand war geschrieben: »Trink, wohl bekomm’s«, auf dem des Jucundus hingegen »Spar das Wasser«, was die Aufforderung war, unverdünnten Wein zu trinken. Leider hielt mein ehemaliger Mitsklave sich an diese Devise, genauso wie mein Bruder. Ich hingegen bestand auf verdünntem Wein.
Als ich sah, wie Lucius sich mit glasigem Blick an seinem Becher festhielt, fragte ich mich, was um Jupiters Willen nur bei seiner Erziehung schief gelaufen war. Von mir hatte man immer erwartet, dass ich mich vernünftig verhielt, während Lucius noch mit Anfang zwanzig der kleine Bruder war.
Jucundus gab mir einen weiteren lauwarmen Wein aus, obwohl ich der reichere von uns beiden war und es eigentlich hätte umgekehrt sein sollen. Ich konnte mich des Verdachtes nicht erwehren, dass er etwas auf dem Herzen hatte. Aber was mochte es sein? Das letzte Mal als er so freigiebig war, wollte er sich meinen Wagen nebst Zugtier ausleihen. Was konnte er nur schon wieder von mir wollen? Ich war mir sicher, dass ich es bald erfahren würde. Daher fragte ich nicht nach.
Um nicht als Schmarotzer dazustehen, bezahlte ich den nächsten Wein und den übernächsten ebenfalls, denn langsam war mir der Gedanke peinlich, einer meiner Freunde könnte herumerzählen, dass der abgerissene Jucundus mich und offensichtlich auch meinen Bruder aushalten müsse. Obwohl es zum Glück höchst unwahrscheinlich war, dass einer meiner Freunde sich in diese Spelunke verlief. Was meine Kunden betraf, war ich mir nicht ganz so sicher. Einige von ihnen hatten keinen besonders guten Geschmack.
Ich schob diesen unangenehmen Gedanken beiseite, zumal mich der Wein in eine wohlig-träge Stimmung versetzt hatte.
»Womit handelt ihr eigentlich in eurem Kontor?«, wollte Jucundus etwas unvermittelt wissen und ich fragte mich, ob er schon so früh am Abend völlig betrunken war, obwohl er doch vorhatte einen Becher für jedes Jahr zu trinken, das er noch leben wollte.
»Mit Wein natürlich«, kam Lucius mir zuvor, »deshalb heißt es auch Weinkontor.«
»Aber vorhin …«
Meine Aufmerksamkeit begann langsam nachzulassen und daher bekam ich das Ende des Satzes nicht mit, was mich später ziemlich ärgerte. Die Stimmen im Raum verschmolzen zu einem unverständlichen Klangteppich und alles drehte sich um mich herum.
»Das ist der zehnte Becher«, waren die letzten Worte, die ich Jucundus sagen hörte und wer weiß, vielleicht waren es die letzten Worte, die er jemals gesagt hat.
Mein benebelter Blick streifte den Sklaven und ich fragte mich, ob er wohl den Aberglauben seines Herrn teilte. Man hätte ihn eigentlich mittrinken lassen sollen!
Meine Lider fielen immer wieder zu und mein Kopf wurde schwer und schwerer. Langsam, aber sicher sank er auf die Tischplatte hinab. Dann verschwamm alles um mich und ich schlief ein.
Lautes Gelächter weckte mich wieder und ich fragte mich, wie spät es wohl war. Mit einer wahrhaft titanischen Anstrengung riss ich meinen bleiernen Kopf wieder hoch.
»Ich jedenfalls habe für heute genug«, verkündete ich dann in die verdutzte Runde. »Schließlich habe ich einen anstrengenden Tag hinter mir.«
Ich warf meinem Bruder Lucius einen vorwurfsvollen Blick zu, denn ich hatte den Verdacht, dass er nur gefaulenzt hatte, während ich an der Mosel gewesen war. Anderenfalls hätte ich ihn am Nachmittag im Handelskontor antreffen müssen.
Aber Lucius zeigte keinerlei Reue, sondern zuckte nur mit den Schultern. Ich dachte an Cato den Älteren, der vorgeschlagen hatte, das Forum Romanum mit spitzen Steinen zu pflastern, um die Müßiggänger zu vertreiben, aber das war ziemlich lange her.
»Bleib doch noch etwas«, bat mich mein Bruder mit schleppender Stimme und ich fragte mich ernsthaft, warum er das tat. Denn ich war alles andere als unterhaltsam, so müde und mehr als halb betrunken, wie ich war. Mir wurde in diesem Augenblick bewusst, dass ich mich den ganzen Abend lang so gut wie gar nicht am Gespräch beteiligt hatte.
»Du bleibst statt meiner. Du kannst die Familienehre hochhalten, was das Trinken betrifft«, erwiderte ich und erhob mich mühsam wie ein alter Mann von meinem Stuhl.
Mit weichen Knien schwankte ich durch den Schankraum und fand erst im dritten Anlauf die Tür. Die Nacht war bitter kalt, aber der eisige Wind, der vom Rhein herwehte, tat mir gut, denn er vertrieb die schlimmste Trunkenheit. Doch er half nicht gegen die quälende Müdigkeit, die mich nicht verlassen wollte.
Das flackernde Licht von Öllampen erhellte hie und da ein Fenster. Da ich vergessen hatte, eine Fackel mitzunehmen, musste ich halbblind durch die Finsternis tappen. Daher bemerkte ich einen auf dem Weg liegenden Gegenstand zu spät. Ich strauchelte, ruderte mit den Armen in der Luft und fiel fast hin, ehe ich laut fluchend das Gleichgewicht einigermaßen zurückerlangte.
Ein Fensterladen des Hauses, vor dem sich dieses Drama abgespielt hatte, wurde geöffnet und eine schrille, weibliche Stimme beschwerte sich über die nächtliche Ruhestörung. Einige Sekunden später wurde der Inhalt eines Nachttopfes hinausgeschüttet und verfehlte mich nur knapp. Während ich weitertaumelte, streifte ein kalter Hauch mein Gesicht und ich begann am ganzen Körper zu zittern. Mit aller Willensanstrengung, die ich aufbringen konnte, schleppte ich mich weiter. Doch meine Beine waren wie aus Teig und die Straße schwankte.
Krampfhaft umklammerte ich meinen ledernen Geldbeutel, denn mit dem letzten Rest meines Verstandes befürchtete ich, beraubt zu werden und setzte einen Fuß vor den anderen. Aber eine lähmende Benommenheit nahm immer mehr von mir Besitz. Apathisch trottete ich weiter durch dunkle Gassen, an leeren Plätzen vorbei und um stinkende Straßenecken herum.
Irgendwie schaffte ich es, mich bis über die Schwelle unseres Hauses zurückzuschleppen. Dann brach ich zusammen. Das letzte, was ich noch wie durch einen Schleier wahrnahm, war, dass mir eine Öllampe vor das Gesicht gehalten wurde und sanfte Hände mich emporhoben.