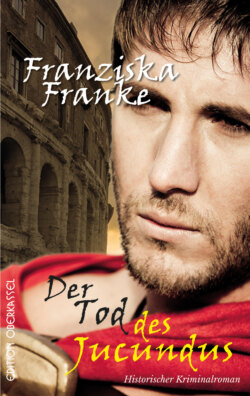Читать книгу Der Tod des Jucundus - Franziska Franke - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4. Der Sklave
ОглавлениеAls ich die auf steinernen Pfeilern errichtete Holzbrücke überquerte, fragte ich mich, ob die Existenz der Rheinbrücke für mich an diesem Tag ein Fluch oder ein Segen war. Einerseits ersparte sie mir, mit der Fähre überzusetzen, andererseits hätte Jucundus sonst womöglich nicht nahe beim »Castellum Mattiacorum« genannten Brückenkopf von Mogontiacum Quartier genommen, wo es nur wenige Tavernen gab. Wie mein Bruder interessierte er sich für nichts anderes. Schon am Vortag hatte ich mich gefragt, wo mein ehemaliger Mitsklave nach seiner Zechtour zu übernachten gedachte. Eigentlich konnte er nur geplant haben, bis zum Morgengrauen in der Schankwirtschaft zu bleiben.
Zweirädrige und vierrädrige Wagen kamen mir entgegen, die mit Weinamphoren und anderen Handelsgütern beladen waren. Ich schaute mich nach einem Bekannten um, der mich offenbar nicht bemerkt hatte, und mein Blick blieb an den Fischerbooten haften, deren helle Segel vom Wind aufgebläht waren und ich fragte mich, ob ich wohl jemals das Mare nostrum sehen würde. Es war schon seit Jahren mein sehnlichster Wunsch, Rom zu besuchen.
Dann erblickte ich einen Trupp Soldaten, die am anderen Ufer über die Hügel marschierten. Dieser Anblick ließ mich innerlich erschaudern; wenn auch der Anblick von Soldaten zum Alltag eines Legionslagers gehört, erinnerten sie mich stets an ihr kriegerisches Handwerk, das schließlich schlecht für das Geschäft ist.
Auch sonst fühlte ich mich nicht wohl in meiner Haut. Jeder Hufschlag meines Pferdes, der mich näher an mein Ziel brachte, ließ mich an meinem Vorhaben zweifeln. Was sollte ich diesen Sklaven fragen? War es klug, ihm auf den Kopf zuzusagen, dass ich ihn für einen Mörder hielt? Und wenn er alles abstritt? Ich war nicht sein Herr und konnte ihm daher nichts befehlen. Was also versprach ich mir von dem Abstecher auf die andere Rheinseite?
Als ich das Ende der Brücke erreicht hatte, erwog ich ernsthaft, wieder umzukehren. Das musste mir nicht peinlich sein, denn ich hatte niemanden in meine Pläne eingeweiht. Ich zügelte mein Pferd, aber dann siegte die Neugier über meine Bedenken.
Ich hatte die Behausung des Viehhirten zuvor nur einmal aufgesucht und das war einmal zuviel gewesen, denn wir hatten uns nur angeschwiegen. Nach all den Jahren, die vergangen waren, nachdem sich unsere Lebenswege getrennt hatten, hatten wir uns buchstäblich nichts mehr zu sagen gehabt.
Obwohl dieser missglückte Besuch mindestens ein Jahr zurücklag, fand ich mühelos den Weg, was aber keine große Leistung war, denn die Zivilsiedlung um den Brückenkopf von Mogontiacum war winzig klein. Genauer gesagt, bestand sie nur aus ein paar Dutzend niedrigen Bauten. Sie wurden deklassiert vom großen Ehrenbogen mit seinen drei Durchgängen, den man Germanicus zu Ehren hatte errichten lassen. Die weiße Kalksteinverkleidung des Monuments reflektierte das Licht und das vergoldete Reiterstandbild, das den Bogen bekrönte, strahlte überirdisch in der Sonne.
Das Haus des Jucundus lag am Rande des Orts und ich muss zugeben, dass es mich angenehm überraschte. Schon die Tatsache, dass er sich mittlerweile einen Sklaven leisten konnte, hätte mich auf den Gedanken bringen sollen, dass der Viehhirte es zu einem bescheidenen Wohlstand gebracht hatte. Ein einfacher, aber gepflegter Ziegelbau hatte seit meinem letzten Besuch die einfache Hütte ersetzt.
Wer würde das Anwesen nun wohl erben? Soweit ich wusste, besaß Jucundus keine Verwandten. Er war der einzige Sohn eines Kriegsgefangenen von der äußersten Grenze des Imperiums. Das hatte er jedenfalls behauptet, aber vielleicht besaß er drei uneheliche Kinder in Mogontiacum und hatte sich daher ins Hinterland verdrückt. Man konnte nur hoffen, dass er einen letzten Willen zu Gunsten Cornelias verfasst hatte. Wenn ein Freigelassener kein Testament hinterließ, erbte nämlich sein Patron den Besitz.
Ich saß ab und band mein Pferd an einem Baum fest, um zu verhindern dass es das Gemüse im Vorgarten fraß. Vorsichtig schaute ich mich um, aber niemand versuchte, mich davon abzuhalten, das Grundstück zu betreten. Einen Augenblick lang blieb ich unschlüssig vor der Haustür aus massiver Eiche stehen. Dann gab ich mir einen Ruck und klopfte an, aber entweder war niemand zu Hause oder der Bewohner reagierte nicht. Vielleicht schärfte der Sklave bereits im Inneren das Messer?
Besaßen Sklaven heutzutage Waffen?, durchfuhr es mich, eine Frage, die ich mir bisher gar nicht gestellt hatte. Uns jedenfalls war das früher bei Todesstrafe verboten! Aber der Sklave des Jucundus hatte sich offenbar bis an die Zähne bewaffnet, um in die Schankwirtschaft zu gehen.
Ich drückte die Klinke herunter und zog an der Tür, doch sie gab nicht nach. Ich bückte mich, um durch das Schlüsselloch zu schauen, konnte aber niemanden in der Diele erkennen.
Was sollte ich jetzt tun? Die Tür gewaltsam öffnen? Wenn das einer meiner Kunden erführe, könnte ich den Weinhandel vergessen. Unschlüssig trat ich einen Schritt zurück und musterte nochmals das Haus: Neben dem Eingang stapelte sich frisch geschlagenes Holz und der Weg war gefegt.
»Jucundus ist nicht zu Hause!«
Die weibliche Stimme fuhr mich so heftig an, dass ich zusammenzuckte. Erschrocken wandte ich mich um und sah mich Aug in Aug mit einer bärbeißigen Matrone. Die Stirn in Falten gelegt und in der Hand einen Besen fixierte sie mich. »Ich habe ihn heute jedenfalls noch nicht gesehen.«
»Das gefällt mir aber gar nicht, denn ich wollte ihn etwas Wichtiges fragen«, begann ich vorsichtig, »vielleicht könnte auch sein Sklave mir weiterhelfen, aber ich sehe ihn nirgendwo.«
Ich beglückwünschte mich selbst zu dieser spontanen Formulierung, denn es gibt nichts Alberneres als sich nach einem Sklaven zu erkundigen.
»Die beiden sind gestern zusammen verschwunden und ich habe sie nicht zurückkommen sehen.« Die Matrone stützte sich mit beiden Händen auf ihren Besen auf und blickte mich genauso an, wie mein früherer Herr seine Sklaven angeblickt hatte, bevor er sie bestrafte. »Ich bin übrigens die Nachbarin.«
Ich bedankte mich hastig für die freundliche Auskunft, schwang mich auf meinen Braunen und machte mich schleunigst auf den Rückweg, denn ich verschwendete hier nur meine Zeit.
Ich überlegte, was ich jetzt tun sollte. Das Gut des Marcus Terentius lag außerhalb der Stadt, wenn auch glücklicherweise nicht allzu weit vom Hilfstruppenlager entfernt. Trotzdem entschied ich, dass es zu spät war, um meinen ehemaligen Patron zu besuchen, denn zu dieser Jahreszeit dämmert es sehr früh.
Am folgenden Morgen war ich wieder einigermaßen imstande meinen Kopf zu gebrauchen, aber ich wollte keinen Rückfall riskieren, indem ich mich mit Respectus oder Lucius herumstritt. Also verschwand ich einfach nach dem Frühstück.
Über Nacht war es frühlingshaft warm geworden, jedenfalls so frühlingshaft wie es in dieser rauen Gegend nur werden kann. Obstbäume blühten und Vögel sangen, als ich der schnurgeraden Straße folgte, die das Legionslager mit dem Militärlager der Hilfstruppen, beziehungsweise dem benachbarten Vicus Victoriae verband. Die liebliche Hügellandschaft zu beiden Seiten des Wegs wurde von Gutshöfen bewirtschaftet, die die Stadt mit Lebensmitteln versorgten.
Den rechten Straßenrand säumten Grabdenkmäler. Einige der Denkmäler waren von eindrucksvoller Monumentalität, darunter Pfeilergrabmäler mit Schuppendach und vollplastischen Darstellungen der Verstorbenen, die durch ihre farbige Bemalung geradezu erschreckend lebendig wirkten. Aber die meisten bestanden nur aus einem schlichten Grabstein. Trotzdem war dies eine ziemliche Verschwendung, wenn man bedachte, dass selbst ein einfacher Grabstein tausend Denare kostete, aber ein Legionär nur einen einzigen Denar am Tag verdiente. Mir war schon immer unverständlich gewesen, wie ein Mensch auf die Idee kommen konnte, freiwillig Soldat zu werden, aber angesichts dieser Zahlen erschien mir dies als völliger Wahnsinn.
Achtlos passierte ich das kleine Kultbild der Epona mit dem Relief der auf einem Maultier reitenden Göttin, das sich am Rande einer Koppel befand. Bauern hatten es mit Frühlingsblumen bekränzt. Früher hatte auch ich, wenn ich hier vorbeikam, Epona ein Trankopfer dargebracht. An diesem Tag hingegen fehlte mir dafür die Geduld. Außerdem lag mir weniger das Wohlergehen meines Pferdes am Herzen als das meines Bruders und des Handelskontors.
Nach einem Ritt von wenigen Meilen erreichte ich eine Stichstraße, der ich folgte, bis ich die Umfassungsmauer des Gutshofs von Marcus Terentius erreichte. Als ich noch auf dem Gut gelebt hatte, wurde man am Tor von einem Wächter kontrolliert, aber entweder wurde der Eingang inzwischen tagsüber nicht mehr bewacht oder der damit beauftragte Sklave hielt gerade Mittagsschlaf.
Jedenfalls ritt ich ungehindert durch das Portal, von dem aus eine schnurgerade Straße zum Herrenhaus führte. Mit seiner repräsentativen Fassade wäre es selbst in Italien als Villa rustica durchgegangen. Aber der äußere Anschein täuschte: Außer der Schaufront besaßen nur die Kellerräume des Landgutes steinerne Wände. Der Rest war aus Ziegeln gebaut, was aber der weiße Anstrich kaschierte. Bedauerlicherweise warf das Gut bei weitem nicht soviel ab, wie der Patron glaubte, seinem Status schuldig zu sein. Allein die Tatsache, dass er seinen Sklaven gestattete, sich freizukaufen, zeigte, dass Marcus Terentius nicht gerade im Geld schwamm. Trotzdem hätte ich auch gern ein derartiges Landgut mit Blick auf den Rhein besessen, auch wenn es mit Hypotheken belastet war.
Muhen, Blöken und Meckern übertönte die Vogelstimmen, als ich an den Stallungen vorbeikam. Der Wind blies mir einen beißenden Gestank ins Gesicht. Ein Misthaufen, durchfuhr es mich. Deren schiere Existenz hatte ich in der Stadt fast vergessen. Das Landleben war wirklich nichts für mich.
Ich überquerte einen Hof, der mehrere Scheunen miteinander verband, und ein Junge flüchtete vor mir. Er war ein bemitleidenswert dünnes Kerlchen von ungefähr sieben bis acht Jahren mit kurz geschorenem dunklem Haar. Hastig rannte er über den frisch gefegten Hof und kletterte eine Leiter hoch, die gegen einen Speicher gelehnt war. Wahrscheinlich durfte der Junge hier nicht spielen oder er hatte irgendetwas auf dem Hof stibitzt. Jedenfalls fühlte ich mich unangenehm an meine eigene Kindheit erinnert, die ich auf diesem Anwesen verbracht hatte.
Während ich mich so in meinen Gedanken verlor, erinnerte ich mich, dass Marcus Terentius schon damals ein vielbeschäftigter Mann war. Vielleicht hätte ich meinen Besuch vorher ankündigen sollen? Aber nun war es für derartige Überlegungen zu spät.
Als ich die Veranda erreichte, die dem Hauptgebäude vorgelagert war, warf ich einen neidischen Blick auf den schön angelegten Ziergarten mit seinem kreisrunden Wasserbecken, der sich rechts des Herrenhauses befand. Ich würde sehr viel Wein verkaufen müssen, um mir einen derartigen Garten leisten zu können.
Ein grobknochiger Knecht mittleren Alters schritt mir mit finsterer Miene entgegen. Ich teilte ihm mit, dass ich ein Freigelassener seines Herrn war und das schien ihm zu gefallen. Er rang sich sogar ein Lächeln ab. Wahrscheinlich ließ mein Anblick ihn hoffen, dass auch er es noch zu etwas bringen könnte. Ich überließ dem Knecht meinen Braunen und stieg die Stufen zur Veranda hinauf. Obwohl ich sicher war, dass man mich bereits aus dem Inneren des Hauses beobachtete, wurde die Tür nicht geöffnet. Trotzig zog ich also an dem Strick, der an der Messingglocke befestigt war.
Die Angeln der Haustür quietschten als die Haustür aufgezogen wurde. Beim Anblick des Pförtners, den ich schon seit meiner Kindheit kannte, erschrak ich. Wie alt er geworden war! Sein Körper war ausgemergelt, das Gesicht von zahllosen Falten durchzogen und das kurz geschorene Haar schütter und grau. Er hieß Lydus, beziehungsweise hatte Marcus Terentius ihn so genannt, weil er aus Lydien kam und die Herren sich meist nicht die Mühe machten, sich die Namen ausländischer Dienstboten zu merken.
»Ich möchte mit Marcus Terentius sprechen«, erklärte ich und schilderte dem Pförtner dann, worum es sich handelte.
Ich hatte Glück und Lydus bestätigte, dass sein Herr zu Hause war. Er winkte einen etwa zwanzigjährigen Sklaven herbei. Aus seinem roten Haar und seinen Sommersprossen schloss ich, dass er Gallier war.
»Ich werde nachfragen, ob der Herr für dich Zeit hat«, erklärte der Haussklave geflissentlich.
Durch die offene Tür drang der Geruch von gedünsteten Forellen ins Freie und lenkte mich für einen Augenblick ab. In der Küche, in der Tag und Nacht gewaltige Mengen von Speisen für den großen Haushalt zubereitet wurden, kochte man also bereits das Mittagessen. Dieses war zwar nach altrömischer Sitte weit weniger üppig als die abendliche Cena, aber trotzdem begann mein Magen laut vernehmbar zu knurren.
Während ich auf den Haussklaven wartete, musterte ich den Pförtner aus den Augenwinkeln. Ich zählte an den Fingern ab, wie lang ich ihn schon kannte: Es waren vierundzwanzig lange Jahre, die sicherlich auch an mir nicht spurlos vorbeigegangen waren.
Glücklicherweise ließ der Haussklave mich nicht lang warten.
»Der Herr geruht dich zu empfangen«, erklärte er in einem pompösen Tonfall, der in drolligem Gegensatz zu seinem holprigen Latein stand und ich fragte mich, ob er wusste, dass ich ein Freigelassener seines Herrn war.
Wahrscheinlich nicht, hätte er mich doch dann sicherlich weniger höflich behandelt.
Majestätischen Schrittes führte er mich in den zentralen Innenhof des Hauses. Dabei durchquerten wir Zimmer mit prächtigen Wandgemälden, die vor einem roten Hintergrund kleine Bilder mit mythologischen Szenen in idyllischen Landschaften zeigten. Farbige Mosaiken mit geometrischen Mustern und täuschend echt wiedergegebenen Meerestieren überzogen die Fußböden der meisten Räume. Auch die Möbel waren aus kostbaren Materialien wie farbigem Marmor und afrikanischem Ebenholz gefertigt. Ihre zierlichen Dekorationen zeugten von Reichtum und gutem Geschmack ihres Besitzers. Auf den Tischen standen Steinpokale, sowie Gefäße aus geschliffenem Glas, schimmerndem Silber und glänzendem Gold.
Wohlriechende Düfte lagen in der Luft und aus den Heizungsschächten unter dem Fußboden strömte wohlige Wärme. Mir wurde schmerzlich bewusst, dass ich in unserem Hause die Heizung bereits seit einem Monat hatte abschalten lassen. Neidlos musste ich zugeben, dass dieses Herrenhaus unser eigenes Wohnhaus an Pracht in demselben Ausmaß übertraf wie der Kaiserpalast das Quartier des hiesigen Lagerkommandanten. Dieser Luxus war mir früher gar nicht aufgefallen, aber ich hatte damals auch mehr Zeit in den Weinbergen verbracht als im Haus meines Herrn.
Marcus Terentius erwartete mich im Atrium auf einem Klappstuhl mit Elfenbeinfüßen sitzend. Das Möbelstück erinnerte mich an die Amtsstühle der höheren Beamten. Vor ihm plätscherte ein Brunnen mit einer Schale aus weißem Marmor, der eine bronzene Fischfigur als Wasserspeier besaß. Er war so kunstvoll gearbeitet, dass es sich nur um ein Importstück aus Italien handeln konnte.
Mein Patron war mittelgroß und sein Gesicht war wettergegerbt und kantig. Sein schwarzes Haar zeigte an den Schläfen das erste Grau, aber ich habe immer vermutet, dass er älter aussah, als er tatsächlich war. Die Falten seiner Toga waren tadellos gelegt. Ich fragte mich, ob er sich in seinem Landhaus tatsächlich an einem gewöhnlichen Werktag so aufwändig kleidete oder ob er sich meinetwegen so in Schale geworfen hatte. Für letzteres sprach, dass er mich solange hatte warten lassen. Trotz des recht milden Wetters hatte er sich im Atrium ein Kohlenbecken aufstellen lassen.
Ich begrüßte ihn mit der Zuvorkommenheit, die ihm als meinem Patron zustand.
»Schön dich zu sehen«, erwiderte er, »Wie geht es deiner Frau? Leider habe ich ihren Namen vergessen.«
»Ich bin nicht verheiratet«, erklärte ich verärgert und fragte mich, mit wem mein Patron mich wohl verwechselte.
»Sei froh«, kommentierte er knapp.
Ich hätte mich im Gegenzug zu gern nach seiner Gemahlin erkundigt, aber diese Frage hätte Marcus Terentius sicher als impertinent empfunden.
»In der letzten Zeit geschehen schreckliche Dinge«, bemerkte er, nachdem wir einige Höflichkeitsfloskeln ausgetauscht und uns kurz über Weinbau und Landwirtschaft unterhalten hatten. »Zuerst wird Jucundus erstochen und jetzt ist auch noch sein Sklave ins Wasser gegangen. So etwas gab es früher nicht!«
Diese Worte schockierten mich derart, dass ich mich auf den Brunnenrand setzen musste. Leider stand im Atrium kein weiterer Stuhl.
»Sein Sklave ist ins Wasser gegangen?«, fragte ich fassungslos zurück, weil ich mir nicht sicher war, ob ich mich nicht verhört hatte. »Was soll das heißen?«
»Er hat sich im Main ertränkt«, antwortete Marcus Terentius in einem sachlichen Tonfall, doch man sah ihm an, dass auch ihn erschütterte, was geschehen war. In all den Jahren, die ich ihn kannte, hatte ich es noch niemals erlebt, dass er so nahe davor stand, seine Selbstbeherrschung zu verlieren.
»Wann?«, wollte ich wissen.
Mein Patron stand langsam auf, ging zum Brunnen und schaute mit dem Rücken zu mir in die Wasserfontäne, wahrscheinlich um mir nicht in die Augen blicken zu müssen.
Dann begann er mit leiser, aber ruhiger Stimme zu sprechen: »Seine Leiche ist heute Morgen am Ufer angespült worden. Man hatte ihn seit dem Tod des Jucundus vermisst und alle hatten daher gedacht, er wäre geflohen.«
Ich war erstaunt, wie schnell sich die Neuigkeit vom Ableben eines Sklaven verbreitet hatte, aber ich wagte es nicht, Marcus Terentius nach seinen Informationsquellen zu fragen. Schließlich war er mein Patron und ich musste ihm respektvoll begegnen.
»Hast du eine Ahnung, warum er das getan hat?«, fragte ich stattdessen, obwohl ich die Antwort schon zu kennen glaubte: Nämlich, dass er damit seiner Strafe entgehen wollte. Vielleicht hatte ihn auch die Reue wegen seiner schrecklichen Tat gepackt.
»Cornelia, die Braut von Jucundus berichtet, der Sklave …«
»Er wird doch sicher einen Namen haben«, unterbrach ich, denn ich fühlte mich unangenehm an meine eigene Vergangenheit erinnert, als man mich nur »den Kellermeister« gerufen hatte.
»Sicher doch, er hieß Caius«, erwiderte Marcus Terentius scharf und drehte sich zu mir um. Seine indignierte Miene zeigte, dass ich mich seiner Meinung nach im Tonfall vergriffen hatte. »Dieser Caius ist gestern plötzlich hier aufgetaucht und hat Cornelia erklärt, dass Jucundus von Räubern erschlagen worden sei. Er hat sie gefragt, ob sie nicht ihn stattdessen heiraten möchte. Natürlich hat Cornelia ihn abgewiesen. Sie sitzt noch immer in ihrer Kammer und weint. Sie hat später berichtet, der Sklave – ich meinte Caius – habe einen völlig aufgewühlten Eindruck gemacht. Aber natürlich hat niemand vermutet, dass er sich umbringen würde.«
Einige Sekunden lang herrschte Schweigen. Dann berichtete ich Marcus Terentius alles, was ich selbst über die schrecklichen Ereignisse wusste, wobei ich aber unterschlug, dass mein Bruder mit von der Partie war. Trotzdem ging ich davon aus, dass mein Patron sich seinen Teil dachte, denn Lucius war ihm schließlich aus früheren Tagen als Taugenichts bekannt. »Das wird sich sicher alles regeln lassen«, meinte Marcus Terentius optimistisch und dies hörte ich natürlich gern, denn schließlich war mein Patron für seine Freigelassenen verantwortlich.
Ein dicklicher Sklave schleppte im gleichen Augenblick einen kleinen Tisch und einen Stuhl herbei. Es wurde auch höchste Zeit! Ich hatte mich schon gefragt, ob man in dieser Villa die Gäste kaltblütig verhungern ließ. Ich machte es mir also gemütlich und hoffte, dass der Tisch nicht nur als Dekoration aufgestellt worden war. Ich wurde nicht enttäuscht. Der Sklave kehrte mit einer Platte voll kalten Geflügels zurück, das man für unangemeldete Gäste zubereitet hatte. Ich ließ mich nicht zweimal bitten und langte kräftig zu. Was für meinen ehemaligen Patron als kleiner Imbiss durchgehen mochte, wäre bei uns eine veritable Hauptmahlzeit gewesen. Trotzdem fand ich es nett, dass er mich wie seinesgleichen bewirtete, obwohl ich nur einer seiner Freigelassenen war.
Als ich alles, was man mir serviert hatte, in mich hineingestopft hatte, redeten wir wieder über Jucundus.
»Die Verbrennungszeremonie wird Morgen stattfinden«, erklärte Marcus Terentius. »Ich nehme an, du willst Jucundus die letzte Ehre erweisen?«
»Selbstverständlich«, behauptete ich, obwohl mir nicht ganz wohl bei dieser Vorstellung war, denn ich würde Lucius mitnehmen müssen. »Wann findet die Feier statt, ich nehme an am Morgen?«
»Ja, komm zur elften Stunde zu unserem Familiengrab! Aber vorher sollten wir uns noch darüber unterhalten, was ich den Behörden über die Todesfälle in meiner Klientel mitteilen soll.«
Wir einigten uns schließlich darauf, dass es für alle Beteiligten das beste war, wenn Marcus Terentius behaupten würde, Caius habe vor seinem Selbstmord gestanden, den Viehhirten erstochen zu haben. Schließlich machte es Jucundus auch nicht wieder lebendig, wenn der Legat davon Wind bekam, dass mein Bruder mit einem blutigen Messer in der Hand neben seiner Leiche aufgewacht war.
So wurde mein Bruder von jedem Verdacht reingewaschen. Trotzdem fragte ich mich auf dem Rückweg voller Grimm, ob er es nicht doch war, der Jucundus erstochen hatte, zumal er selbst ein Auge auf die schöne Cornelia geworfen hatte.