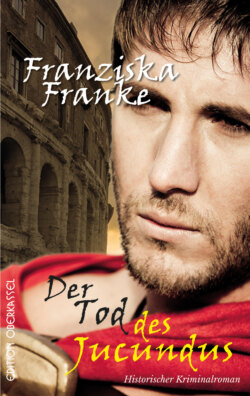Читать книгу Der Tod des Jucundus - Franziska Franke - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2. Der Tag nach dem Fest
ОглавлениеAm nächsten Tag wurde ich kurz nach dem Morgengrauen unsanft aus dem Schlaf gerissen, denn es trommelte jemand an die Tür meines Gemachs. Mein Kopf fühlte sich an, als würde er gleich in tausende Stücke zerspringen und ich fragte mich, warum man mich nicht schlafen ließ.
Ich rief nicht »Herein«, sondern drehte mich verärgert mit dem Gesicht gegen die Wand und drückte mir das Kissen auf die Ohren.
Trotzdem wurde kurze Zeit später die Zimmertür lautstark aufgerissen. Ich rollte mich wutentbrannt zurück und sah das blasse, übernächtigte Gesicht meines Bruders durch den Türrahmen lugen. Schon wollte ich ihn mit einem Fluch zum Orcus schicken, als ich zu meinem namenlosen Schrecken bemerkte, dass sein Gewand mit Blutflecken besudelt war. Auch sonst sah er mit dunkel umschatteten Augen und kreidebleichem Gesicht schrecklich aus. Seine Locken waren mit Lehm verschmiert und seine Kleidung klebte ihm am Körper.
Trotz meiner Müdigkeit begriff ich, dass etwas Schreckliches vorgefallen sein musste.
»Was um der Götter Willen ist passiert?«, fuhr ich ihn an.
»Jucundus ist tot«, stammelte Lucius leise, während ich mir die brennenden Augen rieb und gähnte. »Ich bin vorhin am Rheinufer aufgewacht. Jucundus hat neben mir gelegen. Seine Augen waren ganz glasig und er hatte eine Wunde in der Brust. …. ich weiß wirklich nicht, wie ich dorthin gekommen bin …« Meinem Bruder versagte für einen Augenblick die Stimme. Dann holte er tief Luft, schluckte und platzte dann los: »Und in der Hand hielt ich ein blutiges Messer.«
Ich schloss die Augen wieder um tief durchzuatmen. Dann massierte ich mir mit den Fingerspitzen die Schläfen. Noch immer quälte mich ein rasender Kopfschmerz. Also brauchte ich einen Moment, bis ich die volle Tragweite der Worte begriffen hatte. Mein ehemaliger Mitsklave, den ich schon seit meiner Kindheit kannte und mit dem ich erst vor wenigen Stunden in einer üblen Absteige gezecht hatte, war tot. Und als ob das noch nicht schlimm genug wäre: Mein Bruder hatte irgendetwas damit zu tun.
»Hast du ihn umgebracht?«, entfuhr es mir in hilfloser Wut.
»Nein«, rief mein Bruder empört aus. »Wie kannst du das nur denken! Aber ich habe leider keine Ahnung, wer es war!«
Jucundus ist tot, murmelte ich, aber mein benebeltes Hirn konnte noch immer den Sinn dieser Worte nicht fassen.
»Und was hast du mit dem Messer gemacht?«, wollte ich dann wissen. Noch immer hatte ich das Gefühl, die Zeit sei stehen geblieben. Eine Welle der Übelkeit stieg unvermittelt in mir hoch.
»Das habe ich natürlich in den Rhein geworfen.«
So natürlich fand ich das nicht, aber mein Bruder hatte sicherlich das Richtige getan, sich der Mordwaffe zu entledigen. Ich verkniff mir also einen boshaften Kommentar und forderte Lucius auf, mir alles so genau wie möglich zu erzählen. Aber mein Bruder erinnerte sich an gar nichts, außer daran dass er am Vorabend einen über den Durst getrunken hatte und dann am Rheinufer neben der Leiche des Jucundus aufgewacht war.
Tief in meinem Inneren fragte eine nagende Stimme, ob er den Viehhirten nicht doch im Suff erstochen hatte. Jucundus konnte eine ziemliche Nervensäge sein, aber eine derartige Gewalttat passte nicht zu meinem faulen Bruder.
»Hat dich jemand am Rhein gesehen?«, erkundigte ich mich bei Lucius, nachdem ich meine Gedanken wieder etwas geordnet hatte.
»Nur eine Frau. Sie hat mich mit ihren schrillen Schreien aufgeweckt. Als ich die Augen geöffnet habe, hat sie mich angestarrt. Dann ist sie davongerannt und ich habe mich ebenfalls aufgerappelt, bevor sie mit einem Beamten wiederkommen konnte.«
»Kanntest du sie?«, fragte ich meinen Bruder schlecht gelaunt, denn es gefiel mir gar nicht, dass es eine Zeugin gab. Warum musste mir Lucius immer soviel Ärger machen?
»Nein«, antwortete er, »aber so stark, wie sie geschminkt war, wird es sich um eine Prostituierte gehandelt haben.«
»Na großartig! Bald weiß es jeder einzelne Soldat beider Legionen!«
Lucius schwieg, während ich mir so gut es mein Kopfschmerz zuließ über die Schadensbegrenzung Gedanken machte. Mein Bruder konnte nur ungeschoren davonkommen, wenn wir die Sache vertuschten. Noch besser wäre es, den Mörder zu finden und diese undankbare Aufgabe blieb wieder einmal an mir hängen. Denn so verstört wie mein Bruder aussah, würde man ihn sofort der Tat verdächtigen.
»Also, du verlässt auf keinen Fall das Haus, bis ich wiederkomme!«, forderte ich ihn schließlich auf. »Im Handelskontor werde ich sagen, dass du krank bist, irgendetwas Ansteckendes.«
»Das ist noch nicht einmal eine Lüge«, kommentierte Lucius ziemlich kleinlaut. »Ich fühle mich wirklich fürchterlich.«
Ich verkniff mir mühsam den Kommentar, dass er sich nicht so anstellen solle, da er nur unter einem ganz gewöhnlichen Kater litt.
»Was hast du jetzt vor?«
Seine Stimme klang wirklich kläglich. Er war noch immer kreidebleich und zitterte am ganzen Leib.
»Lass dich überraschen!« Mein Blick blieb an den Blutflecken auf seiner Kleidung haften. »Und bring dich gefälligst in der Zwischenzeit in einen präsentablen Zustand! Vor allem verbrenne diese blutverschmierte Tunika. Ich hoffe, du hast noch eine andere, die ähnlich aussieht?«
Ohne einen Kommentar meines Bruders abzuwarten, der momentan sowieso keinen besonders gesprächigen Eindruck erweckte, schlüpfte ich widerwillig aus meinem schönen warmen Bett, streifte mir eine dünne Tunika über und holte eine etwas dickere, frisch gewaschene aus der Kleidertruhe.
Ich öffnete das Fenster und sog die kalte Morgenluft ein. In der Ferne zeigte sich das erste fahle Licht, doch die Häuser der Straße waren noch von der Dunkelheit umhüllt.
Durch das offene Fenster drangen die unterschiedlichten Geräusche: Vogelgesang mischte sich mit dem Poltern von beschlagenen Rädern und dem Kindergeschrei aus dem Haus gegenüber, wo eine Großfamilie wohnte, die offenbar niemals schlief.
Trotz dieses Krachs versuchte ich so leise wie möglich in die Küche zu huschen, um die Dienstboten nicht aufzuwecken.
Unser Haushalt wurde von zwei Sklaven geführt, die mir ein Kunde überlassen hatte, weil er ganz plötzlich die Stadt hatte verlassen müssen. Ich hatte die beiden, die ich dringend für unser damals neu erworbenes Haus benötigte, zu einem äußerst günstigen Preis erworben und ihn im Gegenzug nicht mit Fragen behelligt.
Obwohl ich nun ihr Herr war, konnte ich mich des Verdachtes nicht erwehren, dass die beiden uns nicht recht ernst nahmen, was ich im Fall meines Bruders auch nachvollziehen konnte. Er war alles andere als eine Respektsperson. Seltsamerweise schien ihn dies nicht zu bekümmern. Doch ich für meinen Teil hätte mir eine andere Behandlung seitens meiner Dienerschaft gewünscht. Vielleicht war ich aber auch etwas zu empfindlich, da ich früher selbst Sklave gewesen war.
Als ich auf Zehenspitzen durch mein eigenes Haus schlich, kam ich mir vor wie ein Verbrecher, aber je weniger Menschen von der Sache erfuhren umso besser. Ich spritzte mir etwas Wasser ins Gesicht, schlang hastig ein Stück trockenes Brot herunter und trank einen Becher stark verdünnten Wein. Dann verließ ich das Haus. Zwar war mir der Weinhandel momentan herzlich gleichgültig, aber ich musste mich im Kontor blicken lassen, um nicht den Argwohn meines Teilhabers zu erregen.
Innerlich aufgewühlt eilte ich durch die Stadt. Was um Jupiters Willen war in der vergangenen Nacht passiert? Besser nicht zuviel darüber nachdenken, ermahnte ich mich selbst.
Nach und nach erwachte die Stadt zum Leben. Fensterläden wurden geräuschvoll aufgeschlagen, die Türen von Werkstätten geöffnet. Die Händler bauten Lebensmittel auf ihren Ständen auf, welche die Gassen und Plätze verstellten. Sklaven und Matronen mit quengelnden Kindern an der Hand kamen aus den Wohnhäusern und Lieferanten überquerten die Straße.
Ich legte keinen Wert darauf, einem Bekannten über den Weg zu laufen, denn ich war nicht in der Verfassung, um über Alltäglichkeiten zu plaudern. Also machte ich einen großen Bogen um das Forum. Trotz dieses Umwegs hatte ich bald die rußgeschwärzten Öfen von Töpfern und die Schusterwerkstätten, aus denen lautes Hämmern drang, hinter mir gelassen und das Hafenviertel erreicht. Ich ärgerte mich darüber, Respectus am Vortag nicht angetroffen zu haben. Dann wäre es mir an diesem Morgen erspart geblieben, ihm von meiner Geschäftsreise berichten zu müssen. Davor hatte ich nämlich in meinem desolaten Zustand einen wahren Graus, zumal mein Teilhaber, um es höflich auszudrücken, ausgesprochen gründlich war. Nach Meinung meines Bruders war er ein schrecklicher Pedant.
Der einfache Bau aus verputztem Fachwerk, in dem sich unser Handelskontor befand, wirkte geradezu repräsentativ im Vergleich zu den benachbarten Holzschuppen, von denen die meisten niedriger und schmaler, wenn auch sehr viel länger waren.
Trotz der noch immer recht frühen Stunde war das Portal diesmal nicht abgeschlossen. Als ich beim Durchschreiten unseres Lagerraums einen Seitenblick auf die Amphoren und Fässer warf, die sich zu beiden Seiten des mittleren Durchgangs stapelten, drohte ich völlig im Trübsinn zu versinken. Wer weiß, ob wir nicht bald die Stadt unter Zurücklassung unserer Ware verlassen mussten?
Ohne große Begeisterung ging ich ins Arbeitszimmer meines Partners, traf ihn jedoch dort nicht an. Aber die Papyrusrollen und wachsbeschichteten Schreibtäfelchen, die sich am Vortag auf seinem Tisch gestapelt hatten, waren weggeräumt worden, ein untrügliches Zeichen dafür, dass Respectus im Kontor war.
Also trottete ich auf den Nachbarraum zu, in dem mein eigener Schreibtisch stand. Noch ehe ich die Tür öffnete, wusste ich, was mich dahinter erwartete. Denn durch den Türspalt drang das unangenehm strenge Parfum, das Respectus benützte. Dies war die einzige Eitelkeit, bei der ich ihn jemals ertappt hatte. Aber ich fand, er hätte auch diese ablegen können, vor allem wenn er sich in unseren gemeinsamen Räumen aufhielt.
Verärgert fragte ich mich, was er in meinem Arbeitsraum verloren hatte. Ganz vorsichtig drückte ich die Türklinke herunter und riss dann die Tür mit einem kräftigen Ruck auf.
Mein Teilhaber, der an meinem Schreibtisch über einigen Dokumenten gebeugt saß, schrak zusammen und ich hätte zu gern gewusst, wobei ich ihn überrascht hatte. Wie immer trug er seinen karierten Kapuzenumhang, mit dem kein Römer auch nur einen Schritt vor die Tür setzen würde. Zu seinen Gunsten sei aber erwähnt, dass er kein Römer war, sondern ein rothaariger keltischer Händler aus dem Stamme der Treverer, dessen Familie schon vor der Ankunft der Legionen an der Mainmündung gelebt hatte.
Ich hätte mir keinen besseren Teilhaber wünschen können, da er wie besessen arbeitete. Mit seinem Fleiß schüchterte er meinen Bruder Lucius geradezu ein. Das mochte aber nicht viel heißen, denn mein jüngerer Bruder hatte die Arbeit nicht erfunden. Nur aus Familiensinn ließ ich ihn in unserer Firma arbeiten, obwohl wir sicher einen besseren Angestellten in jeder Schankwirtschaft gefunden hätten.
»Schön, dass du wieder da bist. Wie ist deine Reise verlaufen?«, stammelte Respectus mit bleichem Gesicht und schaute griesgrämig zu mir hoch.
Offenbar passte es ihm nicht in den Kram, dass ich so früh am Morgen im Handelskontor aufgetaucht war. Mir wurde plötzlich bewusst, dass ich ihm ohne weiteres zutraute, mich zu betrügen. Verstimmt nahm ich mir vor, ihn demnächst zur Rede zu stellen, aber an diesem Morgen hatte ich leider andere Probleme. Ich konnte mich aber nicht beherrschen, meinen Teilhaber zu fragen, warum er nicht in seinem eigenen Raum arbeitete.
»Ich habe mich nur ganz kurz in dein Zimmer gesetzt, weil es hier heller und wärmer ist. Du kommst ja sonst nicht so früh in deine Schreibstube«, behauptete er, aber ich konnte beim besten Willen nicht finden, dass mein Raum tatsächlich deutlich sonniger war, zumindest nicht in den Morgenstunden.
Mit der rechten Hand fuhr Respectus gedankenverloren über das Eichenholz meines Schreibtisches, an dem er immer noch saß und von dem er sich offenbar nur schwer losreißen konnte.
»Warst du erfolgreich an der Mosel?«, fragte er schließlich in dem teilnahmslosen Tonfall in dem man sich anstandshalber nach dem Befinden seiner Bekannten erkundigt.
Um nicht länger in der Tür herumstehen zu müssen, schob ich einen Stuhl aus einer Ecke auf die andere Seite des Tisches, denn noch immer machte mein Teilhaber keine Anstalten meinen Arbeitsplatz zu räumen. Während ich mit knappen Worten von meiner Handelsmission berichtete, versuchte ich einen Blick auf die Dokumente auf dem Schreibtisch zu werfen, aber Respectus bedeckte das oberste mit seiner Hand.
»Wo steckt eigentlich dein Bruder Lucius?«, erkundigte er sich, als ich geendet hatte. Damit kam er meiner Frage nach den Akten zuvor, die er offensichtlich vor mir zu verbergen suchte.
»Er ist krank und irgendwer muss die Arbeit doch schließlich erledigen«, erklärte ich in einem möglichst beiläufigen Tonfall, »deshalb bin ich heute auch etwas früher als sonst gekommen.«
»Was fehlt ihm denn?«, wollte Respectus wissen, aber es war offensichtlich, dass er in Gedanken woanders war.
»Er hat über Nacht hohes Fieber bekommen und kann keine Nahrung bei sich behalten. Außerdem ist seine Haut von roten Flecken übersät.« Ich sagte mir, dass ich nicht übertreiben durfte und ließ es bei diesen Symptomen bewenden. »Die Tochter des Nachbarn hat die gleiche Krankheit«, fügte ich aber mit einem Anflug von Bosheit hinzu. »Mein Bruder hat sich bestimmt bei ihr angesteckt.«
»Das ist ja schrecklich«, stammelte mein Teilhaber und verdrückte sich schleunigst aus meinem Raum, wobei er aber leider so schnell seine Dokumente zusammenraffte, dass ich sie wieder nicht einsehen konnte.
Mit dem muss ich noch ein Hühnchen rupfen, sobald diese Sache überstanden ist, dachte ich und eine Welle der Übelkeit überkam mich, als ich vor meinem inneren Auge meinen Bruder mit blutverschmierter Tunika sah. Dieses schreckliche Bild ließ sich nicht aus meinem Gedächtnis verbannen. Noch immer hatte ich Kopfschmerzen und das konnte nur an dem miserablen Wein aus dieser Spelunke liegen, denn normalerweise werfen mich vier Becher Rebensaft nicht gleich völlig aus der Bahn.
Ich erledigte nur die allerdringendsten Arbeiten, denn ich konnte mich nur mit Mühe auf den Weinhandel konzentrieren. Die Zeit verfloss mit quälender Langsamkeit, aber wenigstens ließ mich Respectus in Ruhe.
Als am späten Vormittag eine realistische Chance bestand, dass die Tavernen geöffnet sein könnten, verabschiedete ich mich unter dem Vorwand, eine dringende Besorgung erledigen zu müssen.
»Willst du nicht lieber nach Hause gehen?«, rief mir mein Teilhaber nach. »Du siehst gar nicht gut aus. Bestimmt hast du dich bei Lucius angesteckt!«
Offenbar war meine Bemerkung über die in unserer Familie grassierende Seuche auf fruchtbaren Boden gefallen. Darauf hatte ich auch gebaut, denn mein Geschäftspartnet war schon immer ein ziemlicher Hypochonder gewesen.
»Ich werde es mir überlegen, denn mir geht es wirklich nicht besonders gut.«
Ich drückte mich absichtlich etwas vage aus, weil ich den Verdacht hatte, dass Respectus mich loswerden wollte, um ungehindert seinen obskuren Geschäften nachgehen zu können.
»Keine Sorge, ich schaffe es auch allein.«
Diese Hürde war also genommen! Unterwegs suchte ich nach einem geeigneten Vorwand, um den Wirt ausfragen zu können. Schließlich fiel mir nichts Besseres ein, als zu behaupten, ich habe einen wertvollen Ring in seiner Schenke verloren. Ich legte mir eine kleine Geschichte zurecht und erhoffte zugleich, dass der Wirt sie schlucken möge.