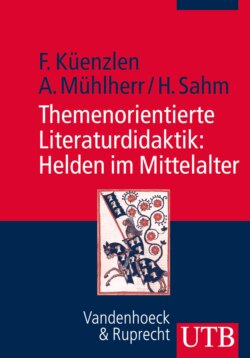Читать книгу Themenorientierte Literaturdidaktik: Helden im Mittelalter - Franziska Küenzlen - Страница 7
Оглавление1. Gegenstand – Zielrichtung – Verwendbarkeit
Die themenorientierte Literaturdidaktik verknüpft die in Curricula und Bildungsstandards kompetenzorientiert festgelegten und damit funktional ausgerichteten Ziele des Literaturunterrichts mit den Inhalten literarischer Werke. Ins Blickfeld rücken dabei insbesondere Themen und Motive, die in der europäisch-abendländischen Kultur zu verschiedenen Zeiten auf vielfältige Weise literarisch aktualisiert und bearbeitet worden sind. Damit werden für den Literaturunterricht wesentliche Grundlagen kultureller Bildung erschlossen, die zum interkulturellen Lernen befähigen.
1.1 Themenschwerpunkt
Der Band nimmt das Thema ‚Helden‘ in den Blick und konzentriert sich dabei aus zwei Gründen auf die mittelalterliche deutschsprachige Literatur:
Erstens sind mittelalterliche Helden kulturhistorisch gesehen Kristallisationsfiguren, deren Ausprägungen sich zu noch älteren Typen zurückverfolgen lassen und die auch das Grundinventar heutiger Heldenkonzeptionen bereithalten. Denn in dieser Zeit erfolgt, was die Helden angeht, eine intensive ‚Arbeit am Archaischen‘; es handelt sich um Reformulierungen sowie Umakzentuierungen, die noch die heutigen Vorstellungen entscheidend prägen. Wenn man wissen will, was Helden als Gestalten des Imaginären auch und gerade in der heutigen Zeit zu leisten vermögen, lohnt die Beschäftigung mit mittelalterlicher Literatur in sehr hohem Maße. Es gibt keinen besseren Weg zur Schulung einer differenzierten und differenzierenden Wahrnehmung von Spielarten und Implikationen des Heldenstatus bestimmter Figuren. In langzeitlicher Perspektive zeichnen sich Verbindungen von mittelalterlichen Erzählungen zu moderner Literatur und zum modernen Kino sehr deutlich ab.
Zweitens spielt bei der Entscheidung gerade für mittelalterliche Helden die Faszination dieser Epoche eine Rolle, die gegenwärtig nicht nur auf Schüler und Schülerinnen, sondern auch auf weite Teile der Bevölkerung eine große Anziehungskraft ausübt. Dies lässt sich unter anderem an der Begeisterung für Fantasy-Literatur und PC-Spielwelten mit ‚mittelalterlichem‘ Setting oder an den hohen Teilnehmerzahlen bei Mittelalter-Festivals ablesen.1 Solche Art Anverwandlungen des Mittelalters in Form von re-enactment und histotainment können aber durchaus hinterfragt werden.2 Die Behandlung ‚echter‘ deutschsprachiger Literatur des Mittelalters im Schulunterricht wird damit zum einen bei vielen Schülerinnen und Schülern auf ein grundsätzliches Interesse stoßen, zum anderen bietet sie ihnen die Chance, in der Auseinandersetzung mit den Originalen zu eigenen Erkenntnissen zu gelangen, die gängige Mittelalterklischees hinter sich lassen.
Unser Band macht daher Vorschläge, wie das Potenzial der ‚mittelalterlichen Helden‘ für den Schulunterricht genutzt werden kann. Dabei wollen wir keine voreilige Identifizierung mit Helden erzielen, sondern anhand von Texten, die zugleich uralt und aktuell, fremd und nah sind, ein Bewusstsein für die semantische Breite des Heldenbegriffs schaffen und das sich daraus ergebende Spannungsfeld didaktisch fruchtbar machen. Den einen Extrempol im Spektrum des Heldenbegriffs nimmt der außerordentliche, einzigartige, übermenschliche Heros ein. Seine grundsätzliche Andersartigkeit, sein unbekümmertes, bisweilen ungebremst aggressives und asoziales Verhalten machen ihn bei aller Bewunderung, die ihm entgegengebracht wird, gleichzeitig auch zum einsamen Außenseiter. Am anderen Ende des Spektrums steht der moderne, gezähmte und zum gesellschaftlichen Vorbild gewordene Held des Alltags. Er hat nichts Einzigartiges an sich, sondern ist gerade dadurch bestimmt, dass er ein Mensch ‚wie du und ich‘ ist und seinen Platz in der Gesellschaft einnimmt, im entscheidenden Moment aber das Richtige, d.h. das gesellschaftlich Wünschenswerte, tut.
Die Auseinandersetzung mit den von uns gewählten sechs Helden vor dem Hintergrund dieses breiten Spektrums des Heldenbegriffs ist ein didaktisch gewinnbringender Schwerpunkt, da zur Beschreibung des jeweiligen Helden und seiner Einordnung in das Spektrum auch die Bewertung seines Verhaltens tritt. Damit ist die Möglichkeit zu einer kontinuierlichen Anhebung des Aufgabenniveaus bis in den höchsten Anforderungsbereich gegeben. Dass es sich bei den Helden dieses Bandes um Figuren der mittelalterlichen Literatur handelt, macht einen reizvollen Kontrast zu den üblichen Schwerpunktsetzungen im Deutschunterricht aus, der ebenfalls im Sinne der Progression in einer Unterrichtsreihe didaktisch nutzbar gemacht werden kann: Der Perspektivwechsel, der bei der Lektüre literarischer Texte von den Lesern grundsätzlich geleistet werden muss, ist auch bei den von uns gewählten Texten über weite Strecken intuitiv möglich. Die Schülerinnen und Schüler bringen nämlich in der Regel Erfahrungen aus der Lektüre von Abenteuer- und Fantasy-Romanen mit, deren Erzählanlage und motivisches Inventar eine große Schnittmenge mit unseren Texten aufweisen. Erweitert man aber die Unterrichtsreihe um Informationen zum Literaturbetrieb im Mittelalter oder zum historischen Kontext der einzelnen Werke, gewinnt der mittelalterliche Text an Fremdheit. Das Fremdverstehen wird um seine kontextuelle Dimension verfeinert und erfordert auf diese Weise eine differenziertere Bewertung der erzählten Heldentaten in Absetzung von der eigenen, auf der Grundlage moderner Lebenszusammenhänge und individueller Erfahrungen gewonnenen Position.
1.2 Zielpublikum: An wen richtet sich dieser Band?
Literaturwissenschaftliche Fachliteratur liefert Sachanalysen, welche die Grundlage sinnvoller didaktischer Schwerpunktsetzungen sind, bietet aber in der Regel keine Reflexion hinsichtlich einer didaktischen Verwertbarkeit an Schule und Hochschule. Literaturdidaktische Fachliteratur nimmt die verschiedenen Probleme der Vermittlung von Literatur in den Blick, ist aber selten auf deren eigentliche Inhalte konzentriert. Fertige Unterrichtsentwürfe sind das Produkt einer von einer bestimmten Person unter bestimmten Umständen vorgenommenen didaktischen Reduktion und methodischen Umsetzung. Der Prozess, der zu diesem Ergebnis führt, ist aber meist nur ansatzweise oder verkürzt dokumentiert. Unterrichtshilfen dieses Typs sind daher für Berufsanfänger mit wenig Erfahrung in der systematischen Planung von Unterricht (Studierende, Referendare) wenig hilfreich und verführen zu einer unreflektierten Nachahmung sowie zur Übernahme nicht selbst angeeigneter Unterrichtsinhalte und nicht authentisch vertretener Unterrichtsstile. Themenorientierte Literaturdidaktik setzt bei dieser Situation an: Sie will aktuelle und literaturwissenschaftliche Themenschwerpunkte fachwissenschaftlich fundiert, aber mit einem spezifisch literaturdidaktischen Blick vorstellen, der auch Ausblicke auf eine konkrete Umsetzung im Unterricht einschließt. Die didaktische Feinjustierung und ein Großteil der methodischen Umsetzung können jedoch nur mit Blick auf eine konkrete Lerngruppe in ihrer spezifischen Situation vorgenommen werden und sind daher nicht primäres Anliegen. Angestrebt ist vielmehr, eine solide Basis für die weiterführenden didaktisch-methodischen Entscheidungen zu schaffen.
Daraus ergibt sich, dass der Band an der Schnittstelle von universitärer Literaturwissenschaft, universitärer Literaturdidaktik und der konkreten Umsetzung in der Schule angesiedelt ist. Er hat einen didaktischen Schwerpunkt; methodische Entscheidungen werden nachgeordnet behandelt. Unser Zielpublikum sind also Lernende und Lehrende an Universitäten, Studienseminaren und Schulen. Jede dieser Gruppen hat spezifische Bedürfnisse, auf die unser Band mit folgenden Angeboten reagiert:
Zu Beginn des Prozesses der didaktischen Reduktion steht die sachlich fundierte Auswahl eines Lerngegenstandes. Lehramtsstudierende der Germanistik erhalten in diesem Band eine Einführung in für den Einsatz in der Schule grundsätzlich geeignete epische Texte des Mittelalters, mit deren Hilfe sie ein passendes Werk für ihre zukünftigen konkreten Lerngruppen auswählen können. Der Vorteil gegenüber herkömmlichen Inhaltsangaben oder Einführungen ist die vergleichende Präsentation mehrerer Epen unter dem ‚Heldenblickwinkel‘: Zentrale Texte der mittelhochdeutschen Literatur werden nicht isoliert betrachtet, sondern mit einer ersten didaktischen Schwerpunktsetzung interpretiert und zueinander in Beziehung gesetzt. Die einzelnen Kapitel stellen den Text ins Zentrum und bauen Hinweise auf den Stand der Forschungsdiskussion nur sparsam ein. In die bibliographischen Angaben haben wir aber – sofern vorhanden – jeweils eine Monographie neueren Datums aufgenommen, die entweder eine ausführliche Bibliographie enthält oder über deren Literaturverzeichnis schnell an die einschlägige Forschungsliteratur zu gelangen ist. Dank dieses einführenden Charakters kann der Band auch allgemein von Studierenden der Germanistik sinnvoll genutzt werden.
Innerhalb der Kapitel zu den einzelnen Helden setzt sich die Didaktisierung (Was wähle ich warum und wozu aus?) weiter fort, indem für den didaktischen Schwerpunkt ergiebige Szenen ausgewählt, zweisprachig präsentiert und durch Zusatzinformationen detailliert erschlossen werden. Die Übersetzungen der Originalzitate stammen von uns, um ein sicheres Verständnis im Zusammenhang mit unserem didaktischen Schwerpunkt zu gewährleisten. Dadurch ergibt sich eine durchgängige Problemorientierung (Darstellung des Helden, kritisches Hinterfragen seines Verhaltens), die bei der Umsetzung in eine Unterrichtsreihe an der Schule für die Schüler und Schülerinnen die Ziele sowohl der einzelnen Unterrichtsstunden als auch der gesamten Reihe transparent macht. An dieser Stelle ergeben sich auch Ausblicke für die methodische Umsetzung: Die Anordnung der ausgewählten Szenen in den Einzelkapiteln weist auf einen uns geeignet erscheinenden Aufbau der Unterrichtsreihe hin. Die Länge der zweisprachig präsentierten Textausschnitte und der dazugehörigen erschließenden Kommentierung lassen erkennen, ob dafür eine Einzelstunde oder eine Doppelstunde einzuplanen ist. Die Kapitelstruktur gibt also grundsätzlich Hinweise auf die Phasierung einer Unterrichtsreihe bzw. -stunde.
Eine konkrete didaktisch-methodische Umsetzung lässt sich auch in universitären Zusammenhängen realisieren: Ein Referat zu einem der von uns vorgestellten Texte kann in Form der Gestaltung einer Seminarsitzung mit Einstieg – Problematisierung – Erarbeitung – Auswertung/Sicherung – Vertiefung geplant und durchgeführt werden, wobei die didaktische Feinjustierung sowie die konkrete methodische Umsetzung mit Blick auf die Lerngruppe (Lehramtsstudierende der Germanistik) erfolgen sollte. Der Band eignet sich also auch für Seminare der universitären Literaturdidaktik, da auf seiner Grundlage sowohl die didaktische Erschließung einzelner Texte als auch vergleichende Aspekte und grundsätzliche unterrichtsplanerische Techniken in den Blick genommen werden können.
Die didaktischen Hilfestellungen, die der Band bietet, können auch von Referendarinnen und Referendaren sowie von Studierenden im Praktikum genutzt werden. Diese haben den Vorteil, ihre geplanten Stunden und Reihen an tatsächlichen schulischen Lerngruppen erproben zu können. Fachleiterinnen und Fachleiter können auf der Grundlage des Bandes das Repertoire der in den Fachseminarsitzungen zur Sprache kommenden Texte erweitern oder auch Ausbildungsaufgaben wie zum Beispiel eine Sequenzplanung stellen. Lehrerinnen und Lehrer können das vorgestellte Material nicht nur für die eigene Unterrichtsplanung, sondern darüber hinaus auch für fächerübergreifende Projekte vor allem mit dem Fach Geschichte nutzen. Der Schwerpunkt des Bandes liegt jedoch auf der literaturdidaktischen Erschließung von für den Schulunterricht viel zu wenig genutzten Texten.
1.3 Hilfsmittel zur Arbeit mit mittelhochdeutschen Texten
Zwei Lexika erschließen zuverlässig die Epoche des Mittelalters, zum einen das Lexikon des Mittelalters für allgemeine Informationen aller Art, zum anderen das Verfasserlexikon, das die Autoren des deutschen Mittelalters mit Leben und Werk vorstellt. Einen lebendigen und gut zu lesenden Einblick in die Kultur um 1200 gibt Joachim Bumkes Höfische Kultur. Literatur und Gesellschaft im hohen Mittelalter. Eine knappe und zugleich sehr informationsreiche Literaturgeschichte, die ihren Gegenstand überdies sehr klar und verständlich darstellt, ist die Geschichte der deutschen Literatur des Mittelalters und der Frühen Neuzeit im Überblick von Horst Brunner. Stellvertretend für die zahlreichen Einführungen seien genannt: Mittelhochdeutsch. Eine Einführung (sprachgeschichtliche Einführung mit alphabetischem Begriffsglossar) von Hilkert Weddige und Germanistische Mediävistik. Eine Einführung (für Anfänger geschriebene, gut zu lesende allgemeine Einführung) von Thomas Bein.
Mittelhochdeutsche Wörterbücher sind online zugänglich über das Internet-Portal woerterbuchnetz.de. Zugang zu einer Fülle weiterer Informationen bietet auch das Portal mediaevum.de, das seit Jahren wissenschaftlich geführt und sorgfältig gepflegt wird. Als zweite nützliche Internetadresse, die speziell für den Einsatz mittelalterlicher Literatur im Deutschunterricht entwickelt wurde, ist die Website des Projekts mittelneu. Mittelhochdeutsche Texte im Deutschunterricht an der Universität Duisburg-Essen (http://www.uni-due.de/~hg0222/) zu nennen. Das Projekt ist zwar vorläufig abgeschlossen, die Website soll jedoch weitergeführt und aktuell gehalten werden. Bisher liegen dort Lehr- und Lernmaterialien schwerpunktmäßig zu den drei Bereichen Kleinepik, mittelalterliche Lyrik und Nibelungenlied vor (vgl. Miedema / Sieber 2013).
1.4 Literatur
Nachschlagewerke
Lexikon des Mittelalters. Bd. 1–9, München/Zürich 1980–98
Die deutsche Literatur des Mittelalters. Verfasserlexikon. Bd. 1–13, Berlin / New York 1978–2007
Zitierte Literatur
Bein, Thomas (2005): Germanistische Mediävistik. Eine Einführung. 2., überarb. und erw. Aufl. Berlin (Grundlagen der Germanistik 35) (zuerst 1998)
Brunner, Horst (2010): Geschichte der deutschen Literatur des Mittelalters und der Frühen Neuzeit im Überblick. Erweiterte und bibliographisch ergänzte Neufassung. Stuttgart (zuerst 1997)
Bumke, Joachim (2005): Höfische Kultur. Literatur und Gesellschaft im hohen Mittelalter. 11. Aufl. München (zuerst 1986)
Karg, Ina (2012): Stellungnahme zur Frage ‚Soll die Mediävistik weiterhin (bzw. wieder stärker) eine Rolle im Lehramtsstudium spielen?‘ In: Germanistik und Lehrerbildung – Debatten und Positionen, hrsg. v. Mark-Georg Dehrmann / Jan Standke, 59/2. S. 161–163
Miedema, Nine / Sieber, Andrea (2013): Zurück zum Mittelalter. Neue Perspektiven für den Deutschunterricht. Frankfurt/M. [usw.] (Germanistik – Didaktik – Unterricht 10)
Weddige, Hilkert (2010): Mittelhochdeutsch. Eine Einführung. 8., durchgesehene Aufl. München (zuerst 1996)
1 Hingewiesen sei auf den Dokumentarfilm Wochenendkrieger (Regie: Andreas Geiger, Produktionsjahr: 2012), der das erstaunliche Phänomen aufgreift, wie und mit welcher Motivation sich Leute ganz unterschiedlicher Provenienz zusammenfinden, um Rollen in ‚mittelalterlichen‘ Szenarien zu spielen.
2 Vgl. auch das Plädoyer von Karg 2012: 162.