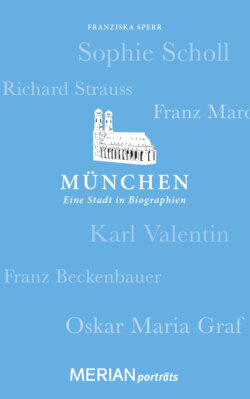Читать книгу München. Eine Stadt in Biographien - Franziska Sperr - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление[zurück]
FRANZ VON LENBACH
1836–1904
Er kam aus einem kleinen bayerischen Provinzort in die Stadt und wurde dank seines Talents und Ehrgeizes zum Malerfürsten von München. Für sein Erbe ist ihm die Stadt bis heute mehr als dankbar.
Die meisten Menschen machen sich in ihrem Leben einen Plan, dann noch einen zweiten – doch, wie es bei Brecht heißt, »gehn tun sie beide nicht«. Das ist die Normalität. Es gibt aber auch Menschen, die machen den Plan sehr früh und richten dann alles im Leben so ein, dass der Plan aufgeht. Allerdings müssen zwei Komponenten zusammenkommen: erstens immer das Ziel im Auge behalten und zweitens: Das Schicksal darf keinen Strich durch die Rechnung machen. »Einen Gulden täglich mit Malerei verdienen«, das war der Plan des 16-jährigen Handwerkersohns Franz Lenbach.
Das ganze Leben lang hat er zäh und geschickt sein Ziel verfolgt: Aus dem einen Gulden wurden zwei, fünf, 100, 1000; er hat seinen Plan übererfüllt. Und mit der Malerei war ziemlich viel Geld zu verdienen, das kristallisierte sich in diesem Leben Schritt für Schritt heraus. Der Bauernbub, so wird es kolportiert, sei von seinem Geburtsort Schrobenhausen unzählige Male barfuß über Stock und Stein die zehn Stunden bis nach München gelaufen, um seine Lieblingsgemälde in der Alten Pinakothek 2 ( ▶ D 2) zu studieren. Es hat sich gelohnt. Sein letzter Wohnsitz, die Stadtvilla, das Lenbachhaus, legt noch heute Zeugnis ab von einem, der von unten kam, nach oben wollte und ganz oben landete.
So ein »Riesentrumm Haus« (Fertigstellung 1891) konnte sich auch damals nur einer leisten, dem die lukrativen Aufträge irgendwann nur so zuflogen. Der Großverdiener Lenbach und sein Architekt Gabriel von Seidl nahmen sich beim Bau der Villa alle Freiheiten und ließen ihrer Lust an ästhetischen Finessen und modernster technischer Ausstattung freien Lauf. Wenn das Geld knapp wurde, musste der Bauherr schneller malen, oder die Bank sprang ein und gewährte Kredit, denn man wusste ja, mit wem man es zu tun hatte. Auf einem Grundstück, nur einen Steinwurf vom klassizistischen Königsplatz entfernt, entstand ein fürstliches Palais im Stil der italienischen Renaissance. Es scheint, als hätten Auftraggeber und Architekt im Duett gesungen: Dem einen saß das Geld locker in der Tasche, aus dem anderen sprudelten die Ideen heraus, den Sinn fürs ewig Schöne hatten beide. Geschnitzte Holzdecken und Marmor, vergoldeter Stuck, erlesene Möbel, Gobelins und Teppiche, antike Skulpturen, alles vom Feinsten.
Wir Nachgeborenen können froh sein über die ästhetische Großmannssucht und betreten den gepflegten Garten vor der Villa, verharren am bronzenen Springbrunnen, benetzen die heiße Stirn, Traum und Wirklichkeit verschwimmen. Unser Blick wandert hinüber zur ockerfarbenen Fassade des Anwesens. Vögel zwitschern in den Bäumen, eine schläfrige Katze räkelt sich, wir träumen den Traum von der Toskana, von Olivenhainen und Zikaden. Doch wir stehen in der Eingangshalle der Städtischen Galerie im Lenbachhaus 30 ( ▶ C 3), dort gibt es Münchner Malerei aus seiner Zeit zu sehen: Spitzweg und Rottmann, Kaulbach, Leibl, Trübner und von Piloty, von Kobell und natürlich einiges von Lenbach.
Zu unserem großen Vergnügen gibt es hier auch die Kunst zu sehen, die dem ehemaligen Besitzer der Villa ganz sicher nicht gepasst hätte: Der Blaue Reiter mit Bildern von Kandinsky und Münter, Marc und Macke, Klee, Jawlensky und Werefkin. In einem Teil der Räume gibt es wechselnde Ausstellungen, hier werden Tendenzen des modernen und aktuellen Kunstgeschehens gezeigt, wie etwa die Installation des großen Joseph Beuys »Zeige deine Wunde«. Und weil wir schon einmal hier sind, gehen wir hinüber in den Kunstbau, die Erweiterung des Lenbachhauses; hier wurde in einem Leerraum, den man beim Bau der U-Bahn angelegt hatte, ein 110 x 14 Meter großer Raum als ungewöhnliche Ausstellungshalle ausgebaut, hell, doch ohne jedes Tageslicht, für Wechselausstellungen moderner oder neuester Kunst.
ER LERNTE UND LERNTE – UND HATTE ERFOLG
Franz Lenbach absolvierte mit großem Ernst die zeichnerische Grundausbildung an der Münchner Akademie der Bildenden Künste 1 ( ▶ F 1), zuvor hatte er sich in Augsburg im Figurenzeichnen unterrichten lassen. Jede freie Minute verbrachte er in dem Dorf Aresing, um sich dort mit Freunden und Kollegen in einer Malschule auszuprobieren. An der Akademie arbeitete er emsig, schnell war er Schüler von Carl von Piloty, dem einflussreichen Historienmaler. Alles lief wie geplant, bereits jetzt konnte er sein noch bescheidenes Leben finanzieren. Bei der Deutschen Historischen Kunstausstellung im Glaspalast, ehemals am Alten Botanischen Garten, Luisenstraße, erregte sein Bild »Landleute vor einem Unwetter flüchtend« großes Aufsehen. Er fing an, viel Geld zu verdienen: 450 Gulden brachte es ihm ein und ein Stipendium, und weil er mit seinen 22 Jahren schon vernünftig und zielstrebig war, investierte er das Geld 1858 in eine Studienreise nach Rom, gemeinsam mit seinem Lehrer Piloty.
Aus Italien brachte er ein meisterhaft gemaltes Bild mit, »Der Titusbogen«. Es war noch nicht fertig, es fehlten noch einige Figuren – die fand er unter den Jugendlichen in Aresing. Lenbach erntete Lob, er hatte ein großartiges Bild gemalt, das beflügelte ihn. Wie manisch studierte, forschte, probierte er weiter. Als hätte er gespürt, dass alles noch ausbaufähig, technisch raffinierter und gestalterisch perfekter sein könnte, dass er überall in Europa von anderen abgucken, lernen, nachmalen konnte. So reiste er zu den wichtigen Kunstmuseen, verbrachte Tage und Wochen vor den Werken der Großen: Tintoretto, Rubens, Tizian, Rembrandt, Velazquez. Er inhalierte die Gemälde. Wie früher, als er ohne Schuhe in die Pinakothek lief, war ihm kein Weg zu beschwerlich, wenn das Ziel ein gutes Bild war.
Das viele Reisen kostet Geld. Lenbach hat inzwischen den reichen Kunstsammler Baron Adolph Friedrich von Schack kennengelernt, der wittert sein Talent, schickt ihn auf Reisen, damit er Kopien von bekannten Gemälden machte – und zahlt. Und Lenbach liefert. Er ist mit der Herstellung der begehrten Kopien so überlastet, dass er keine Muße mehr hat, sich damit zu beschäftigen, was andere Künstler seiner Generation diskutieren.
Chance und Fluch liegen auch hier nah beieinander. Das Altmeisterliche, Dunkle, erdig Verschattete, mit dem er viel Geld verdient, klebt wie Pech an seinem Pinsel, aber den Leuten gefällt es. Nun malt er nur noch Porträts. Wer es sich leisten kann, reiht sich ein in die Schlange derer, die von Lenbach gemalt werden wollen: Papst Leo XIII., der britische Premier Gladstone, Kaiser Franz Joseph, Schauspielerinnen, Industrielle, wer etwas auf sich hält, lässt sich von dem Salonmaler aus München porträtieren. Selbstdarstellung im Glanze eines schönenden Porträts: die Herren interessanter, bedeutungsvoller als vielleicht in Wirklichkeit, die Damen ebenso, vor allem schöner, die Kinder von gefälliger Unverdorbenheit.
Das Neue ist, dass es nicht mehr auf die Utensilien ankommt, sondern allein auf das Gesicht und den Ausdruck. Es schmeichelt, sich so zu sehen. 12 000 Gulden kostet jetzt ein Porträt, der Rubel rollt. Karriere im Turbogang. Und wo der Erfolg wohnt, da stehen Neider und Kritiker vor der Tür: »Lenbach sitzt auf dem Schoß der Traditionalisten«, so hört man es hinter vorgehaltener Hand flüstern, »er wird es trotz seines finanziellen Erfolges über den Salonmaler hinaus nicht bringen«. Aber wollte er das denn?
Gesellschaft erster Klasse: Zu seinen besten Freunden zählt er den Reichskanzler aus Berlin, Otto von Bismarck. Der ist inzwischen zu seinem besten Kunden geworden und lässt sich in über 80 Porträts von Lenbach auf die Leinwand bannen. Die beiden Freunde besuchen sich häufig und hecken manche Idee aus, etwa die Errichtung eines Bismarck-Turms am Starnberger See, wo man bei gutem Wetter mit Blick aufs Wasser bis hin zum Gebirge herrlich Picknick machen kann.
LENBACH HAT SICH HOCHGEHEIRATET
1882 adelte man ihn zum Ritter von Lenbach. Was fehlt noch zum Glück? Eine Familie, eine Frau. Lenbach heiratet nach oben, die Gräfin Magdalena von Moltke, Nichte des preußischen Generalfeldmarschalls. Nun hat er Zugang zu den höchsten Kreisen. Doch die Ehe geht schief, der Herr ist egomaner Künstler, und die Dame hat mit Malerei nichts am Hut. Zwei Töchter kommen zur Welt: Marion und Erika. Ein paar Jahre später der zweite Versuch: Charlotte von Hornstein, genannt Lolo, ist die Richtige, zieht mit ihm an einem Strang, unterstützt ihn bei der Arbeit und bewegt sich elegant auf dem Gesellschaftsparkett. Eine weitere Tochter wird geboren, Gabriele. In der Prachtvilla gibt das Paar glanzvolle Feste, prominente Gäste aus In- und Ausland weilen bei den Lenbachs.
Doch die Arbeit geht vor, so ein Leben ist teuer, die Kredite wollen bedient werden. Lenbach porträtiert wie der Teufel. Doch wichtige Menschen haben nicht die Zeit, Modell zu sitzen, also behilft er sich mit Fotos. Das geht schnell und befriedigt die Auftraggeber genauso. Maleratelier und Fotoatelier, im Akkord wird vergrößert, gepaust, durchgedrückt, gemalt – und verkauft. Die Stadt hat ihren Malerfürsten. Lenbach wird Präsident der Künstlergenossenschaft Allotria, durchsetzungsstark, knorrig, polternd, despotisch.
Mit solchen Charaktereigenschaften lässt sich auch einiges durchboxen: Er sammelt Geld für ein Künstlerhaus, an Überzeugungskraft mangelt es ihm nicht. Seinen Architektenfreund von Seidl beauftragt er mit den Plänen. Das Künstlerhaus am Lenbachplatz 18 ( ▶ D 5) ist bis heute ein wichtiger Veranstaltungsort in der Stadt, und im Restaurant kann man es sich in den großartigen Jugendstilräumen gut gehen lassen.
Franz von Lenbach war einer der Großkopferten, wie man in München sagt. Aber Erfolg und Geld sind ihm nicht in den Schoß gefallen, er war ein Arbeitstier, mit seismografischem Gespür hat er sich immer dorthin bewegt, wo alles versprochen und das meiste gehalten wurde. Er war wichtig, hat angeregt und durchgesetzt, ein Mann der ersten Gesellschaft. Nur, in die erste Riege der Maler seiner Zeit, der Innovativen, der Avantgarde, der von der Kritik Ernstgenommenen, hat er es nicht geschafft. Zu viel Tirolerei, hieß es, zu wenig Selbstkritik.
Um 1860 entstand das Bild »Der rote Schirm«, es wurde wegen seiner eigenständigen Farbgebung als Frühwerk des deutschen Impressionismus gerühmt. Da wäre noch alles drin gewesen.
MÜNCHNER KÜNSTLERHAUS AM LENBACHPLATZ 18 ▶ D 5
Lenbachplatz 8, Altstadt
www.kuenstlerhaus-muc.de
▶ U- und S-Bahn: Karlsplatz (Stachus)
STÄDTISCHE GALERIE IM LENBACHHAUS 30 ▶ C 3
Luisenstraße 33, Maxvorstadt
www.lenbachhaus.de
▶ U-Bahn: Königsplatz