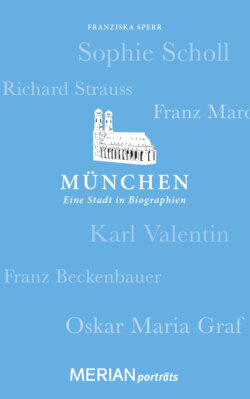Читать книгу München. Eine Stadt in Biographien - Franziska Sperr - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление[zurück]
MAXIMILIAN II. EMANUEL VON BAYERN
1662–1726
Das waren noch Zeiten, als die Männer ihren Frauen zur Geburt des ersten Sohnes ein Schloss schenkten. So geschehen bei der Geburt des Erbprinzen Max II. Emanuel, aus dem ein großer Kurfürst werden sollte.
Die Hoffnung des Kurfürsten Ferdinand Maria von Bayern, seine Gemahlin Henriette Adelaide von Savoyen möge einem gesunden Sohn und Stammhalter das Leben schenken, war in Erfüllung gegangen. Die Freude war groß, und auch mehrere Gelübde waren einzulösen. Aus Italien holte man den Theatinerorden nach München und stiftete ihm die Kirche St. Kajetan, heute Theatinerkirche 33 ( ▶ F 4) genannt, und ein Kloster. Die Kirche sollte nur einen Steinwurf entfernt, gegenüber der Residenz, errichtet werden, damals am äußersten Stadtrand Münchens, heute braucht es einige Fantasie, sich das vorzustellen.
Die junge Mutter erhielt die großzügig bemessenen Mittel zum Bau eines Schlosses, das nordwestlich von München errichtet werden sollte und welches jener so heiß ersehnte Sohn dann nach dem Tod des Vaters im Jahr 1679 erweiterte und schließlich selbst als Sommerresidenz nutzte: Schloss Nymphenburg. Italienischer Barock war passé, Schloss Nymphenburg wirkte dagegen fast streng und schnörkellos. Es lag weit außerhalb der Stadtgrenze, dort, wo die Luft rein war, nicht schwer vom Gestank des Pferdemists. Hier störte kein Getrappel der Hufe, man konnte sich ausruhen und erholen. Das ist heute noch so: Im Nymphenburger Park ist man in einer anderen Welt, weit weg von der tosenden Stadt, hier können sich Liebespaare im Flüsterton verständigen, die Alten spazieren auf den Sandwegen, durchs satte Grün im Sommer oder durch verschneite Traumlandschaften im Winter.
Der Sohn genoss die beste Erziehung und sah gut aus mit seinen feinen Gesichtszügen und den bis über die Schultern reichenden Locken. Sein Territorium umfasste die größeren Teile von Ober- und Niederbayern, der Oberpfalz und das Innviertel. Doch das Land war arm: Mehr als die Hälfte der Güter befand sich im Besitz von Kirchen und Klöstern, zwei Drittel der Menschen rackerten sich in der Landwirtschaft ab. Seinen zunehmend aufwendigen höfischen Haushalt konnte Max Emanuel bald nicht mehr über die Abgaben und Steuern seiner Untertanen finanzieren, er ließ immer häufiger das Volk ohne Bezahlung für sich arbeiten.
Max Emanuel hätte sich schon in jungen Jahren zur Ruhe setzen und ein Luxusleben am Hof genießen können, aber zuerst wollte er sich und der Welt etwas beweisen. Ganz Europa fühlte sich von den Türken bedroht, doch um gegen sie gerüstet zu sein, musste Max Emanuel sein Heer stärken. Was hieß: Mehr Soldaten mussten her. Und wie macht man das? Der Trick war schon damals kein Geheimnis und hieß: Sondersteuer.
ER BRACHTE DIE TÜRKEN NACH MÜNCHEN
Sichtbar zum Manne gereift, tapfer, stolz und herrlich, erwarb er sich den Ruf eines herausragenden Feldherrn. Die goldenen Tressen an der blauen Uniform glitzerten im Sonnenlicht. Die Lockenmähne, die wie sein Pferd kaum zu bändigen war, trug zum stolzen Bild des »Blauen Königs« bei (wie er von den Türken wegen der Farbe seiner Uniform genannt wurde), der in ganz Europa als Türkenbezwinger bekannt war. Der dankbare Kaiser ernannte ihn zum Generalissimus und Ritter des Ordens vom Goldenen Vlies. So jung, so erfolgreich, so heldenhaft! Aus dynastischen Überlegungen heiratete er in Wien die Kaisertochter Maria Antonia von Österreich, die schon sieben Jahre später, nach der Geburt ihres dritten Sohnes, Joseph Ferdinand, mit 23 Jahren starb. Seine zweite Ehe schloss er mit Therese Kunigunde von Polen, Tochter des Königs Jan III. Sobieski, der ebenfalls als großer Feldherr gegen die Türken und Retter Wiens in die Geschichte einging.
In den siegreichen Feldzügen zwischen 1683 und 1699 hatte das Heer des Kurfürsten aus Bayern viele türkische Gefangene gemacht, die vom Kurfürsten teilweise nach München geschickt wurden, um sie als Arbeiter beim Bau des Nymphenburger Kanals, des Gartenschlösschens Lustheim oder als Diener einzusetzen. In Adelskreisen war es inzwischen Mode, sich von Türken bedienen zu lassen. Die Missionierung der Türken betrieb man eifrig mithilfe von Dolmetschern, 1688 wurde in München eine eigene Zunft der (türkischen) Sesselträger gegründet. Pech nur, dass, sobald der Kaiser in Karlowitz mit dem Sultan 1699 Frieden geschlossen hatte, die türkischen Gefangenen nach Hause zurückkehrten. In München war man plötzlich gezwungen, sich mit gerade mal 36 türkischen Sklaven zu begnügen. Der Bau des Kanals, der von der Residenz bis zum Schloss Schleißheim führen sollte, wurde dummerweise erst begonnen, als die Türken nicht mehr zur Verfügung standen. Der unvollendete Graben wurde zugeschüttet.
Heute befindet sich dort die Türkenstraße ( ▶ E 4–F 1), und wenn man etwa unkonventionelle Mode oder Delikatessen aus aller Welt sucht, wird man in dieser Straße mit ihren vielen kleinen Läden fündig. Schlendert man weiter, kommt man zur Kurfürstenstraße und zur Belgradstraße, die an die Eroberung Belgrads durch Max II. Emanuel im Jahr 1688 erinnert.
Aber nicht alle listig eingefädelten dynastischen Pläne des bayerischen Kurfürsten gingen auf. Sein ältester lebender Sohn Joseph Ferdinand, der Anspruch auf den Thron des spanischen Imperiums gehabt hätte, starb im Alter von sechs Jahren. Als der spanische König Karl II. dann im Jahr darauf starb, dachte Max Emanuel, dass er nun selbst als Alleinerbe in Frage käme. Doch sowohl der französische König als auch die Habsburger meldeten ihre Ansprüche an. Im dadurch ausgelösten Spanischen Erbfolgekrieg (1701–1714) schlug sich Max Emanuel auf die Seite der Franzosen und hatte wieder Pech. In der blutigen Entscheidungsschlacht bei Höchstädt an der Donau wurden die Franzosen und die mit ihnen verbündeten Bayern von den alliierten Österreichern, Preußen und Engländern entscheidend geschlagen. Über den bayerischen Kurfürsten wurde die Reichsacht verhängt. Er floh über den Rhein und überließ in den darauf folgenden zehn Jahren seine Bayern schutzlos den Österreichern.
Die Residenzstadt München wurde dazu verdonnert, Besatzungssoldaten zu beherbergen, die Familie des Kurfürsten nahm man gefangen, die Bevölkerung wurde ausgebeutet. Ein idealer Nährboden für tragische Heldenlegenden wie die vom Schmied von Kochel, der, so heißt es, an der Spitze eines Haufens aufständischer Bauern in der Weihnachtsnacht 1705 nach München stürmte, um das bayerische Volk aus den Klauen der Österreicher zu befreien. Die Aufständischen wurden brutal niedergemetzelt.
Das Ereignis ging als »Sendlinger Mordweihnacht« in die Geschichte ein und bietet heute noch den historischen Hintergrund für farbenprächtige Gedenkfeiern und -gottesdienste. Ein Denkmal im Stadtteil Sendling zeugt von der angeblichen Großtat des Schmieds: ein uriges Mannsbild mit nacktem Oberkörper und Lederschurz, in der Rechten den Schmiedehammer, die Fahne des Aufstands um die Schultern gelegt.
DER FELDHERR WURDE EIN SCHÖNGEIST
Irgendwann wurde die Reichsacht aufgehoben und Max Emanuel kehrte zurück. In der Hoffnung, Glanz und Gloria Bayerns weiter zu mehren, verheiratete er seinen Sohn Karl Albrecht mit der Tochter Kaiser Joseph I., Maria Amalie, allerdings konnte er die Früchte dieses Heiratsmanövers nicht mehr ernten, weil er 1726 im Alter von 63 Jahren an einem Schlaganfall starb.
Was den Münchnern bis heute im Gedächtnis geblieben ist, ist nicht der Kriegsheld und Machtpolitiker, sondern der Schöngeist und Kunstsammler, der er auch war. Er kaufte über 100 Gemälde – allein zwölf vom niederländischen Großmeister Peter Paul Rubens, die den Grundstock für eines der wichtigsten Museen der Welt legten, die Alte Pinakothek 2 ( ▶ D 2).
Gegenüber dem Nobelhotel Bayerischer Hof steht auf dem Promenadeplatz die Statue des Kurfürsten Max Emanuel 21 ( ▶ E 5), 1861 geschaffen von Friedrich Brugger im Auftrag von Ludwig I., zwischen den Denkmälern der Komponisten Orlando di Lasso und Christoph Willibald Gluck. Der Sockel des Monuments von Orlando di Lasso ist aufs Liebevollste geschmückt mit Fotos, Bildchen, Liebesschwüren, Kitschpostkarten, auf den Stufen liegen Blumenkränze mit Plastikputten, Grablaternen, Stoffpüppchen und Kuscheltieren. »Dein für immer. Heide« steht da oder »We will always love you!« oder »Du Licht des Friedens – Kiki«. Die Erinnerungsaktion gilt nicht etwa dem bedeutendsten Komponisten der Hochrenaissance auf dem Sockel, sondern Michael Jackson, der 1998 seinen Sohn Prince Michael Junior ans Fenster seiner Suite hielt. Eine Inszenierung, die nicht nur die Herzen von Münchner Schwiegermüttern höher schlagen ließ.
ALTE PINAKOTHEK 2 ▶ D 2
Barer Straße 27, Maxvorstadt
www.pinakothek.de
▶ Tram: Pinakotheken
MAX-EMANUEL-DENKMAL 21 ▶ E 5
Promenadeplatz, Altstadt
▶ U- und S-Bahn: Marienplatz
SCHLOSS NYMPHENBURG
Nymphenburg
www.schloss-nymphenburg.de
▶ Tram: Schloss Nymphenburg
SCHLOSS SCHLEISSHEIM
Max-Emanuel-Platz 1, Oberschleißheim
www.schloesser-schleissheim.de
▶ S-Bahn: Oberschleißheim, Fahrzeit ca. 25 Min.
THEATINERKIRCHE 33 ▶ F 4
Theatinerstraße 22, Altstadt
www.theatinerkirche.de
▶ U-Bahn: Odeonsplatz