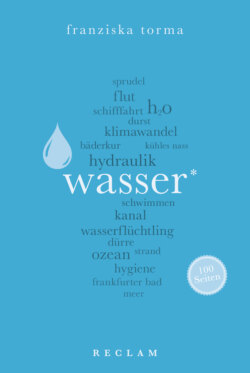Читать книгу Wasser. 100 Seiten - Franziska Torma - Страница 6
ОглавлениеWasser als Stoff und Faszination
Anomalien des Wassers: Wasser in der Wissenschaft
Nicht nur wegen seiner physikalischen und chemischen Struktur gilt Wasser in den Naturwissenschaften als Flüssigkeit mit besonderen Eigenschaften. Der schwedische Physiker Anders Celsius (1701–1744) baute seine Temperaturskala auf dem ›Verhalten‹ von Wasser auf. Null Grad beschreibt den Punkt, an dem Wasser gefriert, und ab 100 Grad entsteht aus kochendem Wasser Dampf. Dazwischen ist Wasser flüssig, wobei die Bewegungsgeschwindigkeit der Wassermoleküle und die Temperatur einander beeinflussen.
Wasser unterscheidet sich zudem von anderen Flüssigkeiten. Diese Besonderheit nennen wir »Anomalien des Wassers«: Warum weisen Tausende von Schneeflocken immer die gleiche sechseckige Symmetrie auf? Warum kreisen um einen Kern manchmal vier, manchmal fünf Wassermoleküle? Die Ursache liegt in der chemischen Struktur. Wasser (H2O) besteht aus einem Sauerstoffatom, an das zwei Wasserstoffatome angebunden sind. Aufgrund dieser Grundanordnung ist es dipolar. Das Wasserstoffmolekül hat eine leicht positive und das Sauerstoffmolekül eine leicht negative Ladung. Diese unterschiedlichen Bestandteile des Wassers können eine Brückenbindung eingehen. Wassermoleküle schließen sich in Clustern zusammen. Das hat zur Folge, dass die Moleküle in Wasser und Eis ähnlich angeordnet sind. Die Dipolwechselwirkung, die für die Orientierung der Wassermoleküle verantwortlich ist, ist aber stark temperaturabhängig. Deshalb bildet sich die symmetrische Anordnung in »Wassergittern« (in der Fachsprache: Tetraederstrukturen) besser bei tieferen Temperaturen, in denen die Molekülbewegung langsam ist. Am besten zu beobachten ist das beim Eis.
Insgesamt weist Wasser 70 solcher Anomalien auf, die sich nur teilweise naturwissenschaftlich erklären lassen. Warum, zum Beispiel, ist Eis leichter als Wasser? Der modernen Physik und Chemie fehlt noch ein umfassendes Verständnis aller Eigenschaften des Wassers. Viele Anomalien werden weiterhin neu entdeckt, manche an unerwarteten Orten und durch Zufall, wie zum Beispiel in einer Lehrküche in Tansania im Jahr 1960. Der Kochlehrling Erasto Mpemba sollte während der Ausbildung Eiscreme herstellen. Dazu musste er eine Wassermischung mit Pulver anrühren. Erasto Mpemba bemerkte dabei, dass das Eis schneller gefror, wenn er warmes statt kaltem Wasser verwendete. Zunächst hielten sowohl sein Kochlehrer als auch der Physikprofessor Denis Osborn die Beobachtung für baren Unsinn. Thermodynamisch gesehen könne warmes Wasser nicht schneller als kaltes gefrieren! Mpemba konnte jedoch Osborn überreden, den Vorgang selbst zu wiederholen. Osborn war erstaunt zu sehen, dass warmes Wasser tatsächlich schneller zu Eis wurde. Im Jahr 1969 veröffentlichten sie diese Beobachtung. Heute ist sie als Mpemba-Effekt bekannt, aber die Ursachen sind nicht vollständig geklärt.
Wasser friert übrigens nicht immer bei null Grad. Starker Druck ›zwingt‹ die Moleküle zum Zusammenrücken, und es entsteht ›heißes‹ Eis. Es schmilzt, wenn der Druck nachlässt. Wasser kann auf minus 40 Grad gekühlt werden, ohne dass es friert. Wenn man die Wasserflaschen dann aus dem Gefrierfach holt und sie unsanft auf den Tisch stellt, wird die Flüssigkeit auf einen Schlag doch noch zu Eis. Damit nämlich Wasser gefriert, braucht es Kristallisationskerne wie z. B. Staubteilchen, um die sich die Verfestigung gruppiert. Wenn das Wasser sehr rein ist, fehlen diese Partikel, und es bleibt weit unter dem Gefrierpunkt flüssig. Die kräftige Erschütterung jedoch löst einen Schockfrost aus.
Diese Grauzonen der Wissenschaft schaffen Raum für Spekulationen. Dazu zählt die Theorie vom sogenannten »Gedächtnis des Wassers«, die der französische Immunforscher Jacques Benveniste (1935–2004) im renommierten Journal Nature im Jahr 1988 veröffentlichte. Er berichtete, hochverdünnte Flüssigkeiten zeigten eine Wirkung im Blut, selbst wenn kein einziges Wirkstoffmolekül nachgewiesen werden könne. Das Wasser erinnere sich nämlich daran, das Molekül in der Flüssigkeit ›gesehen‹ zu haben. Um diese Behauptung entstand ein Streit, infolgedessen Benvenistes Labor geschlossen werden musste. Während die Wissenschaftlerkollegen einerseits extrem skeptisch waren, andererseits die Theorie nicht gänzlich verwarfen, freuten sich die Anhänger der Homöopathie maßlos. Endlich sei bewiesen, dass potenziertes Wasser ohne nachweisbaren Zusatz aufgrund seines Gedächtnisses eine somatische (also den Körper betreffende) Wirkung erzielen könne! In den 1990er Jahren schließlich spaltete sich die Wasserforschung: Die einen vertieften sich in wenig öffentlichkeitswirksame Analysen des Stoffes mit Röntgengeräten und Computern, die anderen verkündeten immer neue rätselhafte Seiten und Wirkweisen des Wassers.
Die Arbeiten von Wissenschaftlern, die beide Forschungsrichtungen im Blick haben, ähneln Science-Fiction-Visionen: Gerald Pollack, Professor für Bio-Engineering an der Universität in Seattle, ist fest überzeugt, neben gefroren, flüssig und gasförmig den vierten Aggregatzustand von Wasser gefunden zu haben. Und zwar sei das eine Exklusionszone, die sich an der Grenzfläche bilde und sich durch einen kristallinen Zustand bar jeglicher Verunreinigung auszeichne. Mit diesem EZ-Wasser könne man ›normales‹ Wasser reinigen und Solarzellen ersetzen. Ihm ergeht es ähnlich wie Benveniste mit dem Wassergedächtnis. Wissenschaftler begegnen seiner These mit Skepsis, da stichhaltige Beweise fehlen. Anhänger alternativer Weltsichten fühlen sich hingegen in ihrer Wasseralchemie bestätigt: Prozesse des Levitierens oder Energetisierens seien endlich wissenschaftlich erklärbar!