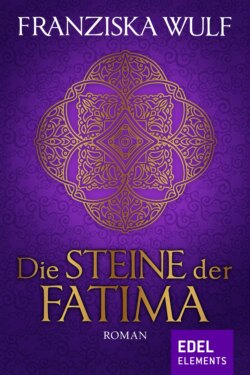Читать книгу Die Steine der Fatima - Franziska Wulf - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
I
ОглавлениеDr. Beatrice Helmer saß allein im Arztzimmer der Chirurgischen Notaufnahme am Schreibtisch und ging ein paar Befunde durch, die gerade aus dem Labor gekommen waren. Durch die geöffnete Tür drangen die Geräusche des Stationsalltags zu ihr herein – die eiligen Schritte der Ärzte und Schwestern auf dem Flur, hin und wieder das Stöhnen und Jammern eines Verletzten, die Stimme eines randalierenden Betrunkenen, der eine Schwester anpöbelte.
Beatrice stützte den Kopf in die Hände und schloss für einen Moment die Augen. Es war Freitagabend. Zu Beginn des Wochenendes war in der Notaufnahme immer viel zu tun, aber an diesem Freitag war es ganz besonders schlimm. Seit sieben Uhr morgens hatten sich Patienten und Rettungssanitäter die Klinke in die Hand gegeben. Beatrice und ihre Kollegen hasteten schon den ganzen Tag im Laufschritt zwischen den Kabinen und Behandlungsräumen hin und her und mussten aufpassen, dabei nicht über die Patienten zu stolpern, die auf den Gängen auf eine Röntgenuntersuchung oder ihre weitere Behandlung warteten. Mittlerweile war es fast Mitternacht. Beatrice war seit siebzehn Stunden ohne Pause im Einsatz. Sie war müde und erschöpft und hatte nur noch den Wunsch, ein heißes Bad zu nehmen und ins Bett zu gehen. Leider war daran noch lange nicht zu denken; acht Stunden Dienst lagen noch vor ihr. Dabei fühlte sie sich, als würde sie nicht einmal die nächste Viertelstunde überstehen können. So ein Tiefpunkt stellte sich bei jedem Nachtdienst ein – mal früher, mal später. Es kam nur darauf an, der Müdigkeit nicht nachzugeben. Beatrice setzte sich aufrecht hin, legte eine Hand auf ihren Bauch und konzentrierte sich so auf die Atmung, wie sie es vor kurzem im Fitness-Studio in dem »Atmen Sie die Spannungen weg«-Kurs gelernt hatte. Angeblich war das eine Technik, die überall, sogar am Arbeitsplatz oder in der U-Bahn funktionierte. Sie zählte bei jedem Atemzug langsam bis zehn und versuchte den Betrunkenen zu ignorieren, der sich lautstark gegen die Blutentnahme wehrte. Offensichtlich hielt er die Ärzte und Schwestern für Mitarbeiter des KGB. Sie öffnete die Augen und horchte in sich hinein. Fühlte sie sich wieder fit und entspannt? Na, vielleicht ein bisschen. Aber vermutlich hatten die Erfinder dieser Entspannungstechnik nicht an die Verhältnisse auf Notaufnahme-Stationen gedacht.
Beatrice widmete sich wieder den Befunden. Es waren die schlechtesten Blutwerte, die sie jemals zu Gesicht bekommen hatte. Sie gehörten zu einer Neunzehnjährigen, die im Heroinrausch eine Treppe am Hauptbahnhof hinuntergefallen war und sich dabei den Arm gebrochen hatte. Beatrice selbst hatte die Fraktur gerichtet und den Arm anschließend eingegipst. Aber hatte sie der jungen Frau wirklich helfen können? Noch jetzt erschauerte sie, wenn sie an die Augen in diesem schmalen, totenbleichen Gesicht dachte; die trüben Augen einer Greisin, mit Skleren von der Farbe reifer Orangen. Obwohl eine stationäre Behandlung dringend erforderlich gewesen wäre, war es ihr nicht möglich gewesen, die junge Frau zum Bleiben zu überreden. Der Gips war noch nicht einmal richtig durchgetrocknet, als sie wieder ging. Natürlich auf eigene Verantwortung, das hatte sie unterschreiben müssen. Die Klinik wollte schließlich nicht eine mögliche Strafanzeige wegen Fahrlässigkeit riskieren. Beatrice schüttelte frustriert den Kopf. Nach deutschem Recht hatte sie alles getan, was sie für die junge Frau tun konnte. Dennoch blieb das unangenehme Gefühl, in diesem Fall versagt zu haben. Jeder hier wusste, dass auf dem kurzen Weg vom Krankenhaus bis zum Hamburger Hauptbahnhof mindestens zwei Dutzend Dealer auf Kundschaft warteten. Die Leber der jungen Frau konnte noch zwei, vielleicht drei Trips überstehen. Sie würde sich wieder mit Heroin versorgen und wahrscheinlich nicht einmal mehr lange genug leben, um sich den Gips wieder abnehmen zu lassen.
»Ich glaube, den kannst du brauchen, Bea.«
Wie aus heiterem Himmel stand plötzlich ein Becher mit dampfendem Kaffee vor Beatrice. Überrascht und dankbar sah sie zu Susanne auf. Die junge Schwester war für ihre Hilfsbereitschaft bekannt, und diesmal hatte sie geradezu hellseherische Fähigkeiten bewiesen. Beatrice brauchte den Kaffee tatsächlich dringend. Und da kleine Gefälligkeiten zwischen Schwestern und Ärzten eine Rarität waren, wusste sie diese Geste besonders zu schätzen. Sie schloss die Augen, atmete den Duft ein und nippte vorsichtig an dem Kaffee. Er war heiß und stark, und obwohl es sich lediglich um irgendeine billige Marke handelte, in der alten, schmuddeligen Kaffeemaschine der Station gebrüht, entfaltete er eine bessere Wirkung als die ausgeklügelte, nach internationalen Erkenntnissen entwickelte Entspannungsübung.
Susanne ließ sich auf den Drehstuhl fallen, der neben Beatrice stand, und warf einen Blick auf die Befunde. »Sind das die Laborwerte der Kleinen?«
»Ja. Ihre Leber wird sich bald verabschieden. Und soll ich dir noch eine gute Neuigkeit verraten? Sie ist schwanger.« Beatrice warf den Befund auf den Stapel im Ablagekorb. »Wir wissen ganz genau, dass dieses Mädchen in der nächsten Zeit an Leberversagen sterben wird, doch gegen ihren Willen können wir nichts tun, gar nichts. Wir können nur Wetten darauf abschließen, ob sie im Koma noch einmal zu uns gebracht wird oder gleich in der Gerichtsmedizin landet.«
»Ja, das ist bitter«, sagte Susanne. »Aber weißt du, manchmal ...«
In diesem Augenblick öffneten sich die Schwingtüren, und mindestens zwei Dutzend Männer und Frauen stürmten die Station. Die Luft war erfüllt von den schrillen Schreien verschleierter Frauen. Beatrice und Susanne sprangen gleichzeitig auf, die Heroinsüchtige war vergessen.
Messerstecherei? Schusswunden? Schwerverletzte?, ging es Beatrice blitzschnell durch den Kopf. Doch noch während sie überlegte, ob auf der Intensivstation genügend freie Betten zur Verfügung standen, sah sie, dass einer der Männer eine alte Frau auf seinen Armen trug. Im selben Augenblick schämte sie sich für ihre Vorurteile und hätte sich am liebsten geohrfeigt. Das war der Tribut von fünf Jahren chirurgischer Tätigkeit in einem der sozialen Brennpunkte der Freien und Hansestadt Hamburg; man dachte zunehmend in Schubladen und Klischees.
Beatrice schnappte sich die einzige noch freie Liege und schob sie den weinenden und schreienden Leuten entgegen.
»Legen Sie sie hier hin«, sagte sie und griff gleichzeitig nach dem Handgelenk der alten Frau, um den Puls zu tasten. Er war schnell und schwach. »Was ist passiert?«
Um sie herum schwirrten die Worte. Beatrice hatte den Eindruck, sich in Bagdad, Kairo oder Tunis auf einem Bazar zu befinden, aber auf eine verständliche Antwort wartete sie vergebens. Sie spürte, wie das Adrenalin ihren Puls allmählich ansteigen ließ.
Hätte die alte Frau gejammert, geschrien, geweint, wäre Beatrice gelassen geblieben. Aber sie lag bleich und erschreckend still auf der Liege und gab trotz des Trubels um sie herum kein Lebenszeichen von sich. Sie reagierte nicht einmal, als Beatrice ihren dünnen, kleinen Körper unter dem weiten orientalischen Gewand schnell abtastete, während Susanne ihren Blutdruck maß.
»Achtzig zu fünfundvierzig«, sagte sie und drückte Beatrice eine Dauerkanüle in die Hand. »Infusion?«
Beatrice nickte, und Susanne bahnte sich ihren Weg durch die Angehörigen, die weinten und wehklagten, als wäre die alte Frau bereits gestorben. Dabei war Beatrice nicht sicher, ob das nicht bald der Fall sein würde. Offensichtlich hatte sie einen Schock, warum und wodurch auch immer.
»Spricht jemand von Ihnen Deutsch?«, fragte Beatrice, während sie an den dünnen Armen nach einer Vene suchte. Am erschrockenen Blick einer etwa vierzigjährigen Frau merkte sie, wie unfreundlich ihre Stimme geklungen haben musste. Noch im selben Moment tat es ihr Leid. Aber was sollte sie machen? Seit mittlerweile fünf Minuten lag diese alte Frau vor ihr. Wertvolle Zeit verstrich, und sie wusste immer noch nicht, was mit ihr los war. Sie konnte sich noch nicht einmal auf die Angaben erfahrener Rettungssanitäter verlassen, weil die Angehörigen die alte Frau selbst ins Krankenhaus gebracht hatten. Vom Herzinfarkt über Darmverschluss bis zum Schädel-Hirn-Trauma war alles möglich. Und sie verstand kein Wort.
»Bitte«, sagte sie und versuchte bewusst ihrer Stimme einen ruhigen und freundlichen Klang zu geben. »Wenn wir der Frau helfen sollen, müssen wir wissen, was passiert ist. Also noch mal: Spricht jemand von Ihnen Deutsch?«
»Ja, ich«, meldete sich der Mann zu Wort, der die alte Frau hereingetragen hatte.
»Gut«, meinte Beatrice erleichtert und richtete ihre Aufmerksamkeit wieder auf die Patientin. Sie hatte eine Vene gefunden und schob ihr die Dauerkanüle in den Handrücken. »Was ist passiert?«
Während sie der alten Frau Blut abnahm, erzählte der Mann in stockenden Worten, dass er seine Mutter nach einer Feier nach Hause fahren wollte, sie aber vor dem Auto auf dem Gehweg ausgerutscht und gestürzt sei. Und da sie nicht mehr aufstehen konnte, hatten sie sie sofort ins Auto getragen und ins Krankenhaus gebracht.
»Das übliche Notfalllabor«, sagte Beatrice zu Susanne, die in diesem Moment mit einem Infusionsständer kam, drückte ihr die Blutröhrchen in die Hand und schloss die Infusionslösung an. Sie war erleichtert. Nun wusste sie endlich, wonach sie zu suchen hatte. Und tatsächlich, als sie mit Susannes Hilfe der alten Frau das knöchellange Kleid ausgezogen hatte, fiel sofort das verkürzte, nach außen rotierte rechte Bein auf.
»Schenkelhalsfraktur?«, fragte Susanne leise.
Beatrice nickte. »Vermutlich.« Sie wandte sich an den Mann. »Ihre Mutter hat sich wahrscheinlich das Bein gebrochen. Außerdem hat sie einen Schock erlitten. Deshalb haben wir sie an den Tropf angeschlossen. Wir müssen jetzt ein paar Untersuchungen durchführen. Wir werden ihr Blut untersuchen, das Bein röntgen und ein EKG machen. Hat Ihre Mutter irgendwelche Erkrankungen? Zum Beispiel Asthma? Diabetes? Bluthochdruck?« Er schüttelte den Kopf. »Nimmt sie regelmäßig Medikamente ein?«
»Nein. Sie ist gesund.«
In diesem Augenblick kam wieder Leben in die alte Frau. Sie bewegte sich und stöhnte vor Schmerzen. Susanne pumpte erneut die Blutdruckmanschette auf.
»Hundertzehn zu sechzig.«
Die Erleichterung war ihr deutlich anzumerken, und auch Beatrice fiel ein Stein vom Herzen – die alte Frau stabilisierte sich wieder. Das Schlimmste war zunächst überstanden.
»Wie heißt Ihre Mutter?«, fragte Beatrice.
»Alizadeh, Mahtab Alizadeh. Aber sie spricht kein Deutsch.«
»Dann übersetzen Sie bitte für mich. Frau Alizadeh?« Die alte Frau schlug die Augen auf und sah Beatrice an. Ihr Blick war getrübt, sicherlich durch die Schmerzen. Sie nahm ihre Hand. »Frau Alizadeh, mein Name ist Dr. Helmer. Wissen Sie, was passiert ist?«
Während ihr Sohn übersetzte, wanderte ihr Blick zwischen ihm und Beatrice hin und her. Die Stimme der Frau war leise, aber obwohl Beatrice kein Wort verstand, hatte sie den Eindruck, dass die Antwort klar und nicht verwirrt war.
»Sie sagt, sie weiß, dass sie ausgerutscht ist und dann nicht mehr aufstehen konnte. Sie hat Schmerzen im Bein.«
»Fragen Sie sie bitte, ob sie noch an anderen Stellen Schmerzen hat.«
»Nein, nur im Bein.«
»Sobald wir die Röntgenbilder haben, kann ich ihr etwas gegen die Schmerzen geben. Ich werde mich dafür einsetzen, dass es nicht zu lange dauert.« Beatrice drückte der alten Frau die Hand und nickte Susanne zu. »Kannst du die Personalien aufnehmen? Ich bringe sie schon mal zum Röntgen.«
Beatrice fuhr die Liege drei Türen weiter, reihte sie in die Schlange der dort wartenden Patienten ein, füllte den Röntgenschein aus und klemmte ihn unter das Kopfende. Dann kehrte sie ins Arztzimmer zurück, wo sie bereits von Heinrich erwartet wurde. Heinrich war derzeit als Student im Praktischen Jahr in der Chirurgie tätig. Er war ziemlich ehrgeizig und nahm sogar freiwillig an den Nachtdiensten teil. Mittlerweile hatte er genug Erfahrung gesammelt, um in weniger schweren Fällen auch selbständig arbeiten zu können. Das war natürlich besonders in Nächten wie dieser eine erhebliche Entlastung. Der Kampf um die einzige freie AiP-Stelle in der Chirurgie war hart. Und Beatrice hoffte, Heinrich würde sie ergattern. Er hatte es sich verdient.
»Was liegt an?« Beatrice setzte sich wieder und nahm einen großen Schluck von dem mittlerweile nur noch lauwarmen Kaffee.
»Fünfunddreißigjähriger Patient, gestürzt, frontale Kopfplatzwunde und Prellmarke. Keine Seitenzeichen, neurologisch weitgehend unauffällig. Er wirkt bewusstseinsgetrübt, was entweder durch den Sturz hervorgerufen sein kann oder aber durch ausgiebigen C2-Abusus.«
»Du meinst, er ist besoffen?«, fragte Beatrice mit amüsiertem Lächeln. Heinrich redete immer, als würde er gerade einen Arztbrief diktieren. »Hast du ihn denn schon röntgen lassen?«
»Ja.« Er klemmte zwei Bilder an den Leuchtkasten. »Schädel in zwei Ebenen. Aber ich weiß nicht ...«
Beim Blick auf die Röntgenbilder verstand Beatrice Heinrichs Unsicherheit. Der Schädel war von mehreren geraden Linien durchzogen, die dort nicht hingehörten. Aber nichts davon war Besorgnis erregend, da es sich ohne Ausnahme um alte Frakturen handelte. Dann sah Beatrice den Namen auf den Röntgenbildern – Andreas Bauer. Und sie wusste sofort, weshalb ihr die Röntgenbilder bekannt vorgekommen waren.
Andreas Bauer war ein Obdachloser, der schon seit einigen Jahren zu den »Stammgästen« der Notaufnahme gehörte. Besonders in der kalten Jahreszeit kam er oft mit Platzwunden, Verstauchungen und Knochenbrüchen. Als Beatrice einmal ihm gegenüber den Verdacht geäußert hatte, dass er sich einige der Verletzungen absichtlich zufügen würde, hatte er gesagt: »Ach, Frau Doktor, wenn ich jetzt da draußen wäre, würde ich sicherlich erfrieren. Was ist dagegen schon ein bisschen Schmerz? Ich weiß doch, dass Sie Ihre Arbeit gut machen und ich bei Ihnen in den besten Händen bin.«
Daran dachte Beatrice, als sie Heinrich erklärte, wie man eine alte von einer frischen Fraktur unterscheiden kann. Es war noch nicht besonders kalt draußen, aber für die nächsten Tage war regnerisches Wetter und sogar Sturm angekündigt worden. Keine schöne Zeit, um im Freien zu schlafen.
Beatrice ging mit Heinrich zu Andreas, um ihn sich anzusehen. Es war zwar unwahrscheinlich, aber sie wollte sicher sein, dass er nicht doch neurologische Ausfälle hatte, die auf eine Schädelblutung hindeuten könnten. Schon beim Öffnen des Vorhangs schlug ihr der Geruch von Alkohol und ungewaschener, wochenlang getragener Kleidung entgegen. Andreas Bauer lag auf der Seite und schnarchte. Wie immer, wenn Beatrice ihn sah, konnte sie sich nur schwer vorstellen, dass er lediglich drei Jahre älter war als sie selbst. Andreas sah aus wie fünfzig.
»Hallo, Andreas! Hörst du mich?«, rief Beatrice, zog sich Gummihandschuhe an und drehte den Obdachlosen auf den Rücken. »Andreas.«
Er grunzte ungehalten, als Beatrice seine Lider hob und ihm mit ihrer Stablampe in die Augen leuchtete. Dann untersuchte sie die Wunde.
»Die Pupillenreaktion ist seitengleich, die Wundränder sind nicht ausgefranst. Sobald ein Behandlungsraum frei wird, kannst du die Wunde säubern und nähen. Aber wir sollten ihn auf alle Fälle über Nacht hier behalten und beobachten. Vielleicht steckt eine Alkoholvergiftung dahinter. Es ist selten, dass er so voll ist. Wahrscheinlich könntest du sogar ohne Lokale nähen.«
Ohne Lokale – das hieß so viel wie keine Spritze zur örtlichen Betäubung. Natürlich hätte sie das auch sagen können. Aber erstens war es so kürzer, und zweitens gehörte es einfach zum Job, das Jonglieren mit Begriffen, die wie eine Geheimsprache die Eingeweihten von den Außenseitern unterschieden. Das lernte man bereits im ersten Praktikum während des Studiums. Und man lernte es schnell, denn als Student wollte man vom ersten Semester an vor allen Dingen eines – dazugehören.
Sie verließen die Kabine und zogen die Vorhänge hinter sich zu. Beatrice streifte sich die Handschuhe von den Händen, warf sie in einen der Mülleimer und kehrte ins Arztzimmer zurück. Dr. Stefan Burmann, einer der Dienst habenden Anästhesisten, stand vor dem Leuchtkasten. Er trug keinen Kittel, sein kurzes dunkles Haar stand struppig zu allen Seiten ab, und auf seiner Nase war deutlich die rote tiefe Kerbe sichtbar, die eine OP-Maske im Gesicht hinterlässt. Rauchend betrachtete er mit zur Seite geneigtem Kopf die Röntgenaufnahmen eines Hüftgelenks.
»Ist das deine Patientin, Bea?«, fragte er mit einem kurzen Blick über die Schulter. »Klassischer Schenkelhals.«
Beatrice stellte sich neben ihn und betrachtete die Röntgenaufnahme. Tatsächlich war die hässliche Bruchkante zwischen Hüftkopf und Oberschenkelknochen unübersehbar.
»Und nun?«, fragte sie und strich sich ein wenig ratlos das blonde Haar aus dem Gesicht. »Endoprothese oder nicht? Sie ist neunundsechzig und damit genau an der Grenze.«
Stefan kratzte sich am Kopf und zerzauste sein Haar dadurch noch mehr.
»Wie ist sie denn zu Wege?«
»Sie ist ziemlich fit. Leitet den Haushalt ihres Sohnes, bekocht die Familie, geht einkaufen, betreut die Enkel und Urenkel – das hat mir der Sohn erzählt. Deswegen hätte ich bei einem Hüftersatz ein schlechtes Gefühl. Sie ist kein altes Mütterchen. Gut, irgendwie schon, aber ... Ich kann das nicht erklären, du müsstest sie dir ansehen.«
Stefan zuckte mit den Schultern. »Keine kardialen oder pulmonalen Probleme? Diabetes?«
Beatrice schüttelte den Kopf. »Nichts dergleichen. Außerdem scheint sie sehr diszipliniert zu sein. Eine von der Sorte, die ohne nachzufragen dreimal vor jeder Mahlzeit auf dem rechten Bein um den Tisch hüpft, wenn der Arzt ihr das sagt. Ich glaube, wir können es wagen, auf die Endoprothese zu verzichten. Aber dann müssen wir jetzt sofort ran, nicht erst morgen. Wie sieht es oben aus? Ist ein OP frei?«
Stefan blies den Rauch zur Decke. »In der Eins kann es noch eine Weile dauern. Aber in der Zwei haben sie gerade mit einer Appendektomie angefangen. Soweit ich weiß, ist bisher nichts weiter geplant. Du kannst also loslegen.«
»Willst du sie prämedizieren?«
Stefan nickte lächelnd. »Klar. Ich wollte schon lange mal wieder mit dir im OP arbeiten.«
Beatrice trank ihren Kaffee aus.
»Dann werde ich jetzt die Angehörigen informieren.«
Sorgfältig, mit schnellen, geübten Bewegungen nähte Beatrice die Operationswunde zu. Die OP-Schwester überprüfte bereits die Tücher und Instrumente auf ihre Vollständigkeit, die Springer-Schwester räumte Wäsche weg, Stefan begann hinter dem Vorhang mit der Ausleitung der Narkose. Die Operation war beendet. Beatrice gab die Pinzette und den Nadelhalter der Schwester und öffnete die Klammern, die die Tücher zusammenhielten, welche zum Abdecken des Operationsfeldes verwendet worden waren. Die Operation war glatt und ohne Zwischenfälle verlaufen. Die alte Frau hatte sich während der Narkose gut gehalten, die Schrauben ließen sich gut im Knochen platzieren und hatten beim Anziehen die beiden Knochenfragmente geradezu lehrbuchmäßig wieder aneinander gefügt.
Beatrice zog sich die Handschuhe aus und ließ sich eine sterile Mullkompresse und zugeschnittenes Pflaster für den Verband geben. Sie war fast traurig, dass es schon vorbei war. Sie operierte leidenschaftlich gern und mochte die Atmosphäre im OP. Das klare weiße Licht der OP-Lampen, die dennoch niemals blendeten; die Geräusche von Beatmungsgerät und EKG, deren gleichmäßiger Rhythmus sowohl beruhigte als auch anregte; der durchdringende Geruch der Desinfektionsmittel – das alles war Teil einer anderen, einer eigenen Welt, die nichts mit dem Stationsalltag gemein hatte. Hier im Operationstrakt war das Kernstück des Krankenhauses, das Allerheiligste. So sahen es zumindest diejenigen, die sich der Chirurgie verschrieben hatten. Hier galten feste Regeln, an denen jeder, vom Hilfspfleger bis zum Chefarzt, akribisch festhielt. Ein OP-Pfleger, von dem Beatrice wusste, dass er in seiner Freizeit Romane schrieb, hatte den OP einmal mit dem höchsten Tempel einer Religion verglichen. Zutritt hatten nur die Gläubigen, die bereit waren, sich den festen Ritualen zu beugen, besondere Kleidung anzulegen, Haupt und Gesicht zu verhüllen, Waschungen durchzuführen und niemals und unter gar keinen Umständen gegen die gottgegebenen Hierarchien zu verstoßen. Nur Uneingeweihte wagten eine Verletzung dieser Regeln, outeten sich damit schnell als Fremdkörper und wurden für immer aus den heiligen Hallen verstoßen. Beatrice hatte damals über diesen Vergleich gelacht. Aber manchmal gab sie dem Pfleger Recht.
Sie trat vom OP-Tisch zurück, zog den blutverschmierten Kittel aus und warf ihn in den Wäschesack.
»Gute Nacht, alle miteinander!«, rief sie den Schwestern zu. »Noch einen ruhigen Dienst.«
»Ach, sehen wir Sie heute gar nicht mehr, Frau Dr. Helmer?«, fragte die OP-Schwester.
»Das will ich doch hoffen«, erwiderte Beatrice lachend und wusste natürlich, dass sie gelogen hatte. Sie hätte jederzeit drei Stunden Arbeit im OP einer Stunde auf Station vorgezogen.
Sie ging zu dem kleinen Tisch, auf dem das Diktiergerät lag. Das Diktieren des OP-Berichts dauerte keine fünf Minuten. Es war eine der lästigen Pflichten, die jedoch unweigerlich mit der Arbeit im OP zusammenhingen. Dann kehrte sie zur Schleuse zurück. Sie hatte es nicht eilig, wieder auf die Station zu kommen. Gemächlich schlenderte sie den stillen, nur spärlich beleuchteten Gang entlang und blickte durch die Fensterfront an seiner linken Seite nach draußen. Große, schwere Tropfen hingen an den Fensterscheiben und spiegelten das Licht der Glühbirne wie kleine Kristalle. Wann mochte es geregnet haben? Um acht Uhr morgens? Zur Mittagszeit? Oder erst am Abend? Sie hatte nichts davon mitbekommen. Jetzt schien der Regen aufgehört zu haben, aber immer noch trieben dichte Wolken über den nächtlichen Himmel und ließen nur vereinzelte Sterne hindurchschimmern. Beatrice zog fröstelnd die Schultern zusammen. Ohne ersichtlichen Grund wurde ihr plötzlich kalt. Schnell berührte sie den automatischen Öffner der OP-Schleuse, und mit einem Zischen schwang die Stahltür zur Seite.
Das grelle Neonlicht im Inneren der Schleuse blendete sie, und für einen Augenblick blieb Beatrice stehen, um sich an die Helligkeit zu gewöhnen. Sie stellte die grünen OP-Clogs zu den anderen Schuhen auf das Regal, zog sich die Strümpfe, die nichts anderes waren als abgeschnittene Schläuche aus Verbandsmull, von den Füßen und warf sie gemeinsam mit OP-Haube und Mundschutz in den Abfalleimer. Als sie sich das weite blaue Hemd über den Kopf zog, fiel etwas aus der Seitentasche und schlug hart auf den gekachelten Boden auf. Beatrice zuckte zusammen und hätte beinahe vor Schreck geschrien. Auf dem Boden lag ein kleiner schimmernder blauer Gegenstand. Sie war sicher, dass er nicht ihr gehörte. Dieses Ding hatte sie noch nie zuvor gesehen. Außerdem steckte sie niemals etwas in die Taschen der OP-Kleidung. Das hatte sie sich abgewöhnt, als sie während ihres praktischen Jahrs eine wertvolle Uhr in der Kitteltasche vergessen hatte. Sie hob den kleinen Gegenstand auf und betrachtete ihn neugierig. Es war ein etwa walnussgroßer Stein, für seine Größe ungewöhnlich schwer, von einem klaren, strahlenden Blau. Eine Seite des Steins sah aus wie poliert, die andere war schroff und zerklüftet, als wäre er zerbrochen. Beatrice suchte den Boden ab. Da sie das fehlende Stück nicht fand, nahm sie an, dass der Stein nicht erst beim Aufprall auf die Fliesen beschädigt worden war. Aber wie mochte er in ihre Tasche gekommen sein? Ob die alte Frau ihr den Stein zugesteckt hatte? Beatrice hatte noch vor Beginn der OP mit Frau Alizadeh gesprochen. Natürlich konnte die alte Frau sie nicht verstehen, aber Beatrice wusste aus Erfahrung, dass allein eine freundliche Stimme, ein Lächeln und ein Händedruck vor Beginn einer Operation eine beruhigende Wirkung auf die Patienten hatte. Der Patient fühlte sich wichtig und ernst genommen, und sie als Chirurgin vergaß nie, wer unter ihrem Messer lag. Frau Alizadeh hatte da auf der Liege besonders verloren ausgesehen, während sich immer wieder neue vermummte Gestalten an ihr zu schaffen machten. Doch als Beatrice mit ihr gesprochen hatte, hatte die alte Frau gelächelt, ihren Arm gestreichelt und Worte auf Arabisch geflüstert. Beatrice hatte sie zwar nicht verstanden, doch es klang freundlich und dankbar. Während dieser paar Minuten musste Frau Alizadeh ihr den Gegenstand in die Tasche gesteckt haben. Vielleicht war es eine Art Glücksbringer? Beatrice legte den Stein in die Mitte ihrer flachen Hand und betrachtete ihn. Irgendwie kam ihr das Ganze bekannt vor. Aber woran erinnerte es sie?
Beatrice blickte erschrocken auf. Das Neonlicht hatte zu flackern begonnen. Sie war eigentlich nicht besonders ängstlich, aber um halb drei Uhr morgens allein in der finsteren Schleuse zu sein, gehörte nicht gerade zu den Dingen, die ganz oben auf ihrem Wunschzettel standen. Doch schon nach wenigen Sekunden beruhigte sich das Licht wieder. Sie atmete erleichtert auf und betrachtete erneut den Stein. Er war schön. Und wie er da so genau in der Mitte ihrer Handfläche lag, sah es aus wie ... Die Hand der Fatima! schoss es Beatrice durch den Kopf. In diesem Moment flackerte das Licht erneut. Doch diesmal beruhigte es sich nicht, sondern das Flackern wurde immer stärker und schneller, bis es schließlich einer Stroboskopleuchte glich und den ganzen Raum in ein bizarres, verzerrendes Licht tauchte. Gleichzeitig begann der Stein von innen heraus zu strahlen, als hätte eine unsichtbare Hand in seinem Inneren eine Kerze angezündet.
Erschrocken wollte Beatrice ihn fortwerfen, doch in dem Flackerlicht kamen ihr die eigenen Bewegungen wie die spastischen Zuckungen einer Irren vor, und sie tat es nicht. Stattdessen blieb sie regungslos mitten im Raum stehen, umgeben von den wilden Lichtblitzen, in der Hoffnung, dass es bald vorbei sein würde. Es wäre ihr lieber gewesen, das Licht wäre völlig erloschen. Ihr Herz begann zu pochen, das Blut rauschte in ihren Ohren, und sie spürte, wie ihr die Angst allmählich die Kehle zuschnürte. Ein Epileptiker hätte in diesem Licht keine dreißig Sekunden ausharren können. Aber selbst ein normales Gehirn musste sich irgendwann der Flut dieser starken visuellen Reize beugen und mit einem schweren Krampfanfall antworten. Sie musste hier unbedingt raus. So schnell wie möglich.
Beatrice sah sich hektisch um. Wo war der Lichtschalter? Wo war die Tür? Zu ihrem Entsetzen musste sie feststellen, dass sie jede Orientierung verloren hatte. Die Schleuse, die sie während der letzten fünf Jahre Tag für Tag aufgesucht hatte, war nicht wieder zu erkennen. Sie hatte sich in ein verwirrendes Labyrinth verwandelt. Das flackernde Licht spiegelte sich in den glatten Kacheln und verzerrte die Dimensionen des Raums, so dass die kleine, kaum acht Quadratmeter große Schleuse plötzlich die Ausmaße eines Ballsaals zu haben schien. Regale und Wäschesäcke mutierten zu grotesken Möbelstücken und Accessoires einer anderen Welt. Vielleicht hatten die Erfinder von Alien auch in so einem Licht gestanden, bevor sie das entsetzliche Monster aus dem All schufen?
Nur die Ruhe bewahren!, ermahnte sich Beatrice und kämpfte gegen die aufsteigende Übelkeit und den allmählich einsetzenden Schwindel an. Du musst bloß den Lichtschalter oder den Türöffner finden, dann kannst du diesem Spuk ein Ende bereiten.
Doch in einem düsteren Winkel ihres Gehirns malte sie sich aus, dass der Lichtschalter nicht funktionieren würde, die Tür sich nicht öffnen ließe, und erst am nächsten Morgen würde man sie finden, mit verkrampften Gliedern und Schaum vor dem Mund ...
Diese Vorstellung reichte, um Beatrice endgültig in Panik zu versetzen. Sie rannte quer durch den Raum, stieß mit dem Knie schmerzhaft gegen ein Regal, warf einen Wäschesack um, fiel hin und verhedderte sich in der OP-Wäsche, die in dem zuckenden Licht ein gespenstisches Eigenleben zu entwickeln schien. Nur mühsam unterdrückte sie einen wilden Schrei des Entsetzens und kämpfte sich aus der kalten Umarmung eines OP-Hemds frei. Auf allen vieren kroch sie voran. Die Übelkeit wurde immer schlimmer. Und zu allem Überfluss begann sich nun auch noch der Raum um sie herum zu drehen, schneller und immer schneller, bis er jegliche Kontur verloren hatte. Beatrice gab es auf weiterzukriechen. Tränen liefen ihr über die Wangen. Sie wusste nicht mehr, wo oben und unten war, sie hatte sogar die Orientierung über ihren eigenen Körper verloren. Sie ballte auf dem Boden kauernd ihre Hand um den blauen Stein zur Faust, der in diesem Wirbel aus Licht und Formen das einzige Fassbare und Ruhende zu sein schien. Beatrice sah noch, wie sich plötzlich eine Tür öffnete, eine Tür, von der sie geschworen hätte, dass sie nicht mehr existierte. Gleißendes Licht flutete über sie hinweg, und der Raum verlangsamte seine Kreisbewegungen. Noch bevor er endgültig zum Stehen kam, verlor Beatrice das Bewusstsein.