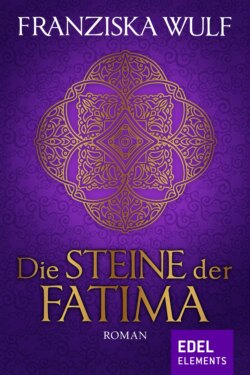Читать книгу Die Steine der Fatima - Franziska Wulf - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
IV
ОглавлениеBeatrice wusste nicht, wie viel Zeit seit ihrem seltsamen Erlebnis in der Schleuse vergangen war. Eine Woche? Vielleicht zwei? Es hätte ebenso gut ein Jahr sein können. Sie, die stets einen kühlen Kopf bewahrte und nie die Fassung verlor, selbst wenn sich im Krankenhaus die Schwerverletzten stapelten, randalierende Patienten im Alkoholentzug handgreiflich wurden und ein Kollege nach dem anderen wegen einer akuten Magen-Darm-Infektion ausfiel. Nicht einmal als Einbrecher ihre gerade wenige Monate zuvor erworbene Wohnung völlig verwüstet hatten, indem sie Möbel umgeworfen und alle Wasserhähne aufgedreht hatten, hatte sie resigniert oder war in eine Depression verfallen. Natürlich hatte sie im ersten Schreck geheult, getobt, geschrien und sich maßlos aufgeregt, aber dann hatte sie die Polizei und die Sachverständigen von der Versicherung angerufen, und als diese ihre Wohnung wegen des Wasserschadens für unbewohnbar erklärten, hatte sie die Ärmel hochgekrempelt und den durchgeweichten Altbau wieder in ein Schmuckstück verwandelt.
Niemals zuvor war sie jedoch in eine Lethargie verfallen, wie sie sie seit ihrem Verkauf durchlebte. Tag und Nacht wechselten einander ab, ohne dass sie dem viel Bedeutung beimaß. Ihre Umgebung nahm sie nur noch schemenhaft wahr. Wo sie war? Egal. Sie fragte sich noch nicht einmal, wer die anderen Frauen waren, woher sie kamen, welches unerfreuliche Schicksal sie hierher geführt hatte. Offensichtlich wohnten sie mit ihr zusammen, und ein- oder zweimal hatte sie sogar versucht eine von ihnen anzusprechen. Aber sie waren vor ihr zurückgewichen, als fürchteten sie, sich mit einer Krankheit zu infizieren. Mittlerweile nahm sie ihre Anwesenheit kaum noch zur Kenntnis. Sie waren da, irgendwo in dem Grau, in das ihre ganze Umgebung versunken war; in lange Gewänder gehüllte Gestalten, die ab und zu wie Traumgebilde aus einer Märchenwelt an ihr vorbeihuschten.
Wie aus weiter Ferne registrierte Beatrice die mageren jungen Mädchen, die sie wuschen und ihr wunderschön bestickte orientalische Kleider anzogen, die sie früher in Begeisterung versetzt hätten. Aber das musste schon sehr lange her sein, vielleicht war es sogar in einem anderen Leben, an das sie sich nur noch bruchstückhaft erinnern konnte. Mechanisch löffelte sie das Essen in sich hinein, das man ihr aus Freundlichkeit, vielleicht auch aus Mitleid hinstellte. Sie schmeckte weder süß noch sauer noch salzig. Nur manchmal, wenn die Speisen besonders scharf gewürzt waren, trieb ihr das Brennen von Pfeffer Tränen in die Augen. Aber auch das war ihr egal. Alles war ihr gleichgültig geworden. Tief in ihrem Inneren hasste Beatrice sich für diese Lethargie. Eine Stimme, die sie an eine junge, engagierte Chirurgin erinnerte, schrie ihr wütend zu, sie solle doch gefälligst ihren Hintern bewegen und endlich etwas tun, irgendetwas. Doch sie hatte keine Kraft, auf diese Stimme zu hören.
Nur einmal, ein einziges Mal in den vielen tristen Tagen hatte etwas sie aufgerüttelt, und für einen winzigen Augenblick war die Trostlosigkeit von ihr abgefallen. Das war, als dieser Mann mit dem komplizierten, arabisch klingenden Namen ihr gesagt hatte, er sei Arzt. Der Gedanke, auf einen Kollegen zu treffen und mit ihm zu sprechen, hatte in ihr von einer Sekunde zur nächsten eine Kraft mobilisiert, an die sie schon gar nicht mehr geglaubt hatte. Plötzlich wollte sie wieder wissen, wo sie war. Und es regte sich in ihr sogar ein Interesse daran, aus dieser völlig verrückten Situation zu entfliehen. Doch dann hatte er seine Instrumente hervorgeholt, ein Sammelsurium merkwürdiger Gegenstände, deren Verwendungszweck sie zum Teil nicht einmal erahnen konnte. Sie sahen zwar neu aus und schienen sauber zu sein, aber sie waren völlig antiquiert, ein Kuriosum, das sie an die medizinhistorische Sammlung eines Museums in Großbritannien erinnerte, das sie während eines Urlaubs besucht hatte. Natürlich würde kein seriöser Arzt mit Instrumenten arbeiten, die vielleicht vor hunderten von Jahren als der Inbegriff des medizinischen Fortschritts gegolten haben mochten – oder aber die Ausgeburt eines sadistisch veranlagten Gehirns waren. Sie war maßlos enttäuscht, und all die Kraft war wieder verpufft, das verzweifelte Aufbäumen ihrer Lebensgeister vorbei.
Das Loch, in das Beatrice nach diesem Erlebnis fiel, war so tief, wie sie es nie für möglich gehalten hätte. Sie lag fast nur noch auf dem weichen, seidenen Bett, das man ihr zugewiesen hatte. Und wenn sie hin und wieder aufstand, hörte sie das Schlurfen ihrer eigenen Schritte auf dem glatten, kalten Boden. Manchmal erschreckte sie dieses Geräusch, denn es klang wie das Schlurfen einer dementen Neunzigjährigen. In diesen kurzen Augenblicken wurde ihr bewusst, dass sie unter einer schweren Depression litt, und sie fragte sich, ob ihre Umgebung, so wie sie sie wahrnahm, vielleicht gar nicht existierte, ob sie sich in Wirklichkeit auf einer Psychiatrischen Station befand. In diesen seltenen und kurzen Momenten schwor sie sich – vorausgesetzt, sie würde jemals wieder in der Lage sein, am normalen Leben teilnehmen zu können –, depressiven Patienten keine Verachtung mehr entgegenzubringen. Diese Menschen gingen durch die Hölle.
Beatrice lag wieder einmal regungslos auf ihrem Bett und starrte an die Decke. Sie dachte nichts, sie fühlte nichts. Immer wieder fuhr sie mit den Augen die Linien der Rosetten ab, mit denen der Baldachin ihres Bettes bestickt war. Irgendwann jedoch drang ein dumpfer Druck im Rücken in ihr Bewusstsein. Der Druck wurde immer stärker, entwickelte sich zu einem ziehenden Schmerz und zwang sie schließlich zum Aufstehen. Vermutlich lag sie schon zu lange in derselben Position, und ihr noch gesunder Körper verlangte nach seinem Recht auf Bewegung. Mühsam erhob sich Beatrice und stieß dabei ihr Frühstück von dem niedrigen Tisch, der zu ihrer Rechten stand. Laut scheppernd fiel das Messingtablett zu Boden. Brot, getrocknete Datteln und in Salzwasser gekochte Linsen rollten auf dem Boden herum. Aber sie nahm es kaum wahr. Sie hatte nicht einmal mitbekommen, dass man ihr wieder etwas zu essen gebracht hatte.
Sie schlurfte zur Tür. Auf dem Gang war so viel Betrieb, dass sogar Beatrice stehen blieb und verwundert die Frauen beobachtete, die wie aufgescheuchte Hühner durcheinander liefen.
Es brennt! Es brennt bestimmt!, alarmierte eine innere Stimme sie. Bring dich in Sicherheit, bevor es zu spät ist!
Aber sie war nicht in der Lage, auch nur ein Glied zu rühren. Wie angewurzelt blieb Beatrice inmitten des Chaos stehen, wurde hin und her geschubst und zur Seite geschoben, bis schließlich eine alte Frau sie zu spät bemerkte und heftig mit ihr zusammenstieß. Die Alte, zahnlos und mit hundert Falten im Gesicht, schrie und schimpfte, während über ihre Wangen Tränen liefen. Ihre Augen waren gerötet, als würde sie bereits seit Stunden weinen. Sie bedachte Beatrice mit einem Schwall arabischer Wörter und eilte dann laut jammernd und klagend davon.
Vielleicht ist jemand gestorben, dachte Beatrice und hielt sich ihre Rippen, die von den spitzen Knochen der Alten getroffen worden waren. Möglicherweise war das hier aber tatsächlich nur der ganz normale Alltag einer psychiatrischen Station. Die Frauen, die kopflos umherliefen, waren nichts anderes als ihre Mitpatientinnen, jede von ihnen gefangen in ihrem eigenen Wahnsinn. Und sie selbst bemerkte dieses Chaos nur deshalb erst jetzt, weil endlich die Therapie anschlug und die Antidepressiva, die man ihr sicherlich verabreichte – auch wenn sie sich dessen nicht bewusst war –, zu wirken begannen.
Beatrice schüttelte den Kopf und ging weiter. Mehrfach wurde sie angerempelt, aber nur selten schimpfte eine der Frauen. Die meisten schienen andere Sorgen zu haben und sie gar nicht wahrzunehmen. Schließlich kam sie zu einem Raum, aus dem lautes Stöhnen und Weinen zu hören war. Die Tür stand weit offen, und ohne dass Beatrice so recht hätte sagen können, weshalb, blieb sie stehen und schaute hinein. Sie sah in einen Schlafraum. Auf dem breiten, luxuriösen Bett lag eine junge Frau. Ihr Gesicht war erschreckend bleich und hatte einen bläulichen Unterton. Gequält wand sie sich und warf den Kopf hin und her, und sogar Beatrice vernahm deutlich ihre mühsamen, pfeifenden Atemzüge. Neben dem Bett kniete ein dicker Mann mit einem Turban auf dem Kopf, und Beatrice schien es, als hätte sie ihn schon irgendwann einmal gesehen. Vermutlich war die junge Frau seine Tochter, denn zärtlich hielt er ihre Hand fest, und auf seinem runden Gesicht zeichnete sich deutlich die Angst um sie ab. Sie waren umringt von etwa einem halben Dutzend Frauen, die laut weinten und jammerten. Aber so sehr sie alle das Schicksal der jungen Frau beklagten, niemand schien in der Lage zu sein, ihr zu helfen.
Ohne darüber nachzudenken, ging Beatrice in den Raum hinein. Immer deutlicher konnte sie die pfeifenden Atemzüge hören. Es klang, als steckte ein Fremdkörper in der Luftröhre der jungen Frau. Weshalb merkte das keiner? Weshalb war kein Arzt da, der den lebensrettenden Luftröhrenschnitt vornehmen und dann den Fremdkörper entfernen konnte? Instinktiv wollte sie an das Bett der Kranken treten, als hinter ihr schnelle, schwere Schritte und eine laute Stimme erklangen. Unsanft wurde sie beiseite gestoßen, so dass sie zu Boden fiel. Mühsam rappelte sie sich wieder auf und erstarrte. Er war es! Der Mann, der sie eben zu Boden gestoßen hatte, war kein anderer als der Kerl, der von sich behauptet hatte, Arzt zu sein.
Er eilte an das Bett, warf einen kurzen Blick auf die Patientin und stellte seine Tasche ab. Während er die Ärmel seines langen orientalischen Gewands hochkrempelte, scheuchte er mit herrischer Stimme die Frauen aus dem Zimmer. Dann begann er auf den Mann mit dem Turban einzureden. Sanft, aber bestimmt packte er ihn bei den Schultern und führte auch ihn hinaus. Nur Beatrice, die immer noch am Boden hockte, schien er nicht zu bemerken.
Als alle anderen das Zimmer verlassen hatten, schloss er die Tür hinter sich zu und setzte sich zu der Kranken ans Bett. Er betrachtete sie eine Weile, und Beatrice hörte ihn seufzen. Endlich begann er die junge Frau abzutasten. Dabei schüttelte er immer wieder den Kopf, als könnt er sich ihren Zustand nicht erklären oder wüsste nicht, was zu tun sei. Mittlerweile war das Gesicht der Patientin wirklich blau angelaufen, ihre Bewegungen wurden immer schwächer.
Während Beatrice zusah, wie der vermeintliche Arzt seine antiquierten Instrumente auspackte, stieg ein Gefühl in ihr hoch, von dem sie eigentlich geglaubt hatte, dass es nicht mehr existierte – sie wurde wütend. Es trieb ihr die Wärme ins Gesicht und brachte ihr Blut in Wallung. Dieser Quacksalber, dieser Scharlatan! Die junge Frau brauchte eine Koniotomie, sie brauchte Sauerstoff. Stattdessen sah er untätig zu, wie sie qualvoll erstickte. Als er sichtlich unschlüssig nach einem seiner seltsamen Instrumente griff, war es mit Beatrices Geduld vorbei. Wütend sprang sie auf.
»Das kann doch nicht wahr sein!«, rief sie aus und schubste den verdutzten Mann zur Seite. »Lassen Sie mich mal ran!«
Ein Blick auf die ausgebreiteten Instrumente sagte ihr, dass nichts von dem, was sie brauchen würde, zur Verfügung stand – weder Spiegel noch Stablampe, Stethoskop oder ein vernünftiges Skalpell mit steriler Klinge, nicht einmal eine dicke Kanüle war vorhanden, und von einem Endotrachealkatheter, den sie in die Luftröhre schieben konnte, ganz zu schweigen. Beatrice stieß einen kurzen Seufzer aus. Sie würde improvisieren müssen. Aber es war nicht das erste Mal. Als Chirurg lernte man sehr schnell, kreativ zu sein. Wenn während einer Operation Schwierigkeiten auftauchten, wegen unvorhergesehener anatomischer Besonderheiten zum Beispiel, war man gezwungen, rasch zu handeln und Ideen zur Lösung der Probleme zu entwickeln. Für Beatrice war das sogar der besondere Reiz an ihrer Arbeit. Wer sich daran nicht gewöhnen konnte und immer nur nach Lehrbuch arbeiten wollte, sollte lieber Labormediziner werden. So jemand hatte in der Chirurgie nichts verloren.
Rasch sah Beatrice sich um. Ihr Gehirn arbeitete so schnell und präzise, als hätte sie niemals unter Depressionen gelitten. Innerhalb weniger Sekunden hatte sie alles gefunden, was sie brauchte. Ein blitzblank geputzter kleiner Silberlöffel konnte ihr als Spiegel dienen; das kleine Messer, das neben einer Schale mit Orangen lag, war sicher scharf genug für die Koniotomie und machte einen zuverlässigeren Eindruck, als die seltsamen gebogenen Skalpelle des Quacksalbers; ein Gänsekiel, etwas dicker als ein Bleistift, konnte vorübergehend den Endotrachealkatheter ersetzen. Allerdings würde sie ihn ein wenig kürzen und vor allem desinfizieren müssen. Ihr Blick fiel auf eine kleine Öllampe. Gut. An der Flamme konnte sie die Instrumente wenigstens notdürftig sterilisieren.
Sie wandte sich erneut der jungen Frau zu, deren Lippen mittlerweile fast die Farbe von Veilchen hatten. Hoffentlich ist es nicht zu spät, dachte Beatrice und legte der Patientin beruhigend eine Hand auf die schweißnasse Stirn. Die junge Frau sah sie angstvoll mit weit aufgerissenen dunklen Augen an. Das lange schwarze Haar klebte wie eine Badekappe an ihrem Kopf. Ihr Brustkorb hob und senkte sich in der verzweifelten Anstrengung, Luft in die Lungen zu pumpen.
Beatrice öffnete den Mund der Kranken und schob ihr ganz vorsichtig den Löffel bis zum Rachen. Sie konnte nicht viel sehen, da das einfallende Licht schwach war. Außerdem begann die junge Frau sich zu wehren und zu würgen, so dass Beatrice den Löffel wieder zurückziehen musste. Aber dank ihrer Erfahrung hatten ihr die wenigen Sekunden ausgereicht, um den Fremdkörper zu entdecken, der ziemlich weit oben quer im Rachen steckte und die Luftröhre zum Teil verlegte. Offensichtlich hatte anfangs noch ausreichend Luft vorbeiströmen können, doch der Fremdkörper reizte das umliegende Gewebe, das mittlerweile ziemlich angeschwollen war. Falls diese Schwellung weiter zunahm, und das war zu befürchten, war es nur noch eine Frage von Minuten, bis die junge Frau gar keine Luft mehr bekam.
Als hätte sie zeit ihres Lebens nichts anderes getan, entfernte Beatrice den Flaum vom Federkiel, kürzte ihn mit dem kleinen, erfreulich scharfen Obstmesser ein und hielt ihn einen Moment an in die rußende Flamme der Öllampe. Dann erhitzte sie noch das Obstmesser.
Der Arzt stand regungslos daneben, als wäre er zu Stein erstarrt. Erst als Beatrice den Hals der Patientin abtastete, kehrte das Leben in ihn zurück. Mit einem Aufschrei stürzte er sich auf Beatrice, als fürchtete er, sie wäre imstande, der jungen Frau die Kehle durchzuschneiden. Er packte ihren Arm und versuchte ihr das Obstmesser zu entreißen, doch Beatrice gelang es, ihn von sich zu stoßen.
»Was fällt Ihnen ein!«, rief sie erbost. »Wegen Ihrer Unfähigkeit ist sie in einem jammervollen Zustand. Und wenn Sie nicht wollen, dass sie stirbt, dann lassen Sie mich gefälligst meine Arbeit tun!«
Die Patientin kam ihr zu Hilfe. Mit leiser, fast völlig erstickter Stimme sagte sie etwas, und der Arzt wich zähneknirschend einen Schritt zurück. Die junge Frau legte Beatrice eine Hand auf den Arm. Die Angst vor dem Unbekannten, das auf sie zukam, war ihr deutlich anzusehen. Dennoch lächelte sie Beatrice zu und schloss vertrauensvoll die Augen.
Behutsam tastete Beatrice den Hals der Kranken ab, um die richtige Stelle für die Koniotomie zu finden. Die junge Frau zuckte vor Schmerz zusammen, als Beatrice das Messer ansetzte und mit einem kleinen, raschen Schnitt einen Zugang zur Luftröhre schaffte. Ruhig, mit geübten Griffen schob sie den Gänsekiel in die Öffnung. Hörbar strömte die Luft in die Trachea, und fast im gleichen Augenblick war der jungen Frau die Erleichterung anzumerken. Ihr Gesicht bekam wieder etwas Farbe, und zaghaft lächelte sie. Aber Beatrice war noch nicht fertig. Der Fremdkörper musste noch entfernt werden, bevor die zunehmende Schwellung dies unmöglich machte und eine Verletzung oder Infektion riskiert wurde. Sie winkte den Arzt zu sich heran, der fassungslos und staunend seine Patientin anstarrte, die mit dem Gänsekiel im Hals atmete und der es von Minute zu Minute sichtlich besser ging.
»Kommen Sie, Herr Kollege. Halten Sie mal die Lampe, damit ich etwas sehen kann.«
Ungeduldig drückte sie ihm die Öllampe in die Hand, wählte unter den Instrumenten eine kleine, leicht gebogene Zange aus, die ihr brauchbar erschien, und öffnete mit sanftem Griff wieder den Mund der Patientin.
Beatrice schwitzte, als sie mit dem silbernen Löffel als Spiegelersatz und der museumsreifen Zange bei erbärmlichen Lichtverhältnissen im Rachen der jungen Frau herumwerkelte. Sie konnte sich nicht daran erinnern, jemals in ihrer medizinischen Laufbahn unter solch katastrophalen Umständen einen Eingriff vorgenommen zu haben. Die arme Frau keuchte und stöhnte, sie würgte und verkrampfte sich, Tränen liefen über ihre Wangen, und Beatrice wünschte sich nichts sehnlicher, als ein wenig Lokalanästhetikum, um ihrer Patientin diese Prozedur zu erleichtern. Endlich bekam sie den Fremdkörper mit der Zange zu fassen und zog ihn mit einer leichten Drehung vorsichtig hinaus. Noch einmal würgte die junge Frau, dann war es vorbei.
»Hier haben wir den Übeltäter! Ein Dattelkern«, sagte Beatrice und wischte sich erleichtert den Schweiß von der Stirn. Der Eingriff konnte höchstens ein paar Minuten gedauert haben, ihr kam es wie eine Ewigkeit vor. Und sie wagte nicht sich vorzustellen, was die Patientin durchgemacht haben mochte.
Beatrice drückte dem Arzt den Dattelkern in die Hand und wandte sich wieder ihrer Patientin zu. Die junge Frau weinte und war sichtlich erschöpft, aber sie atmete ganz normal durch Mund und Nase. Gierig sog sie die Luft in ihre Lungen. Sie lächelte Beatrice zu, drückte ihre Hand und murmelte immer wieder dieselben Worte
»Schon gut«, sagte Beatrice in der Annahme, dass die Frau sich bedanken wollte. »Versuchen Sie jetzt ein wenig zu schlafen. Mein Kollege wird bei Ihnen bleiben.«
Sie erhob sich und wandte sich an den Arzt, der immer noch fassungslos den Kopf schüttelte und nicht zu begreifen schien, weshalb die Patientin noch am Leben war. Beatrice kochte vor Wut.
»Und nun zu Ihnen, Herr Kollege!«, sagte sie leise, so dass die junge Frau sie nicht hören konnte. »Ist Ihnen klar, was Sie da eben getan haben? Sitzen da und rühren keinen Finger. Das Mädchen hätte ersticken können! Haben Sie schon mal etwas von der Koniotomie gehört? Vermutlich nicht. Und so etwas nennt sich Arzt!« Sie seufzte und strich sich das Haar aus dem Gesicht. »Nun, da Sie offensichtlich mit dieser Situation überfordert sind, werde ich Ihnen sagen, was zu tun ist. Sie werden die Patientin beobachten. Und wenn in der nächsten Stunde keine Komplikationen aufgetreten sind, können Sie den Gänsekiel entfernen und den Schnitt nähen. Außerdem geben Sie ihr etwas Abschwellendes zum Gurgeln. Dazu werden Sie doch hoffentlich in der Lage sein?«
Damit ließ sie ihn stehen. Erst als sie wieder in ihrem eigenen Zimmer war, fiel ihr ein, dass er sie vermutlich gar nicht verstanden hatte.
Am nächsten Morgen wurde Beatrice von leisen Geräuschen in ihrem Zimmer geweckt – dem Klappern von Metallschüsseln, dem Plätschern von Wasser. Sie schlug die Augen auf und erblickte über sich einen reich bestickten Baldachin aus schwerem sandfarbenem Stoff, der sich über ihrem breiten Bett spannte. Beatrice hatte den Eindruck, schon lange nicht mehr so gut geschlafen zu haben wie in dieser Nacht. Genüsslich räkelte sie sich auf den Laken, die sich anfühlten wie Seide, und streckte ihre Glieder. Dieses Bett mit den weichen, nach exotischen Blüten duftenden Kissen war so bequem, dass sie nicht den Wunsch hatte, es so bald zu verlassen. Und eines war sicher: So verrückt die ganze Geschichte auch klang, sie musste wirklich ein Opfer von Sklavenhändlern geworden sein, denn dieses luxuriöse Bett gehörte niemals in das Krankenzimmer einer psychiatrischen Station.
Erleichtert über diese Erkenntnis, beobachtete sie ein junges Mädchen, das Wasser in ein großes Messingbecken goss. Ihre langen schwarzen Haare wurden von einem seidenen Band aus dem schmalen, hübschen Gesicht gehalten. Sie trug ein schlichtes knöchellanges Kleid, das in der Taille von einem Gürtel zusammengehalten wurde. Der einzige Schmuck bestand aus einem massiven goldenen Reif um ihren rechten Oberarm. Wie alt mochte sie wohl sein? Ihren dünnen Ärmchen nach zu urteilen war die Kleine höchstens elf. Aber ihre Bewegungen hatten die Sicherheit einer erwachsenen Frau. Und auch sie war niemals Angestellte einer psychiatrischen Klinik.
Als das Mädchen fertig war, trat sie zu Beatrice an das Bett. Sie lächelte und schien sich offenbar ehrlich zu freuen, dass es Beatrice besser ging. Die arabischen Worte sprudelten nur so aus ihr heraus, und es dauerte eine Weile, bis Beatrice begriff, dass die Kleine ihr beim Aufstehen behilflich sein wollte.
Aber Beatrice schüttelte den Kopf, warf das Laken zur Seite und schwang sich aus dem Bett. Das Mädchen folgte ihr zu dem Messingbecken, entkleidete sie und begann sie mit einem Schwamm abzuwaschen.
Beatrice schloss die Augen. Das Wasser duftete nach Rosen und hinterließ auch nach dem Abtrocknen das Gefühl von Reinheit und Frische auf ihrer Haut. Aber das Schönste war, dass sie sich wieder wie ein lebender, atmender Mensch und nicht mehr wie ein Geist fühlte.
Beatrice sah sich in ihrem Zimmer um, als hätte sie es noch nie zuvor gesehen. In der Tat hatte sie bisher weder die niedrigen Tische noch die Truhen mit den kunstvollen Schnitzereien, die Messingvasen oder Öllampen beachtet, die das Herz eines jeden Kunst- und Antiquitätenliebhabers hätten höher schlagen lassen.
Wie abgestumpft muss ich gewesen sein!, dachte sie erstaunt und ließ sich von dem Mädchen beim Anziehen helfen. Das Kleid, das die Kleine ihr reichte, war ein Traum aus einem hellblauen, im Licht silbern schimmernden Stoff. Es war lang, weit und ärmellos, und in allen Farben schillernde Steine verzierten den Ausschnitt. Die gleichen Steine fanden sich auch auf dem schmalen Gürtel und den flachen seidenen Pantoffeln wieder, die das Mädchen ihr reichte. Als sie fertig angezogen war, kam sie sich vor wie eine Prinzessin aus Tausendundeine Nacht.
Beatrice schüttelte verwundert den Kopf. Tage-, vielleicht sogar wochenlang hatte sie in tiefster Depression vor sich hinvegetiert. Nichts von der beeindruckenden Schönheit um sich herum hatte sie wahrgenommen. Erst die Wut über den unfähigen Kollegen und die Arbeit an der Patientin hatten es geschafft, sie aus dieser fürchterlichen Lethargie herauszureißen und ihr die Augen zu öffnen. Sie hatte nie gewusst, wie sehr sie ihre Arbeit brauchte.
Wie es wohl der Patientin gehen mochte? Ob der Arzt sich an ihre Anweisungen gehalten hatte? Beatrice wollte gerade das Mädchen nach ihr fragen, da klopfte es an der Tür. Ein anderes Mädchen, ebenso klein und dünn, trat herein. Sie sprach Beatrice an und gab ihr mit Gesten zu verstehen, mit ihr zu kommen. Ohne lange darüber nachzudenken, folgte sie ihr.
Als sie den Gang vor ihrer Zimmertür betrat, hielt sie erneut überwältigt inne. Sie stand auf einer Galerie, wie sie sie bisher nur in Filmen gesehen hatte. Zierliche Säulen und Bögen bildeten jeweils in Dreiergruppen ein Fenster. Diese Fenster waren jedoch nicht verglast, sondern ein Gitter aus kunstvoll geschnitztem und gedrechseltem Holz ließ Licht und Luft in den Gang hinein. Durch das Gitter hatte man einen freien Blick in einen blühenden Garten voller exotischer Blumen und Obstbäume, deren betörender Duft bis zu ihnen hinaufdrang. Wasser plätscherte aus golden schimmernden Rohren in mit farbenfrohen Mosaiken ausgelegten Brunnen. Zwei orientalisch gekleidete junge Männer, beide dunkelhaarig und hübsch, gingen, ins Gespräch vertieft, durch den Garten. Da hörte Beatrice leises Gekicher. Sie blickte auf und sah zu ihrer Linken vier junge Frauen, die sich ebenso wie sie selbst an das Gitter gestellt hatten und die beiden jungen Männer beobachteten. Ohne auch nur ein Wort Arabisch zu verstehen, war Beatrice klar, worüber die vier sprachen. Sie schwärmten von den beiden dort unten, regten sich gegenseitig zu Fantasien an und schienen es über die Maßen zu genießen, dass sie zwar die beiden sehen konnten, die jungen Männer jedoch von ihren Beobachtern nichts wussten.
Lächelnd folgte sie dem Mädchen. Es gab doch Verhaltensweisen, die bei allen Kulturen gleich waren. Während sie weiterging, begegnete sie vielen Frauen – alten und jungen, hübschen und hässlichen. Sie hatten alle orientalische Kleider an, und ihre langen Haare waren zu kunstvollen Frisuren geflochten. Keine von ihnen trug europäische Kleidung oder hatte die Haare modern kurz oder doch wenigstens halb lang geschnitten. Außerdem begegnete sie keinem einzigen Mann.
Aha, dachte Beatrice amüsiert. Da bin ich wohl in einen Harem geraten.
Das Mädchen führte sie zu einem Zimmer, das auf der gegenüberliegenden Seite der Galerie lag. Es klopfte an die schwere Tür, öffnete einen der Flügel und ließ Beatrice eintreten.
Eine junge Frau kam ihr mit ausgestreckten Armen entgegen, ergriff ihre Hände und küsste sie zur Begrüßung auf beide Wangen. Erstaunt erkannte Beatrice ihre Patientin wieder. Offenbar hatte sie sich innerhalb der wenigen Stunden gut erholt. Nur ein feiner Schal, den sie um den Hals trug, ließ erahnen, was sie gestern durchgemacht hatte. Die junge Frau führte Beatrice zu einem niedrigen Tisch, drückte sie auf eines der weichen Polster hinunter und setzte sich neben sie. Sie schenkte Wasser in ein Glas ein, reichte es Beatrice und bot ihr nach Mandeln duftendes Gebäck an. Die junge Frau sprach Lateinisch und nach einer Weile verstand Beatrice, dass sie Mirwat hieß und ihr offenbar danken wollte.
Beatrice sah sich den kleinen Schnitt an. Er war sauber vernäht, und der Arzt hatte ihn mit einer seltsamen, nach Kräutern duftenden Paste bestrichen. Auch wenn sie diese mittelalterliche Methode insgeheim belächelte, so sah die Wunde doch gut aus und schien sich nicht infiziert zu haben. Beatrice war erstaunt, wie schnell ihr das Latein wieder einigermaßen geläufig wurde, obwohl sie seit ihrem Abitur kaum noch damit zu tun gehabt hatte. Dennoch war es auf Dauer mühsam. Mirwat merkte schnell, dass die Unterhaltung Beatrice anstrengte. Als sie sich nach etwa einer Stunde voneinander verabschiedeten, sagte sie: »Morgen kommst du wieder zu mir. Ich werde beginnen dich in unserer Sprache zu unterrichten.«
Erfreut stimmte Beatrice zu. Die junge Frau mit den lebhaften dunklen Augen war ihr sympathisch. Außerdem lagen ihr Tausende von Fragen auf der Seele – und Mirwat kannte vielleicht die Antworten.