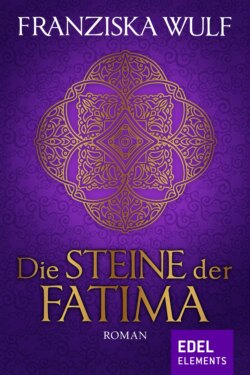Читать книгу Die Steine der Fatima - Franziska Wulf - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
II
ОглавлениеDas leise, unverständliche Gemurmel vieler Stimmen in weiter Ferne drang in Beatrices Bewusstsein. Sie klangen gedämpft, und für einen Augenblick fragte sie sich, ob sie sich vielleicht Watte in die Ohren gestopft hatte. Aber nein, das war unwahrscheinlich. Sie hasste das Gefühl von Fremdkörpern im Ohr und benutzte deshalb niemals Lärmstops oder ähnliche Dinge. Sie trug noch nicht einmal Ohrringe. Aber wieso hörte sie dann nicht deutlich, was um sie herum vorging? Und warum lag sie mit geschlossenen Augen auf dem Rücken? Ihr Dienst war doch noch lange nicht vorbei. Oder träumte sie vielleicht? Lag sie zu Hause in ihrem weichen Bett, und die gedämpften Geräusche waren nichts anderes als die Stimmen ihrer Nachbarn, die mal wieder eine lautstarke Auseinandersetzung mit ihrem sechzehnjährigen Sohn hatten? Dann fiel ihr endlich ein, was in der Schleuse passiert war, und allmählich gelangte sie zu der Erkenntnis, dass sie gerade aus einer Bewusstlosigkeit erwachte. Allerdings lag sie nicht mehr auf dem kalten, harten Kachelboden der Schleuse. Also mussten die Kollegen sie gefunden und woandershin gebracht haben. Aber wohin? Beatrice hatte keine Lust, die Augen zu öffnen und sich einfach umzusehen. Zu sehr genoss sie es, nach diesem langen und anstrengenden Dienst einfach nur dazuliegen und abzuwarten. Also begann sie zu raten.
Der Untergrund, auf dem sie lag, war nicht besonders weich, aber er gab nach, und bei jeder noch so kleinen Bewegung knisterte es unter ihr, als würde sie auf einem Strohsack liegen. Das war natürlich Unsinn. Wahrscheinlich handelte es sich um das Kunstleder einer Liege, das unter ihrem Gewicht ächzte und knarrte. Natürlich! Die Kollegen mussten sie auf die Aufnahmestation gebracht haben, um sie zu untersuchen.
Das führte sie zur Kernfrage: Was war mit ihr los? War sie verletzt? Hatte sie den von ihr befürchteten epileptischen Anfall erlitten, oder war sie einfach nur ohnmächtig geworden? Beatrice überprüfte ihre Körperfunktionen und war erleichtert – was auch immer mit ihr los war, sie hatte wenigstens keine Schmerzen. Und da sie Gefühl in allen Gliedern hatte und sich bewegen konnte, war es unwahrscheinlich, dass man ihr ein schmerzstillendes Medikament gegeben hatte. Allerdings spürte sie auch nicht die Manschette eines Dauerblutdruckmessgeräts um ihren Oberarm oder die Klebeelektroden von EKG und EEG auf ihrer Haut. Sie hatte, wie es schien, noch nicht einmal eine Kanüle in ihrem Arm, über die ihr eine Infusion gegeben wurde. Wieso waren die Kollegen nur so nachlässig? Oder lag sie erst seit wenigen Sekunden auf der Aufnahmestation, und hörte sie gerade die Anweisungen, die ein Kollege den Schwestern gab? Beatrice versuchte sich auf die Stimmen zu konzentrieren, um Genaueres zu erfahren, und tatsächlich wurden sie deutlicher. Verwirrt stellte sie fest, dass es sich ausnahmslos um weibliche Stimmen handelte. Das war merkwürdig, denn auf der Aufnahmestation war sie zurzeit die einzige Ärztin. Und noch etwas war seltsam. Sie konnte die Worte zwar deutlich hören, verstand aber ihren Sinn nicht.
Als Beatrice eine plausible Erklärung dafür einfiel, begann ihr Herz schneller zu schlagen, und ihr Mund wurde staubtrocken. Ob sie etwa an einer Aphasie litt, einer durch einen Schlaganfall verursachten Sprachstörung? Sie kannte sich zwar in der Neurologie nicht besonders gut aus – diesen komplizierten Bereich der Medizin überließ sie lieber den Fachkollegen – aber sie glaubte sich noch aus dem Studium daran zu erinnern, dass eine derartige Reizüberflutung, wie sie sie in der Schleuse erlebt hatte, unter Umständen zu einem Hirninfarkt führen konnte. Vielleicht lag sie sogar schon auf einer Neurologischen Station, und die weiblichen Stimmen gehörten zu Patientinnen, die mit ihr das Zimmer teilten? So sehr sie die Ungewissheit und ihr Ratespielchen eben noch genossen hatte, so sehr quälte es sie jetzt. Sie musste wissen, was mit ihr los war. Dennoch wagte Beatrice nicht, die Augen zu öffnen, da sie die Gewissheit fürchtete. Stattdessen versuchte sie sich noch mehr auf die Stimmen zu konzentrieren. Und tatsächlich merkte sie nach einigen Minuten, dass es sich offensichtlich um eine andere Sprache handelte. Dem Klang nach zu urteilen sprachen die Frauen Arabisch.
»Halleluja! Ich habe keinen Insult!«, sagte Beatrice aus vollem Herzen. Dann schlug sie die Augen auf – und war für einen Moment sprachlos.
Ein schwaches rötliches Licht schien in etwa ein halbes Dutzend Gesichter, die sich über Beatrice beugten und sie neugierig anstarrten. Es waren Frauen, daran hatte Beatrice keinen Zweifel. Aber wie sahen sie aus! Ihre Haare waren struppig und rochen, als wären sie vor langer Zeit das letzte Mal gewaschen worden. Alle hatten ein auffällig schlechtes Gebiss. Bei einigen waren die Zähne nur schief, bei anderen standen sie jedoch so weit vor, dass sie den Mund nicht mehr schließen konnten, und manche hatte gar keine Zähne mehr. Es machte den Eindruck, als hätten diese Frauen noch nie etwas von Zahnärzten und Kieferorthopäden gehört. Dabei würde in solch schweren Fällen doch sicherlich auch das Sozialamt die Behandlungskosten übernehmen. Dann fiel Beatrice eine Frau auf, die offensichtlich unter einer bakteriellen Bindehautentzündung litt. Ein Auge triefte vor Eiter, und das andere war bereits deutlich gerötet. Wenn sie nicht bald ärztliche Hilfe bekam, würde sie ohne Zweifel erblinden, und Beatrice fragte sich, warum man dieser armen Kreatur nicht einfach ein paar antibiotische Augentropfen gab. Außerdem stank es so absurd nach Schweiß, Kot und Urin, dass Beatrice glaubte sich übergeben zu müssen. Wo um alles in der Welt war sie hingeraten? Diese verwahrlosten Frauen erinnerten sie an Der Name der Rose und ähnliche Filme, die sie im Kino und Fernsehen gesehen hatte. Sie schauten aus, als wären sie geradewegs dem Mittelalter entsprungen. Aber das konnte ja wohl kaum sein. Wo also war sie? Andere Filme fielen ihr ein, Wes Cravens Haus der Vergessenen Kinder zum Beispiel. War sie vielleicht in einer Art geheimen Irrenanstalt gelandet, die einer der Professoren in den Kellerräumen des Krankenhauses zu seiner eigenen Belustigung eingerichtet hatte? Nun, auch das war natürlich Unsinn, die Ausgeburt eines ängstlichen, fantasiebegabten Hirns. Wahrscheinlich war die Lösung des Rätsels ganz einfach – sie lag zu Hause in ihrem Bett. In einigen Minuten würde ihr Wecker klingeln. Sie würde aufwachen, erleichtert sein und über sich selbst lachen. Aber gab es derart lebhafte Träume, in denen Geräusche, Farben und Gerüche so intensiv waren, als wären sie real?
Während Beatrice darüber nachdachte, unterhielten sich die Frauen leise, als wüssten sie nicht genau, was sie mit ihr anfangen sollten. Sie wirkten scheu, fast ängstlich. Nur eine von ihnen, ein etwa fünfzigjähriges Weib, das besonders schmutzig und verwahrlost aussah, schien sich nicht zu fürchten. Mit ihrer grässlichen schrillen Stimme schimpfte sie die anderen aus. Die Alte grinste hämisch und näherte sich Beatrice, so dass sie ihren feuchten, nach Fäulnis stinkenden Atem auf ihrem Gesicht spürte. Unfähig, auch nur ein Glied zu rühren, starrte sie in einer Mischung aus Ekel und Faszination auf die schwarzen, von Karies zerfressenen Zähne im Mund der Alten, von denen dieser Gestank ausging. Wie konnte ein Mensch mit solchen Stummeln kauen? Musste sie nicht elendig verhungern? Oder ernährte sich die Alte nur noch von Suppen und Brei?
Erst als das alte Weib Beatrice mit ihren schmutzigen Händen anzutatschen begann, kam wieder Leben in sie. Diese schwieligen Hände mit den schwarzen, teils abgebrochenen, teils viel zu langen Fingernägeln auf ihrem Körper zu fühlen war einfach zu viel, selbst für einen Traum.
Beatrice schrie vor Ekel und Entsetzen laut auf, fuhr hoch und erwartete, nun endlich wieder wach zu sein und in ihrem Bett zu sitzen. Aber nichts dergleichen geschah. Was für ein hartnäckiger Traum! Die Frauen, die ebenfalls vor Schreck laut kreischend zurücksprangen, als hätten sie nicht erwartet, dass Beatrice noch lebte, umringten sie immer noch. Also kroch Beatrice auf allen vieren rückwärts, bis sie etwas Hartes in ihrem Rücken spürte, an das sie sich anlehnen konnte. Es war kalt und feucht und glitschig, das spürte sie deutlich durch den Stoff ihrer Kleidung hindurch. Dennoch wagte sie es nicht, sich umzudrehen und dabei die Frauen aus den Augen zu lassen. Sie näherten sich ihr wie eine Meute hungriger Löwen einer einzelnen Gazelle. Beatrices Herz klopfte wie ein Dampfhammer. Gleich würden sie sie erreicht haben und sich auf sie stürzen. Verzweifelt tastete sie den Boden nach etwas ab, mit dem sie sich verteidigen konnte. Aber sie fand nur Stroh, Stroh und ... Beatrice weigerte sich, länger über die Herkunft jener weichen Masse nachzudenken, die ihre Finger für den Bruchteil einer Sekunde berührt hatten. Was sollte sie nur tun? Konnte man im Traum sterben? Vielleicht würde sie dann ja endlich aufwachen.
Doch in dem Augenblick, als Beatrice sich in ihr unausweichliches Schicksal ergeben wollte, erklang die laute, herrische Stimme eines Mannes. Mit der kurzen Peitsche in seiner Hand teilte er wahllos Schläge nach rechts und links aus. Heulend und kreischend sprangen die Frauen zur Seite und gaben ihm den Weg frei, bis er endlich vor Beatrice stand. Der Mann war klein und fett und trug nichts weiter als eine Art Pumphose, deren Stoff wohl irgendwann einmal, vielleicht vor Monaten, weiß gewesen sein mochte. Er hatte eine Halbglatze, einen dunklen, einigermaßen gepflegt aussehenden Vollbart und breite goldene Ohrringe an beiden Ohrläppchen. Er sah aus wie ein Sklavenhändler aus einem der Sindbad-Filme der fünfziger Jahre.
»Gut, dass Sie kommen«, sprach Beatrice ihn an und war zu diesem Zeitpunkt wirklich erleichtert. Wer konnte schon sagen, was die Frauen mit ihr angestellt hätten, wenn er nicht erschienen wäre? »Können Sie mir sagen, was hier vorgeht? Ich verstehe nämlich überhaupt nicht ...«
Ein kräftiger Tritt in die Rippen brachte sie jäh zum Schweigen und raubte ihr vor Schmerz und Überraschung den Atem. Zum ersten Mal hatte sie leise Zweifel, dass es sich um einen Traum handelte. Mit Tränen in den Augen starrte sie den Dicken an, der breitbeinig vor ihr stand, sie in einer ihr unbekannten Sprache anschrie und ihr dabei immer wieder mit seiner Peitsche drohte. Er schien etwas von ihr zu erwarten, denn von Sekunde zu Sekunde wurde er wütender. Sein fetter, vor Schweiß glänzender Bauch wabbelte, während er vor Wut auf und ab sprang und Beatrice an einen cholerischen Nachbarn in ihrem Haus erinnerte. Aber das Lachen war ihr schon längst vergangen. Sie hätte ihm gern gesagt, dass sie ihn nicht verstand und nicht wusste, was er von ihr wollte, aber sie traute sich nicht. Sie hatte die blutigen Striemen gesehen, die die Peitsche auf den Armen und Gesichtern der anderen Frauen hinterlassen hatte. Es kam ihr klüger vor, einfach zu schweigen und darauf zu warten, was als Nächstes passieren würde.
Tatsächlich musste sich Beatrice nicht lange gedulden. Schon nach wenigen Sekunden packte der Dicke sie grob am Oberarm und zerrte sie auf die Füße. Seine fleischigen Finger hatten erstaunlich viel Kraft und gruben sich schmerzhaft tief in ihre Muskeln. Nun, jetzt würde sich wenigstens die Wahrheit herausstellen. Wenn dies kein Traum war, würde sie dort spätestens morgen früh einen großen blauen Fleck haben.
Unbeholfen stolperte Beatrice hinter ihm her. Ihre Rippen und ihr Arm taten höllisch weh. Trotzdem gelang es ihr, einen kurzen Blick auf ihre Umgebung zu werfen. Sie befand sich in einem ziemlich niedrigen, höchstens zwanzig Quadratmeter großen Raum. Außer ihr waren noch etwa zwanzig andere Frauen anwesend; diese Zahl konnte sie jedoch nur schätzen, da der Raum von einer einzelnen erbärmlich rußenden Fackel bloß spärlich erleuchtet wurde. Die Mauern bestanden aus großen Steinquadern und wirkten so breit und unbezwingbar wie die Mauern einer mittelalterlichen Burg. Auf dem Boden lag eine dicke Schicht Stroh. Es war schmutzig, als wäre es seit Jahrzehnten nicht erneuert worden, und Beatrice schüttelte es bei dem Gedanken, dass sie noch vor wenigen Sekunden auf dieser schleimigen, schimmlig feuchten Masse gesessen hatte, in der sich bereits wieder neues Leben zu entwickeln schien. Am meisten überraschte sie jedoch der Anblick der etwa unterarmdicken Gitterstäbe an der Stirnseite des Raums. War sie etwa in einem Gefängnis gelandet? Warum? Was zum Teufel ging hier vor?
Der Dicke war vor dem Gitter stehen geblieben und schrie einem Mann auf der anderen Seite etwas zu. Dieser, ein dünner Kerl mit krummen Beinen und einer schmutzigen Augenklappe, zog eilig den wohl größten Schlüsselring von seinem Gürtel, den Beatrice jemals gesehen hatte, und öffnete hastig das Schloss der Gittertür. Sie quietschte in ihren Angeln, als der Dicke sie ungeduldig aufstieß und Beatrice auf einen Gang zerrte. Sie hörte, dass die Tür hinter ihr wieder abgeschlossen wurde und die anderen Frauen zum Gitter drängten, sich an den Stäben festklammerten und laut kreischten und jammerten. Beatrice konnte nur vermuten, dass sie verzweifelt um ihre Freilassung, um Wasser und Brot schrien. Was würde nun mit ihr geschehen? An eine Freilassung glaubte Beatrice nicht. Wenn es so weitergehen würde wie bisher, würde man sie wahrscheinlich direkt in die Folterkammer oder zum Henker führen. Die hoffnungslosen Schreie der anderen Frauen gellten hinter ihr her, und Beatrice hätte sich am liebsten die Ohren zugehalten, um sie nicht mehr hören zu müssen. Aber dazu kam sie nicht. Unbarmherzig schleifte der Dicke sie einen düsteren Gang entlang, ohne auch nur für den Bruchteil einer Sekunde seinen Griff zu lockern. Es ging an weiteren Zellen vorbei; noch mehr Hände reckten sich ihnen entgegen, magere schmutzige Hände, die zu ausgemergelten Männern und verwahrlosten Kindern zu gehören schienen. Ihre verzweifelten Schreie zerrissen ihr fast das Herz. So ähnlich mussten sich die Menschen im Mittelalter das Fegefeuer vorgestellt haben. Wie in Trance taumelte sie hinter dem Dicken her, bis sie schließlich in einer Kammer angelangt waren.
An einem Tisch saß ein orientalisch gekleideter Mann und schrieb. Offenbar war er ein Exzentriker, denn er benutzte weder Füller noch Kugelschreiber, sondern schrieb mit Federkiel und Tinte. Ohne sie eines Blickes zu würdigen, fuhr er in seiner Arbeit fort. Doch das war wohl normal, denn sogar der dicke Sklaventreiber sagte nichts, sondern zeigte sich erstaunlich geduldig. Endlos zogen sich die Minuten hin, in denen nur das Kratzen der Feder auf dem Papier zu hören war. Um sich die Zeit zu vertreiben, betrachtete Beatrice den Mann am Schreibtisch eingehend und bewunderte die Sicherheit, mit der er sein altertümliches Schreibwerkzeug in regelmäßigen Abständen ohne aufzusehen in das Tintenfass tauchte. Seine Erscheinung passte überhaupt nicht zu dem schlichten Holztisch, dem groben Mauerwerk und den rußenden Fackeln in der kleinen Kammer. Er schaute eher aus wie ein wohlhabender Kaufmann als ein Gefängniswärter. Er hatte dunkles, kurz geschnittenes Haar und einen dunklen, sehr gepflegten Vollbart. Seine Kleidung sah sauber und teuer aus, und Beatrice hätte wetten mögen, dass wenigstens die Weste aus schwerer Seide war. Außerdem trug er auffallend viel Schmuck – große goldene Ohrringe, gleich mehrere Halsketten und an fast jedem Finger einen mit Juwelen besetzten Ring. Dann blieb ihr Blick wie gebannt an der Feder in der Hand des Mannes haften. Ihr Herz begann schneller zu schlagen, und ihr Mund wurde trocken. Er führte die Feder von rechts nach links! Konnten Träume so detailgetreu sein? Wieder beschlichen sie Zweifel und verursachten Magendrücken. Aber was konnte das hier sonst sein, wenn nicht ein Traum? Es gab doch keine andere Möglichkeit?
Mittlerweile hatte der Mann seine Schreibarbeit beendet. Ein wenig gelangweilt sah er auf. Doch als sein Blick auf Beatrice fiel, erhellte sich seine Miene. Er sprang auf, trat auf sie zu und überschüttete dabei, unterstrichen von ausladenden Gesten, den Dicken mit einem Schwall arabischer Worte. Zu ihrer Genugtuung stellte Beatrice fest, dass die Stimme des Kaufmanns immer wütender und die des Dicken immer kleinlauter wurde. Sie verstand zwar kein Wort, aber sie hatte den Eindruck, dass ihr Sklaventreiber für ihre schlechte Behandlung zur Rechenschaft gezogen wurde. Der Kaufmann raufte sich die Haare. Dann seufzte er und blieb dicht vor Beatrice stehen. Überrascht atmete sie den schwachen Duft von Rosen ein, als er seine Hand durch ihr Haar und über ihre Wange gleiten ließ. Beatrice erschauerte, als er sie mit festem, aber nicht schmerzhaftem Griff zwang, den Mund zu öffnen, ihre Zähne betrachtete und sich dann ihren Handflächen und Fingernägeln widmete. Anschließend begann er ihren Körper abzutasten. Beatrices Herz setzte für einen Moment aus. Was wollte der Kerl von ihr? In ihrem Kopf jagten sich die Gedanken, was sie jetzt tun sollte. Beiß ihn. Schlag ihm ins Gesicht. Schrei so laut du kannst, und gib ihm einen gezielten Tritt zwischen die Beine. Aber statt sich zu wehren, ließ sie alles willenlos über sich ergehen. Sie war wie eine Fremde in ihrem eigenen Körper und nicht in der Lage, sich zu bewegen. Stattdessen fiel ihr plötzlich auf, dass sie weder OP-Kleidung noch ihre normalen Sachen trug, sondern ein knöchellanges, mittelalterlich aussehendes Kleid. Während die Hände des Kaufmanns über ihre Hüften glitten, ihren Bauch und ihren Hintern prüften, ihre Schenkel und Waden umfassten, überlegte sie, woher sie das Kleid haben mochte.
War das nicht absurd? Hier war ein ekelhafter Mann, der sie von oben bis unten angrapschte, und sie machte sich Gedanken um ein Kleid? Beatrice erinnerte sich an eine Patientin, die von zwei Männern überfallen worden war. Während sie die Platzwunden genäht hatte, hatte die Frau ihr erzählt, dass ihr in dem Augenblick, als die beiden begannen sie zusammenzuschlagen, eingefallen war, dass sie vergessen hatte, Butter zu kaufen. War das eine Art Schutzmechanismus des Gehirns? Dass man in einem Moment, in dem etwas Schreckliches geschieht, plötzlich an etwas ganz Alltägliches denken muss, um nicht verrückt zu werden? So wie sie an dieses dumme Kleid dachte, während fremde Hände an ihr herumtasteten? Dabei waren diese Berührungen nicht von Begierde geprägt, sie waren noch nicht einmal freundlich. Sie waren kühl und geschäftsmäßig, als würde er Ware prüfen wie ein Vieh- oder Stoffhändler. Und irgendwo in einem Winkel ihres Gehirns dämmerte es ihr, dass er genau das tat – er prüfte Ware. Natürlich, das war es! Dieser Mann war ein Sklavenhändler! Diese Erkenntnis traf Beatrice wie ein Keulenschlag. Von einer Sekunde zur anderen wurde ihr schlecht. Die Stimmen der beiden Männer wurden dumpf und schwarze Kreise tanzten vor ihren Augen, als ihr Blutdruck in den Keller rauschte. Dann wurde sie ohnmächtig.
Als Beatrice wieder zu sich kam, lag sie auf einem schmalen, harten Bett. Überrascht setzte sie sich auf und warf dabei das dünne Laken auf den Boden, das ihr offensichtlich als Decke gedient hatte. Zwei Dinge wurden ihr gleich auf den ersten Blick klar. Das hier war weder ihr eigenes Bett noch ihr eigenes Zimmer. Es war aber auch nicht mehr dieses finstere Verlies, in dem sie das letzte Mal zu sich gekommen war. Wo aber war sie jetzt? Das Zimmer war so klein, dass außer dem Bett, das kaum mehr als eine klapprige Holzpritsche war, keine weiteren Möbelstücke Platz hatten. Die Wände waren weiß gekalkt und schmucklos, der Boden bestand aus hellbraunen Steinfliesen, vermutlich Sandstein, die Decke war ziemlich niedrig. War sie vielleicht in einer Klosterzelle? Aber nein, dann hätte an der Wand sicherlich ein Kruzifix oder Heiligenbild gehangen. Ihr Blick wanderte zu dem kleinen Fenster, das eigentlich nur ein etwa fünfzig Zentimeter tiefer trichterförmiger Schacht knapp unterhalb der Decke war, durch den freundliches Tageslicht in das Zimmer fiel. Es war vergittert. Also befand sie sich schon wieder in einem Gefängnis, wenn es auch dieses Mal wesentlich angenehmer zu sein schien. Das Laken, das sie vom Boden aufhob, war sauber. Eine erfrischende Abwechslung nach all dem Dreck und Gestank. Oder war es doch nur wieder ein Traum? Beatrice warf einen prüfenden Blick auf ihren Oberarm. Tatsächlich hatte sie dort Hämatome, jeder einzelne Finger des fetten Sklavenaufsehers war deutlich sichtbar. Und wenn sie einen der blauen Flecke berührte, spürte sie jenen typischen Muskelschmerz, der Hämatomen eigen ist. Sie fuhr sich durch das blonde Haar. Also hatte sie das alles nicht geträumt. Schlimm genug. Aber jetzt wusste sie wenigstens Bescheid.
Beatrice stand auf und wunderte sich ein wenig darüber, wie gelassen sie diese ganze Situation hinnahm. Doch das war bisher immer ihre große Stärke gewesen, ein Wesenszug, durch den sich viele Chirurgen auszeichnen – in kritischen Momenten einen kühlen Kopf zu bewahren.
Beatrice trat ans Fenster. Da es keine Fensterscheibe hatte, konnte sie die dicken eisernen Gitterstäbe berühren, wenn sie sich auf die Zehenspitzen stellte. Sie schienen tief im Mauerwerk verankert zu sein und saßen so fest, wie es kaum fester ging. Aber das Rütteln am Gitter war ohnehin nichts anderes als ein Reflex. Das Fenster war so schmal, dass sie auf gar keinen Fall hindurchklettern konnte. Beatrice stellte sich vor, wie kalt es in der Zelle im Winter werden würde, wenn Wind und Schnee ungehindert durch das offene Fenster hereinwehen konnten. Sie ließ sich seufzend auf das schmale Bett sinken und stützte den Kopf in die Hände. Sklavenhandel. In unserer Zeit! Sie konnte es immer noch nicht fassen.
Vor einigen Jahren hatte sie in einer Zeitschrift gelesen, dass es in entlegenen Winkeln dieser Erde, vor allem im Südchinesischen Meer, immer noch Sklavenhändler gab, die regelmäßig auf Beutezüge gingen. Aber mitten in einer deutschen Großstadt? Das war doch völlig verrückt. Wie waren diese Kerle überhaupt an sie herangekommen? Hatte man ihr unbemerkt eine Droge gegeben, im Kaffee zum Beispiel? Mit einem Halluzinogen ließ sich natürlich auch ihr Erlebnis in der Schleuse viel besser erklären. Aber warum ausgerechnet sie?
Plötzlich merkte sie, dass etwas hart gegen ihren Oberschenkel schlug. Auf der Suche nach der Ursache entdeckte sie eine Tasche an ihrem Kleid, die ihr bisher nicht aufgefallen war. Sie griff hinein und zog voller Überraschung einen Stein heraus. Es war der Stein, den sie in der Schleuse zum ersten Mal in Händen gehalten und den ihr vermutlich die alte Frau kurz vor der Operation zugesteckt hatte. Sie betrachtete ihn nachdenklich. Der Stein war wunderschön. Und als sie ihn gegen das Fenster hielt, brach sich in ihm das Sonnenlicht und versprühte blaue Funken im ganzen Raum. Ob es ein Saphir war? Sicherlich war er unbezahlbar. Noch während sie sich an den Lichtreflexen erfreute, hörte sie plötzlich schwere Schritte, die vor ihrer Tür stehen blieben. Hastig steckte Beatrice den Stein wieder in die geheime Tasche. Wenn die Sklavenhändler ihn bisher nicht gefunden hatten, würde er auch jetzt dort sicher sein.
Ein schwerer Riegel wurde zurückgeschoben, und die Tür öffnete sich mit lautem Knarren. Es war jener Mann, der sie vorhin begutachtet hatte. In seiner Begleitung befand sich ein etwa zwölfjähriges mageres Mädchen, das einen großen Weidenkorb trug. Sie ächzte und stöhnte, und Beatrice verfluchte in Gedanken diesen Kerl, der das magere Ding die schwere Last alleine schleppen ließ.
Er stieß einen unfreundlich klingenden Befehl zwischen den Zähnen hervor und schubste das Mädchen so unsanft in die Zelle, dass die Kleine unter dem Gewicht des großen Korbs stolperte und fast hingefallen wäre. Beatrice konnte sie gerade noch rechtzeitig auffangen. Sie lächelte dem völlig verschüchterten Mädchen aufmunternd zu und wollte den Sklavenhändler zur Rede stellen, als er das Wort zuerst an sie richtete – auf Lateinisch! Beatrice war so überrascht, dass es ihr die Sprache verschlug und sie ihm mit offenem Mund zuhörte. Sie war froh, dass niemand mit einem Fotoapparat in der Nähe war, denn ihr Gesicht musste einen ziemlich dummen Ausdruck gehabt haben. Aber war das ein Wunder? Sie hatte noch niemals jemanden Lateinisch sprechen hören. Obwohl er langsam redete, verstand Beatrice nicht einmal die Hälfte. Mühsam kramte sie in ihrem Hirn nach den Resten ihrer humanistischen Schulbildung, die immerhin schon etliche Jahre zurücklag. Schließlich erfasste sie wenigstens den Sinn seiner Rede. Das Mädchen sollte ihr beim Umkleiden und Frisieren helfen, dann würde er wiederkommen und sie abholen. Wohin sie jedoch gehen und weshalb sie sich umziehen sollte, hatte Beatrice nicht verstanden. Aber ihren mühevollen Versuch, ihn danach zu fragen, wartete er gar nicht erst ab. Noch bevor sie ihren Satz zu Ende gebracht hatte, hatte er bereits die Tür wieder hinter sich geschlossen und war verschwunden.
»Dieser Idiot! Er hätte mich wenigstens ausreden lassen können!«, schimpfte Beatrice hinter ihm her. Dann wandte sie sich an das Mädchen, das bereits Tücher, Kämme, ein blaues Kleid, einen kleinen Flakon und sogar einen großen tönernen Krug und eine Schüssel aus dem Korb holte und sie ordentlich auf das Bett legte. »Danke, dass du mir beim Umziehen helfen willst, aber ich brauche deine Hilfe nicht. Ruhe dich so lange aus.«
Das Mädchen lächelte sie zaghaft an und schüttelte den Kopf.
»Ach natürlich, entschuldige. Du kannst mich ja nicht verstehen.« Beatrice stieß einen Seufzer aus. Wie lange hatte sie nun schon mit niemandem mehr gesprochen? Ihr kam es wie Tage vor. Sie hatte das dringende Bedürfnis, sich mit jemandem zu unterhalten. »Also gut. Was muss ich tun?«
Das Mädchen zeigte ihr mit Gesten, dass sie sich ausziehen sollte. Während Beatrice das tat, goss die Kleine geschickt Wasser aus dem Krug in die Schüssel, gab ein paar Tropfen aus dem Flakon hinzu und begann Beatrice von Kopf bis Fuß zu waschen. Dann trocknete sie sie ab, rieb sie mit einem nach Rosen duftenden Öl ein und zog ihr schließlich das Kleid an, das sie mitgebracht hatte. Es sah ebenfalls mittelalterlich aus und hatte eine folkloristische Blumenstickerei am Ausschnitt, der nicht mit Knöpfen geschlossen, sondern mit Seidenbändchen zugeschnürt wurde. Das Kleid kratzte genauso wie der Schal aus handgesponnener Wolle, den Beatrice sich einige Wochen zuvor auf einem Mittelalter-Markt gekauft hatte. Womöglich stammte das Kleid sogar vom selben Markt.
Als sie mit dem Anziehen fertig war, widmete sich das Mädchen Beatrices Haaren. Sie flocht ihr Zöpfe, die sie mit Spangen und Kämmen am Kopf feststeckte. Beatrice, die um ihre Haare kaum Aufsehen machte und meistens einen schlichten Pferdeschwanz trug, hätte zu gern einen Blick in einen Spiegel geworfen, aber leider hatte die Kleine keinen dabei. Sichtlich zufrieden betrachtete das Mädchen sein Werk und begann dann mit dem Aufräumen. Als sie jedoch Beatrices Kleid zusammenlegte, um es in den Korb zu packen, fiel der Stein aus der Tasche und auf den Boden. Sie bückte sich, um ihn aufzuheben – und wich im nächsten Augenblick mit einem Aufschrei zurück. Mit weit aufgerissenen Augen starrte sie abwechselnd den Stein und Beatrice an. Sie schien kaum noch atmen zu können. Doch dann sprudelten die Worte nur so aus ihr heraus, und Beatrice vermochte sie gerade noch davon abzuhalten, vor ihr auf die Knie zu fallen und ihre Füße zu küssen.
»Erzähl bitte niemandem etwas von diesem Stein«, sagte sie eindringlich, hob den Stein auf und legte einen Finger auf die Lippen. »Kein Wort, verstehst du?«
Das Mädchen nickte eifrig und legte ebenfalls einen Finger auf die Lippen. Dabei strahlte sie über das ganze Gesicht, als wäre sie soeben dem Glück ihres Lebens begegnet.
Beatrice war durch die Reaktion des Mädchens so verwirrt, dass sie fast den Sklavenhändler überhört hätte, der in diesem Moment die Tür öffnete. Er sprach sie wieder auf Lateinisch an, und soweit Beatrice ihn verstand, forderte er sie auf, mit ihm zu kommen. Sie folgte ihm widerstandslos. Was hätte sie auch tun sollen? Sie wusste noch nicht einmal, in welcher Art von Gebäude sie sich befand. Also ging sie hinter ihm her, bis sie schließlich einen kleinen Hof betraten. Dort stand etwas bereit, das wie eine Sänfte aussah. Es war ein großer, mit dichten dunklen Vorhängen verhüllter Kasten. Doch hatte er keinerlei Ähnlichkeit mit den Sänften, die sie aus Filmen kannte. Es fehlten die kunstvollen Quasten und Troddeln oder anderer Zierrat. In der Tat war dieses Ding richtig hässlich. Und auch die beiden Männer, die vorne und hinten an den Tragegriffen bereitstanden, waren nicht die gut gewachsenen dunkelhäutigen Sklaven aus den Märchen von Tausendundeine Nacht. Es waren muskelbepackte, kräftige Kerle, denen Beatrice lieber nicht im Dunkeln begegnet wäre.
Der Sklavenhändler drängte Beatrice in die Sänfte, deren Inneres bei weitem nicht so geräumig und komfortabel war, wie sie es sich immer vorgestellt hatte. Dann stieg er selbst hinein und schnalzte laut mit der Zunge. Beatrice spürte, wie die Sänfte angehoben wurde und sich die beiden Männer in Trab setzten. Wobei sie tatsächlich zu laufen schienen, denn sie wurde auf den harten, völlig verschlissenen Polstern hin und her gerüttelt und stieß mehrmals gegen den Sklavenhändler. Trotzdem versuchte sie etwas von den Geräuschen um sie herum mitzubekommen. Sie hörte zahlreiche Menschenstimmen, von denen einige wie Marktschreier klangen, die ihre Waren feilboten, das Blöken von Schafen, sogar Musikanten, die auf ihren Flöten und Trommeln orientalische Weisen spielten. Aber sie hörte nicht ein einziges Auto, nicht einmal eine Fahrradklingel.
Wahrscheinlich hatte man sie in eine Stadt irgendwo im Nahen Osten verfrachtet und trug sie nun durch die Altstadt, deren Gassen zu schmal für Autos und zu holprig für Fahrräder waren.
Nach einer Weile hielten die beiden Träger an. Beatrice war erleichtert, als der Sklavenhändler sie wieder aus der engen Sänfte zog und sie endlich ihre Glieder strecken konnte. Bevor sie sich umzuschauen vermochte, stieß er sie voran. Sie betraten ein Haus, wurden dort von einem alten hinkenden Mann, der offenbar an einer Hüftgelenksarthrose litt, durch einen kunstvoll gestalteten Innenhof geführt und in einen Raum gebracht, wo sie schon erwartet wurden.
Beatrice blieb vor Staunen fast die Luft weg. Überall lagen Orientteppiche; nicht nur auf dem Boden, zum Teil mehrere übereinander, sogar an den Wänden hingen Teppiche. Beatrice half zeitweise ihrer Tante, die eine Antiquitätenhandlung in Hamburg besaß. Sie hatte daher ein wenig Erfahrung und schätzte, dass allein die Teppiche an den Wänden etwa zwei Millionen Mark wert waren. Ansonsten war der Raum eher spärlich möbliert, ein paar niedrige Rosenholztische, auf denen Messingtabletts mit Früchten standen, sowie dicke reich bestickte Kissen, die auf niedrigen Vorsprüngen lagen und wohl als Sitzgelegenheiten dienten. Die Krönung des Ganzen, das Tüpfelchen auf dem »i« aber war der Mann, der mit untergeschlagenen Beinen auf dem höchsten Kissen saß und genüsslich aus einer winzigen Tasse einen Mokka schlürfte, dessen Duft den ganzen Raum erfüllte. Dieser Mann sah aus wie ein Sultan aus einem Märchenbuch. Er war beleibt, hatte einen sehr gepflegten graumelierten Vollbart, seidene Kleidung, bestickte arabische Pantoffeln und sogar einen Turban auf dem Kopf.
Während Beatrice ihren Blick schweifen ließ und sich an den Mustern der kostbaren Teppiche erfreute, merkte sie nicht, wie der Sklavenhändler eifrig auf den Mann einredete und dieser sie musterte. Als sie schließlich ihre Aufmerksamkeit wieder den beiden zuwandte, nickte der Hausherr zustimmend und reichte dem Sklavenhändler, der ebenfalls auf einem Kissen saß, die Hand. Dann öffnete er eine kleine Truhe, die neben ihm stand, und holte zwei lederne Beutel heraus.
Erst als der Sklavenhändler unter Verbeugungen und mit einem strahlenden Lächeln den Raum verließ, ohne Beatrice wieder mitzunehmen, begriff sie, dass sie gerade verkauft worden war.