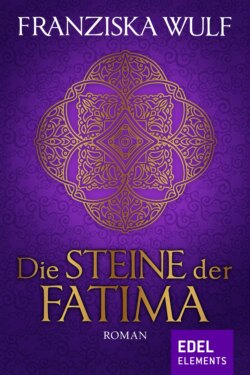Читать книгу Die Steine der Fatima - Franziska Wulf - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
III
ОглавлениеAli al-Hussein ibn Abdallah ibn Sina lag auf seinem Bett und träumte. Es war ein überaus angenehmer Traum. Er sah sich selbst als älteren Mann mit vollem, leicht ergrautem Haar und weißem Bart in einem Hörsaal in Bagdad, dem Zentrum der Gelehrsamkeit der Welt. Mehr als hundert wissbegierige Medizinstudenten saßen vor ihm, die einzig und allein seinetwegen aus allen Ländern der Welt gekommen waren. Gebannt hingen sie an seinen Lippen und saugten wie Verdurstende jedes einzelne seiner Worte in sich hinein. Es war so still im Hörsaal, dass man das Summen einer Fliege hören konnte, während er mit klarer, selbstbewusster Stimme über die Behandlung von Knochenbrüchen dozierte. Er war gerade beim interessantesten Punkt angelangt und berichtete über eine Methode, die er selbst entwickelt hatte, als das Geräusch von Schritten ihn plötzlich aufblicken ließ. Das Schlurfen der Pantoffeln auf dem glänzenden Marmorboden traf ihn in der Stille des Hörsaals wie ein Peitschenhieb. Eine Zeit lang versuchte Ali, nicht darauf zu achten, und fuhr mit seiner Vorlesung fort. Doch die Schritte wurden immer lauter und behinderten seine Konzentration, bis er verärgert seinen Vortrag abbrach. Welcher Narr wagte es, ohne seine Erlaubnis den Hörsaal zu betreten und seine Vorlesung zu stören? Angestrengt blickte er in das Halbdunkel des Saals, um den Übeltäter zu erwischen. Er konnte jedoch niemanden sehen. Umso mehr konzentrierte er sich auf das Schlurfen. Schließlich erkannte er an dessen eigenartigen Rhythmus, dass es sich um seinen Diener, den alten Selim, handeln musste, dem Allah eine krumme, bucklige Gestalt verliehen hatte. Aber wieso war Selim hier? In diesem Augenblick begann der Hörsaal vor seinen Augen zu verschwimmen. Und im gleichen Maße, wie die Gesichter der aufmerksamen Studenten ihre Konturen verloren, gewann er die Erkenntnis, dass er nur träumte und gerade aus dem Schlaf gerissen wurde. Ali blieb liegen, ohne sich zu rühren, und hoffte, dass Selim bald wieder gehen würde. Er hatte das sichere Gefühl, dass noch lange nicht die Zeit zum Aufstehen gekommen war. Wenn er die Augen jetzt aufschlug, würde er feststellen, dass es noch dunkel war und nur das silberne Licht des Mondes durch die Fensterläden schien. Wahrscheinlich wollte Selim bloß die Kleider seines Herrn ordnen, oder er hatte vergessen, die Öllampen aufzufüllen. Morgen würde er ihn dafür rügen, aber jetzt wollte er so schnell wie möglich einschlafen und seinen Traum wiederfinden.
Leider hörte das Tappen und Schlurfen auf den Marmorfliesen nicht auf, und durch die halb geschlossenen Lider sah Ali den schwachen Schein einer einzelnen Öllampe. Er seufzte und setzte sich im Bett auf, noch bevor sein alter Diener ihn erreicht hatte.
»Was gibt es, Selim?«, fragte er und rieb sich die Augen, die sich nur widerwillig an das Licht der Öllampe gewöhnen wollten.
»O Herr, verzeiht, dass ich Euch aus der wohlverdienten Nachtruhe herausreißen muss. Der Emir hat einen Boten geschickt. Ihr sollt sogleich zu ihm kommen!«
»Beim Barte des Propheten!«, rief Ali und sprang aus dem Bett. »Mitten in der Nacht? Was ist es denn dieses Mal? Fällt es dem edlen Herrn wieder einmal schwer, das nächtliche Wasser loszuwerden? Oder kneift sein fetter Bauch, weil er zu viel in Öl gebratenes Hammelfleisch verzehrt hat?«
»Aber Herr, Ihr solltet Euch nicht ...«
»Was fällt diesem widerwärtigen, feisten Kerl ein, mich mitten in der Nacht zu wecken?«
»Aber Ihr seid sein Leibarzt, Herr.«
Selims schüchterne Antwort war so schlicht und wahr, dass Ali abrupt stehen blieb. Von einem Augenblick zum nächsten verflog sein Zorn, und er musste lachen. Natürlich hatte Selim Recht. Er war Leibarzt von Nuh II. ibn Mansur, dem Emir von Buchara. Er war mit seinen zwanzig Jahren sogar der jüngste Leibarzt eines Emirs in der Geschichte dieser Stadt. Und er war stolz auf diese Auszeichnung.
Ali seufzte und fuhr sich durch sein volles dunkles Haar. »Liegen meine Kleider bereit?«, fragte er. Im gleichen Moment fiel ihm ein, dass er sich die Frage hätte sparen können. Selim nahm seinen Dienst bei einem jungen, aber schon hoch angesehenen Arzt sehr ernst. Und jeden Abend legte der Alte frische Kleidung zurecht, so dass Ali nur noch hineinzuschlüpfen brauchte, wenn er mitten in der Nacht zu einem Patienten gerufen wurde.
Nachdem er sich rasch angekleidet hatte, ging Ali mit Selim in sein Arbeitszimmer, wo er medizinische Instrumente und Arzneien aufbewahrte. Er öffnete einen Schrank und holte seine große Tasche heraus, die er immer mitnahm, wenn er einen Patienten in dessen Haus aufsuchte. Mit geübtem Blick ging er den Inhalt durch.
»Hat man wenigstens geruht mitzuteilen, weshalb Nuh II. mich rufen lässt?«
»Nein, Herr.«
Ali verdrehte die Augen. Weshalb sollte auch ein Arzt vorher wissen, unter welchen Beschwerden sein Patient litt? War der Emir unverschämt oder einfach nur dumm? Er dachte kurz nach und legte schließlich zu den Pulvern gegen Schlaflosigkeit, Magendrücken und Appetitlosigkeit ein Abführmittel hinzu, dass er einer kleinen Schublade entnahm. Er lächelte grimmig. Sollte Nuh ihn wegen einer Lappalie aus dem Schlaf gerissen haben, würde sich der Emir von Buchara morgen anstelle seiner Regierungsgeschäfte einer gründlichen Darmreinigung widmen.
«Herr, ich habe nach der Sänfte geschickt und ...«
»Nein, Selim«, entgegnete Ali, schloss die Tasche und warf sich seinen Mantel über. »Ich gehe zu Fuß zum Palast. Ich kann nicht so lange warten, bis die Sklaven mit der Sänfte bereit sind; außerdem wird die Nachtluft mir gut tun.«
Ehe der alte Selim noch etwas sagten konnte, hatte Ali schon das Haus verlassen und eilte durch die engen Gassen von Buchara dem Palast des Emirs entgegen.
Der Morgen dämmerte bereits, und Ali wartete immer noch auf Nuh II. ibn Mansur oder eine Nachricht von ihm. Er war verärgert. Dabei war der Eindruck, den die Eingangshalle des Emirs von Buchara vermittelte, überwältigend. Und niemand, der die Ehre hatte, hier auf den Emir warten zu dürfen, vergaß sie jemals. Sie glich keinesfalls den Hallen anderer vornehmer Häuser und Paläste, sondern vielmehr einem blühenden Garten, überdacht von einem steinernen Baldachin aus zierlichen Rosetten und Ornamenten. Es duftete nach Rosen und Mandelblüten, nach reifen Pfirsichen und Granatäpfeln. Sogar eine Dattelpalme, die eigentlich in Buchara wegen der winterlichen Kälte nicht gedieh, wuchs hier. Die Luft war erfüllt von dem sanften Plätschern der vielzähligen Brunnen und dem Gezwitscher der kostbaren exotischen Vögel, die nun mit Anbruch des Tages zunehmend munterer wurden.
Doch Ali hatte keine Augen für diese Schönheit. Er war verärgert. Rastlos wanderte er zwischen den kunstvoll angelegten Beeten umher und fragte sich zum wiederholten Male, welches unerfreuliche Schicksal Nuh II. dazu bewogen hatte, ausgerechnet ihn, Ali al-Hussein, als seinen Leibarzt auszuwählen. Natürlich, trotz seiner Jugend war er der beste Arzt in Buchara. Aber sollte er dann nicht auch so behandelt werden? Sollte man ihn nicht in die innersten Gemächer des Emirs führen und dort mit Rosenwasser und Mandelgebäck bewirten, wenn man ihn denn schon warten ließ?
Durch das Dach der Halle konnte er das Licht der Morgendämmerung sehen, und fast im gleichen Augenblick erklang die klare Stimme des Muezzins, der mit seinem Morgengesang die Größe Allahs pries und die Gläubigen zum Gebet aufforderte. Ali spürte, wie der Zorn in heißen Wellen über ihn hereinbrach. Er war am Ende seiner Geduld. Vielleicht war es an der Zeit, dem Emir eine Lehre zu erteilen und Buchara auf unbestimmte Zeit zu verlassen? Er war doch nicht auf Nuh II. ibn Mansur angewiesen. Hatte er nicht ein stattliches Vermögen von seinem Vater geerbt? Außerdem gab es viele Fürsten im Lande der Gläubigen, die mit Freuden seine Dienste annehmen würden. Aber gab es auch andere Ärzte, die bereit waren, in den Dienst des Emirs von Buchara zu treten und das Wissen und die Fähigkeiten eines Ali al-Hussein ibn Abdallah ibn Sina besaßen? Wohl kaum.
Ali beschloss zu gehen. Sollte der Emir doch einen anderen Arzt holen lassen. Es gab genug Speichellecker in Buchara. Diese Stümper waren zwar kaum in der Lage, ein Fieber von einem Knochenbruch zu unterscheiden, aber sie würden ohne Zweifel geduldig und mit Freuden in der Halle ausharren und auf den erlauchten Herrscher warten, notfalls sogar mehrere Tage.
Gerade als er seinen Mantel wieder umgelegt und seine Tasche ergriffen hatte, trat ein Diener zu ihm heran.
»Herr, der Emir ist nun bereit, Euch zu empfangen. Folgt mir bitte.«
Ali hob spöttisch eine Augenbraue. Das klang, als hätte er um eine Audienz gebeten. Er schluckte jedoch die bissige Bemerkung hinunter, die ihm auf der Zunge lag, und schwieg. Der Diener hatte schließlich keine Schuld am unhöflichen Verhalten seines Herrn. Er tat nur, was ihm befohlen wurde. Aber während der Junge Ali durch zahlreiche Gänge führte, vorbei an reich verzierten Truhen aus edlen Hölzern und kostbaren Teppichen, überlegte er, mit welcher besonders unangenehmen Untersuchung er Nuh II. seine Wartezeit vergelten könnte.
Der Diener brachte Ali in einen Teil des Palastes, in den er noch nie vorgelassen worden war, und geleitete ihn schließlich in einen Raum, den der junge Arzt sofort als Schlafgemach des Emirs erkannte. Es sah aus, als hätte hier noch vor wenigen Augenblicken ein Kampf stattgefunden. Seidene Kissen lagen überall verstreut auf dem Boden, die Laken auf dem breiten Bett waren zerwühlt, und ein Teil des goldbestickten Baldachins hing in Fetzen herunter. Mitten im Raum, zwischen umgestürzten Messingvasen und Wasserbecken, stand Nuh II. ibn Mansur, der Emir von Buchara, und ließ sich von einem Diener die seidene Schärpe um seinen dicken Bauch binden. War der dunkle Fleck auf dem Teppich zu seinen Füßen nur Wasser, oder war es Blut? Verstohlen sah Ali sich um und erwartete, in einer Ecke des Raums einen leblosen, von einem Schwert durchbohrten Körper vorzufinden. Aber da entdeckte er gerade noch aus dem Augenwinkel eine verschleierte Gestalt. Unauffällig, wie ein Schatten, verließ sie das Schlafgemach durch einen schmalen, hinter einem Teppich verborgenen Spalt. Lautlos schloss sich die Geheimtür hinter ihr und wurde wieder unsichtbar.
Mirwat!, vermutete Ali, obwohl weder er noch sonst ein Lebender im Vollbesitz seiner Manneskraft Nuhs Lieblingsfrau je zu Gesicht bekommen hatte. Allerdings widmeten die Dichter ihr Verse, besangen ihre unvergleichliche Schönheit und nannten sie »die Rose von Buchara«. Alis Zorn milderte sich. Er war sogar bereit, dem Emir die unangemessen lange Wartezeit zu verzeihen. Keinem Mann war es zu verdenken, dass er seine Beschwerden vergaß und die Gesellschaft der unvergleichlichen »Rose von Buchara« der seines Arztes vorzog.
»Allah sei mit Euch, Nuh II. ibn Mansur«, begrüßte er den Fürsten und verbeugte sich höflich.
»Ali al-Hussein, ich freue mich, Euch zu sehen!«, rief der Emir und kam mit ausgebreiteten Armen auf Ali zu, als wäre dieser ein alter Freund, dessen Besuch er schon lange sehnsüchtig erwartet hatte. Er zog Ali an seine breite Brust und küsste ihn sogar auf beide Wangen. »Lasst uns gemeinsam Allah preisen für das Geschenk eines neuen Tages, der sich soeben zu seiner vollen Schönheit zu entfalten beginnt.«
Welches Leiden auch immer Nuh II. geplagt hatte, die schöne Mirwat schien es bereits kuriert zu haben.
»Sehr wohl, Nuh II. ibn Mansur«, erwiderte Ali und konnte ein Lächeln nicht unterdrücken. »Aber lasst uns auch nicht vergessen, Allah für Eure rasche Genesung zu danken. Er scheint Euch bereits von Eurem Leiden erlöst zu haben, ohne dass Ihr meiner Kunst bedurft hättet.«
Der Emir stutzte und sah den jungen Mann an seiner Seite einen Augenblick so verwirrt an, dass Ali bereits glaubte, Nuh II. habe tatsächlich vergessen, dass er mitten in der Nacht seinen Leibarzt zu sich gerufen hatte. Doch dann hellte sich die Miene des Emirs auf, und lachend schlug er Ali auf die Schulter.
»Natürlich! Ich ließ Euch rufen! Verzeiht, dass ich Euch den Grund noch nicht erklärt habe. Aber Allah sei Dank, denn nicht ich bin es, der Eure Dienste benötigt.«
Er nahm Ali beim Arm und führte ihn in den benachbarten Raum, der mit Sitzpolstern und Teppichen überaus bequem ausgestattet war. Der Emir setzte sich auf eines der breiten goldbestickten Sitzkissen, wies Ali an, neben ihm Platz zu nehmen, und klatschte zweimal in die Hände. Sogleich öffnete sich die Tür, und drei Diener traten ein. Auf großen Messingtabletts trugen sie all jene Köstlichkeiten herein, die Ali sich während seiner Wartezeit gewünscht hatte – frische Datteln und Feigen, knuspriges Brot, süßen Honig und weißen Rahm, duftendes Rosenwasser und, in einer glänzend polierten Kupferkanne, würzigen Mokka. Sie stellten alles auf zwei niedrige Tische, schenkten den Kaffee in zwei Tassen und das Rosenwasser in Gläser ein und verließen dann unter Verbeugungen den Raum.
»Stärkt Euch zuerst, verehrter Freund. Ein Mann sollte weder den Tag noch sein Handwerk mit leerem Magen beginnen.«
Ali ließ sich das nicht zweimal sagen. Er tauchte das Brot in den weißen Rahm und tröpfelte dann den goldenen Honig darüber, der so süß war, als hätten die Bienen den Nektar im Garten des Paradieses gesammelt. Während sie von den Freuden der Falkenjagd sprachen und der Emir von seinem Lieblingspferd erzählte, das erst vor wenigen Tagen ein Rennen gewonnen hatte, nippte Ali voller Behagen an dem Mokka, der genau so war, wie das alte Sprichwort es verlangte: Schwarz wie die Nacht, heiß wie die Hölle und süß wie die Liebe. Ali fragte sich zwar immer noch, was Nuh eigentlich von ihm wollte, aber angesichts dieser köstlichen Mahlzeit spielte das nur noch eine untergeordnete Rolle. Er nickte zustimmend, wenn Nuh seine Meinung kundtat, lachte, wenn er einen Scherz machte, und übersah absichtlich, dass der Emir mehr von dem fetten Rahm und dem starken Mokka zu sich nahm, als seiner Gesundheit zuträglich war. Ali war sogar geneigt, seinem Gastgeber die unangemessene Wartezeit zu vergeben.
Als sie etwa eine Stunde später ihr ausgiebiges Mahl beendet hatten, klatschte der Emir erneut in die Hände, und zwei Diener mit Wasserbecken und Handtüchern kamen herein.
»Ich danke Euch für die vortreffliche Bewirtung, Nuh II. ibn Mansur. Dies war wahrlich ein vorzügliches Mahl«, sagte Ali, während er sich die Hände in dem nach Nelken duftenden Wasser wusch und anschließend abtrocknete. »Aber darf ich nun den Grund erfahren, weshalb Ihr mich habt rufen lassen?«
»Der Grund«, wiederholte der Emir langsam und flüsterte dann dem Diener, der ihm das Wasserbecken reichte, etwas zu. Seinen Frohsinn schien Nuh II. plötzlich verloren zu haben. Mit einem Schlag sah er ernst und bekümmert aus. »Vor einigen Tagen kaufte ich von Omar al-Fadlan, dem Sklavenhändler, eine Frau für meinen Harem. Sie ist sehr schön, aber irgendetwas stimmt nicht mit ihr. Sie spricht kein Wort, isst kaum etwas und zeigt keinerlei Regung. Sie wirkt, als wäre sie in einem Traum gefangen.« Er stieß einen Seufzer aus. »Das Schlimmste ist jedoch, dass die anderen Frauen nichts mit ihr zu tun haben wollen. Vom ersten Tag an haben sie sie gemieden. Nun behaupten sie sogar, die neue Sklavin sei verhext. Sie weigern sich, noch länger mit ihr unter einem Dach zu wohnen. Ihr wisst, was das bedeutet?« Der Emir schüttelte niedergeschlagen den Kopf. »Einen Aufstand der Bauern fürchte ich weit weniger als Unzufriedenheit in meinem Harem.«
Ali runzelte die Stirn. »Konntet Ihr denn an ihr die Anzeichen einer Krankheit erkennen?«
»Eben deshalb ließ ich Euch rufen. Mir scheint sie gesund zu sein, aber ich habe auch nicht Euer Urteilsvermögen. Deshalb bitte ich Euch um Euren Rat in dieser Angelegenheit. Es ist zwar nur eine Sklavin, aber ich habe viel für sie bezahlt. Ich habe sie soeben holen und in mein Schlafgemach bringen lassen, wo Ihr sie ansehen könnt.«
Der Emir erhob sich, und Ali tat es ihm gleich. Nuh II. musste in der Tat sehr verzweifelt sein, wenn er einem Mann gestattete, sich einer seiner Frauen zu nähern. Und er fragte sich, warum er die seltsame Sklavin nicht einfach wieder zu Omar al-Fadlan brachte und sein Geld zurückforderte.
Im Schlafgemach des Emirs wartete eine Frau. Sie war in einen Schleier aus hellblauer Seide gehüllt, der selbst aus der Ferne weit kostbarer wirkte, als es einer Sklavin zukam. Regungslos wie eine Statue stand sie in einer Ecke des Raums und hielt ihren Kopf gesenkt wie eine alte, vom Schicksal gebeugte Frau. Neben ihr erblickte Ali einen wahren Riesen von einem Mann. Er trug nur ein Lendentuch und einen Gürtel, von dem ein gebogenes Schwert baumelte, so dass Ali die Muskeln unter seiner dunklen Haut deutlich sehen konnte. Das musste Jussuf sein, der Erste Eunuch im Harem des Emirs. Ali hatte schon viel von ihm gehört, wenn er den Dunkelhäutigen auch bisher noch nie zu Gesicht bekommen hatte. Man sagte, er sei so stark, dass er mit bloßen Händen einem Ochsen das Genick brechen könnte.
»Nun, was meint Ihr, Ali al-Hussein?«, fragte der Emir. »Habt Ihr Euch schon ein Urteil gebildet?«
Ali verdrehte die Augen und wunderte sich einmal mehr über die Naivität der Menschen. Glaubte Nuh etwa, er wäre ein Hellseher? Die Frau vor ihm war verschleiert, und da sie zu Boden blickte, konnte er noch nicht einmal ihre Augen sehen. Wie sollte er da etwas über ihre Gesundheit sagen.
»Ihre Haltung zeugt von großer Traurigkeit und schwerem Leid. Vielleicht steckt ein körperliches Leiden dahinter. Oder es sind auch nur die Schrecken der Gefangennahme, die sie noch nicht verwunden hat«, entgegnete Ali, der schon lange genug Arzt war, um zu wissen, was ein Ratsuchender hören wollte. »Ist Euch bekannt, woher sie stammt?«
Der Emir schüttelte den Kopf. »Nein. So viel ich verstanden habe, weiß Omar al-Fadlan auch nichts über sie. Er hat sie wohl irgendwo in der Wüste weitab jeglicher menschlicher Siedlung gefunden.«
Ali nickte nachdenklich. »Es tut mir Leid, aber ich werde sie untersuchen müssen, wenn ich Euch genauere Auskunft geben soll.« Er hob bedauernd seine Hände. »Ich muss Euch um die Erlaubnis bitten, ihr den Schleier abzunehmen und sie zu entkleiden.«
Der Emir sog hörbar die Luft ein, und eine Zornesfalte bildete sich auf seiner Stirn. »Wie könnt Ihr es wagen ...«
»Natürlich steht es Euch frei, mir diese Erlaubnis zu verweigern, Nuh II. ibn Mansur. Ihr seid der Gebieter«, entgegnete Ali ruhig. »Aber dann kann ich nicht für Eure Sicherheit garantieren. Es ist immerhin möglich, dass sie von einer Karawane zurückgelassen wurde, weil sie Zeichen einer ansteckenden Krankheit an ihrem Körper trägt.« Ali, dem die Launen des Emirs allmählich auf die Nerven gingen, zuckte mit den Schultern. »Da Ihr offensichtlich meine Dienste nicht in Anspruch nehmen wollt, werde ich gehen. Aber hört auf meinen Rat. Sperrt diese Sklavin in ein tiefes Kellerloch. Oder besser noch, bringt sie in die Wüste zurück, bevor Buchara von der Pest heimgesucht wird.«
Ali legte sich seinen Mantel um die Schultern und griff nach seiner Tasche, doch Nuh II. hielt ihn an der Tür zurück.
»Geht noch nicht! Bitte.«
Zu seiner Genugtuung erkannte Ali, dass seine Worte ihren Zweck nicht verfehlt hatten – Nuh II. war verunsichert. Im Gesicht des Emirs stritten Eifersucht, Angst und Besitzerstolz gegeneinander. Diese seltsame Sklavin musste ihm weit mehr bedeuten, als er seinem Arzt gegenüber zugeben mochte.
»Ich erteile Euch die Erlaubnis«, sagte er mit einem tiefen Seufzer. Seiner Stimme war deutlich anzuhören, wie schwer es ihm fiel.
»Spricht sie unsere Sprache?« Der Emir schüttelte den Kopf. »Nein. Soweit ich weiß, beherrscht sie ein wenig Latein, aber auch das nur sehr bruchstückhaft. Ich selbst habe jedoch, seit ich sie vor einigen Tagen erwarb, noch kein einziges Wort von ihr gehört.«
»Nun, wir werden sehen.« Ali legte seinen Mantel wieder ab. »Lasst mich jetzt bitte mit ihr allein. Sobald ich die Untersuchung abgeschlossen habe, werde ich Euch meine Ergebnisse mitteilen.«
Der Emir schnappte sichtlich wütend nach Luft. »Beim Barte des Propheten, ich habe ein Recht darauf!«, schrie er voller Zorn. »Sie ist meine Sklavin!«
Schweigend begann Ali erneut damit, seinen Mantel anzuziehen.
»Halt! Wartet!«, rief der Emir verzweifelt. »Im Namen Allahs, ich werde Euch bei der Untersuchung allein lassen. Aber nur unter einer Bedingung. Jussuf wird bei Euch bleiben.«
Ali warf einen kurzen Blick auf den hünenhaften, muskelbepackten Eunuchen, der ihn so grimmig anstarrte, als hätte er bereits versucht sich an der kostbaren Sklavin zu vergehen.
»Gut«, erwiderte Ali gnädig. »Sofern er mich bei meiner Arbeit nicht behindert, kann er bleiben.«
»Ich hoffe, Ihr wisst das Vertrauen zu schätzen, das ich Euch entgegenbringe, Ali al-Hussein.«
»Gewiss, mein Fürst«, entgegnete Ali unter einer leichten Verbeugung. »Ich werde Euch nicht enttäuschen.«
Nuh II. warf ihm noch einen langen, zornigen, gequälten Blick zu, dann stampfte er aus dem Raum und ließ die Tür lautstark hinter sich zufallen. Ali lächelte. Patienten, und besonders Nuh II. ibn Mansur, waren wie Kinder. Sie versuchten mit Trotz und Wut ihren eigenen Willen durchzusetzen. Und wie Eltern, so musste auch der Arzt manchmal zum Besten der ihm Anvertrauten unnachgiebig bleiben. Natürlich hätte der Emir bei der Untersuchung der Sklavin zusehen können. Es hätte Ali in seiner Arbeit nicht gestört. Aber dies war der erste Kampf mit Nuh II. um seine Autorität als Leibarzt gewesen. Und wenn er nicht mit ihm in Zukunft über jede ärztliche Anordnung streiten wollte, so musste er in diesem Fall hart bleiben. Ali ging auf die verschleierte Frau zu, die weder ihren Kopf hob noch sonst eine Regung zeigte. Ob sie vielleicht ihr Gehör verloren hatte? Unvermittelt klatschte er einmal laut in die Hände. Die Frau zuckte vor Schreck zusammen und warf ihm einen kurzen Blick zu, um gleich darauf wieder in ihre Erstarrung zu fallen.
»Taub bist du jedenfalls nicht.«
Er trat näher, ohne dass die Sklavin ihm Beachtung geschenkt hätte. Erst als er vorsichtig den Schleier öffnete, der Gesicht und Haar verhüllte, sah sie ihn an, als würde sie langsam aus einem Traum erwachen. Ali ließ den Schleier von ihrem Kopf gleiten und hielt unwillkürlich den Atem an. Er begriff, weshalb der Emir diese Sklavin nicht wieder an Omar al-Fadlan zurückgeben wollte, nicht zurückgeben konnte. Sie war keine üppige Schönheit, wie er und die meisten Männer, die er kannte, sie normalerweise bevorzugte. Ihre schlanke, hoch gewachsene Gestalt, der jegliche weibliche Rundungen zu fehlen schien, zeichnete sich deutlich unter ihrem Gewand aus silberdurchwirktem dunkelblauem Samt ab. Ihr Gesicht war schmal, und die weiße Haut spannte sich über ausgeprägten Wangenknochen. Sie sah fast ein wenig unterernährt aus, und Ali erinnerte sie an eine magere Ziege. Doch ihre Augen! Diese Augen waren blau, so blau wie der Himmel kurz vor Einbruch der Dämmerung, und ihr helles Haar schimmerte wie Sternenlicht. Sie sah aus wie eine Fee in einer der Geschichten, die der Märchenerzähler auf dem Markt immer zum Besten gab.
»Ich heiße Ali al-Hussein ibn Abdallah ibn Sina«, begann er und fragte sich im selben Augenblick verwundert, weshalb er sich bei ihr vorstellte. »Ich bin Arzt und werde dich jetzt untersuchen.«
Bildete er es sich nur ein, oder leuchtete bei seinen Worten in den blauen Augen der Sklavin Interesse auf? Während er behutsam ihren Kopf abzutasten begann, in ihre Augen und in ihren Mund sah, gingen eine Menge Gedanken in seinem Kopf umher. Ali hätte viel darum gegeben, wenn er seine Hände noch länger über ihren wohlgeformten Schädel und durch ihr seidiges helles Haar hätte gleiten lassen dürfen. Aber er war klug genug, sich diesen Wunsch nicht zu erfüllen. Jussuf ließ ihn nicht für einen Wimpernschlag aus seinen Augen und folgte jeder seiner Bewegungen mit grimmiger Miene. Und Ali zweifelte nicht daran, dass der Eunuch bereit war, das drohend blitzende Schwert an seinem Gürtel auch zu benutzen.
Der gesundheitliche Zustand der Sklavin versetzte Ali in Erstaunen. Er konnte keine Anzeichen für ein Gebrechen, eine Schwangerschaft oder eine ansteckende Krankheit finden, die ihren Gemütszustand erklärt hätten. Am meisten überraschten ihn jedoch die Zähne der Sklavin, die aussahen wie weiße, schimmernde Perlen. Nicht ein einziger Zahn fehlte, nicht einer war beschädigt oder krank oder verließ die gerade, vollendete Reihe seiner Brüder. Es war das Gebiss einer sehr jungen, gesunden Frau. Den Zähnen nach hätte er sie höchstens für dreizehn oder vierzehn gehalten. Aber wenn er ihr in die Augen sah, hatte er den Eindruck, dass sie viel älter war, vielleicht sogar älter als er selbst. Ali runzelte die Stirn.
»Ich möchte doch zu gerne wissen ...«, murmelte er. »Wie ist dein Name?«, fragte er sie auf Latein, wobei er möglichst langsam und deutlich sprach. Es war eine Sprache, die er bereits seit seiner frühen Kindheit fließend in Wort und Schrift beherrschte. Dennoch kam es ihm vor, als würde seine Zunge am Gaumen kleben und nur widerwillig die vertrauten Worte hervorbringen. Warum war er so nervös? Die Frau vor ihm war doch nichts weiter als eine Sklavin.
Aufmerksam sah sie Ali an. Ihr Gesicht spiegelte deutlich die Anstrengung wider, seine Worte zu verstehen. Schließlich leuchtete es in ihren Augen auf, als sie offensichtlich den Sinn erfasst hatte. Mit vor Aufregung heiserer Stimme antwortete sie in einer seltsamen Sprache, deren Klang Ali noch nie zuvor vernommen hatte. Sie bemerkte, dass er sie nicht verstand, schüttelte den Kopf, versuchte es in einer anderen Sprache, die ihm ebenso fremd war, zuckte mit den Schultern und sagte dann langsam und in gebrochenem, schwer verständlichen Latein: »Heißen Beatrice Helmer.«
»Beatrice?«
Sie nickte und deutete auf Ali. »Arzt?«
»Ja, ich bin Arzt. Fehlt dir etwas? Hast du Schmerzen?«
Sie schüttelte heftig den Kopf und deutete dann auf sich. »Arzt. Beatrice Arzt. In Hamburg.«
Ali sah die Sklavin entgeistert an. Was wollte sie damit sagen? Wenn er sie richtig verstand, dann behauptete diese Frau, dass sie Arzt sei. Und was bedeutete dieses »Hamburg«? War das ein Ort? Ali wurde es unheimlich zumute, ein eiskalter Schauer lief seinen Rücken hinab. Er begann die Frauen im Harem des Emirs zu verstehen. Entweder hatte er es tatsächlich mit einer Hexe aus einem fernen, unbekannten Land zu tun, oder aber die Sklavin war einfach verrückt. In beiden Fällen wäre es besser, sich dieser Frau rasch zu entledigen und sie wirklich wieder in die Wüste zu bringen, bevor sie irgendwelchen Schaden anrichten konnte. Er wollte sich schon zurückziehen, um dem Emir seinen Vorschlag nochmals nahe zu legen, da kam ihm ein Gedanke, wie er die Sklavin auf die Probe stellen konnte. Wenn sie tatsächlich eine Heilkundige war, gleich, aus welchem Land sie stammte, müsste sie dann nicht wenigstens einige seiner Instrumente erkennen? Ali öffnete seine Tasche, holte die Instrumente hervor und legte sie nebeneinander auf eines der seidenen Kissen. Dann winkte er die Sklavin zu sich, die ihm neugierig zugesehen hatte.
»Kennst du diese Instrumente?«, fragte Ali langsam und deutete auf das Kissen.
Aufmerksam beobachtete Ali, wie die Sklavin den Kauter, die Skalpelle und die Zangen betrachtete. Nichts in ihrem Gesicht oder ihren Augen ließ ein Wiedererkennen vermuten. Im Gegenteil, sie machte sogar einen verwirrten Eindruck. Dann fiel sein Blick auf ihre Hände. Sie waren feingliedrig und schmal wie die Hände einer hoch gestellten Frau. Aber die Haut war rau und gerötet, als hätte sie ihre Tage mit Wäschewaschen verbracht.
Und du willst Arzt sein?, dachte Ali verärgert. Wie hatte er sich nur dazu hinreißen lassen können, einem Waschweib seinen Namen zu nennen? Voller Verachtung sah er zu, wie die Sklavin ein Skalpell in die Hand nahm. Im nächsten Augenblick wurde ihm heiß und kalt zugleich. Was für einen Fehler hatte er begangen! Wenn sie keine Heilkundige war, so war sie wahnsinnig, und er hatte einer Verrückten Zugriff zu einem scharfen Messer verschafft. Unwillkürlich wich er einen Schritt zurück und hoffte, dass Jussuf die Situation verstehen und rechtzeitig eingreifen würde, bevor sich die Sklavin mit dem Messer auf ihn stürzen konnte. Doch dann begegnete er ihrem Blick, und dieser Blick verwirrte ihn mehr als alles andere vorher. In diesen blauen Augen glühte nicht der Wahnsinn oder der Wunsch, ihn umzubringen. Hier las er Verwirrung, Verzweiflung und Spott. Es kam ihm vor, als ob ihm die seltsame Sklavin die gleiche Frage stellen wollte, die er noch vor wenigen Augenblicken in Gedanken an sie gerichtet hatte.
Hastig nahm er ihr das Skalpell aus der Hand und wandte sich ab, um die Instrumente wieder in seiner Tasche zu verstauen – vor allem aber um ihrem verachtungsvollen Blick zu entgehen.