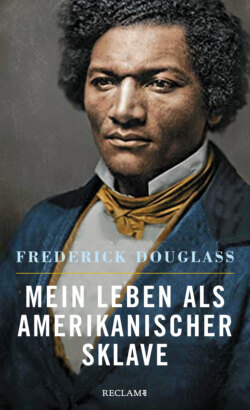Читать книгу Mein Leben als amerikanischer Sklave - Frederick Douglass - Страница 6
Drittes Kapitel
ОглавлениеColonel Lloyd unterhielt einen großen und sorgsam kultivierten Garten, der neben dem Chefgärtner (Mr M’Durmond) vier Männern fast ständige Beschäftigung bot. Wahrscheinlich war dieser Garten die größte Attraktion des Ortes. Während der Sommermonate kamen Leute von nah und fern – aus Baltimore, Easton und Annapolis –, um ihn zu besichtigen. Er strotzte von Früchten fast jeder Art, vom robusten Apfel des Nordens bis zur empfindlichen Orange des Südens. Dieser Garten war nicht die geringste Quelle von Ärger auf der Plantage. Für die hungrigen Schwärme kleiner Jungen stellten seine vorzüglichen Früchte eine ziemliche Versuchung dar, aber auch für die älteren Sklaven, die dem Colonel gehörten und von denen nur wenige die Tugend oder Untugend besaßen, ihr zu widerstehen. Im Sommer verging kaum ein Tag, an dem nicht irgendein Sklave wegen Obstdiebstahls ausgepeitscht wurde. Der Colonel musste zu allen möglichen Listen greifen, um seine Sklaven vom Garten fernzuhalten. Die letzte und erfolgreichste bestand darin, den Zaun rundum mit Teer zu bestreichen. Wurde ein Sklave danach mit Teer am Leib oder an der Kleidung ertappt, galt dies als hinreichender Beweis dafür, dass er sich entweder im Garten aufgehalten oder versucht hatte, hineinzugelangen. In beiden Fällen wurde er vom Chefgärtner schwer gezüchtigt. Der Plan ging auf; vor Teer fürchteten sich die Sklaven ebenso wie vor der Peitsche. Sie schienen einzusehen, dass es unmöglich war, Teer zu berühren, ohne sich zu besudeln.
Auch einen prachtvollen Reitstall unterhielt der Colonel. Stallung und Kutschenhaus hatten das Aussehen einiger unserer großen städtischen Mietställe. Seine Pferde waren von feinstem Wuchs und edelstem Blut. Das Kutschenhaus enthielt drei prächtige Kutschen, drei oder vier Gigs, außerdem höchst elegante Dearborns und Barouches.
Diese Einrichtung war der Obhut von zwei Sklaven anvertraut – dem alten Barney und dem jungen Barney, Vater und Sohn. Ihre einzige Arbeit bestand darin, sich um die Stallungen zu kümmern. Aber das war keineswegs eine leichte Arbeit, denn in nichts war Colonel Lloyd heikler als in der Haltung seiner Pferde. Die geringste Unaufmerksamkeit ihnen gegenüber war unverzeihlich und wurde denjenigen, unter deren Obhut sie standen, mit härtesten Strafen vergolten; keine Entschuldigung schützte sie, wenn der Colonel mangelnde Aufmerksamkeit seinen Pferden gegenüber auch nur argwöhnte – ein Argwohn, den er häufig hegte und der das Amt des alten und des jungen Barney natürlich zu einem äußerst aufreibenden machte. Sie wussten nie, wann sie vor Bestrafung sicher waren. Oft wurden sie ausgepeitscht, wenn sie es am wenigsten verdienten, und entgingen der Auspeitschung, wenn sie es am meisten verdienten. Alles hing vom Aussehen der Pferde ab und von Colonel Lloyds Gemütsverfassung, wenn ihm die Pferde zugeführt wurden. Bewegte sich ein Pferd nicht schnell genug oder hielt es den Kopf nicht hoch genug, war dies das Verschulden der Wärter. Es war schmerzhaft, in der Nähe der Stalltür zu stehen und die verschiedenen Beschwerden über die Wärter anzuhören, wenn ein Pferd aus dem Stall gebracht wurde: Das Pferd sei vernachlässigt worden. Es sei nicht hinreichend abgerieben und gestriegelt oder nicht richtig gefüttert worden; sein Futter sei zu nass oder zu trocken gewesen; es habe sein Futter zu früh oder zu spät bekommen; ihm sei zu heiß oder zu kalt; es habe zu viel Heu und nicht genug Getreide; oder es habe zu viel Getreide und nicht genug Heu; statt dass sich der alte Barney um das Pferd kümmere, sei es unpassenderweise seinem Sohn überlassen worden. Auf alle diese Beschwerden, so ungerecht sie auch sein mochten, durfte der Sklave kein Wort entgegnen. Von einem Sklaven duldete Colonel Lloyd keinen Widerspruch. Wenn er sprach, musste der Sklave dastehen, zuhören und zittern; und das war buchstäblich der Fall. Ich habe gesehen, wie Colonel Lloyd den alten Barney, einen Mann zwischen fünfzig und sechzig, dazu zwang, seinen kahlen Schädel zu entblößen, auf der kalten, feuchten Erde niederzuknien und mehr als dreißig Peitschenhiebe auf seine nackten und von harter Arbeit gebeugten Schultern entgegenzunehmen. Colonel Lloyd hatte drei Söhne – Edward, Murray und Daniel – und drei Schwiegersöhne, Mr Winder, Mr Nicholson und Mr Lowndes. Sie alle lebten auf der Great House Farm und genossen den Luxus, die Bediensteten nach Belieben auspeitschen zu können, vom alten Barney bis hinunter zu William Wilkes, dem Kutscher. Ich habe gesehen, wie Winder einen der Hausdiener in angemessener Entfernung Aufstellung nehmen ließ, um ihn mit dem Ende seiner Peitsche zu berühren, und wie sich auf dessen Rücken bei jedem Hieb große Striemen bildeten.
Colonel Lloyds Wohlstand zu beschreiben käme fast einer Beschreibung der Reichtümer Hiobs gleich. Er hielt etwa zehn bis fünfzehn Hausangestellte. Es hieß, er besitze tausend Sklaven, und ich glaube, diese Schätzung entspricht ganz der Wahrheit. Colonel Lloyd besaß so viele, dass er sie nicht erkannte, wenn er sie sah; auch kannten ihn nicht alle Sklaven auf den Außenfarmen. Es wird von ihm berichtet, dass er, als er eines Tages die Straße entlangritt, einem Farbigen begegnete und ihn in der üblichen Art und Weise ansprach, in der man auf den öffentlichen Straßen des Südens mit Farbigen redet: »Nun, mein Junge, wem gehörst du?« »Colonel Lloyd«, antwortete der Sklave. »Und, behandelt der Colonel dich gut?« »Nein, Sir«, war die prompte Antwort. »Was, er lässt dich zu hart arbeiten?« »Jawohl, Sir.« »Gibt er dir denn nicht genug zu essen?« »Doch, Sir, er gibt mir genug, was man so genug nennt.«
Der Colonel, nachdem er sich vergewissert hatte, wohin der Sklave gehörte, ritt weiter; auch der Mann ging seiner Arbeit nach und ahnte nicht, dass er sich mit seinem eigenen Herrn unterhalten hatte. Er dachte nicht länger an die Angelegenheit und sagte und hörte nichts mehr davon. Erst zwei oder drei Wochen später wurde dem armen Mann von seinem Aufseher mitgeteilt, man werde ihn an einen Händler in Georgia verkaufen, weil er seinen Herrn kritisiert habe. Sogleich wurde er mit Handschellen gefesselt und in Ketten gelegt; und so wurde er ohne die geringste Vorwarnung fortgeschafft und für immer von seiner Familie und seinen Freunden getrennt, von einer Hand, die unerbittlicher war als der Tod. Dies ist die Strafe dafür, wenn man die Wahrheit sagt – wenn man als Antwort auf eine Reihe einfacher Fragen die schlichte Wahrheit sagt.
Es ist zum Teil die Folge solcher Umstände, dass Sklaven, wenn man sie nach ihren Lebensbedingungen und dem Charakter ihrer Herren befragt, fast durchgängig antworten, sie seien zufrieden, ihre Herren seien gütig. Es ist bekannt, dass die Sklavenhalter Spione unter ihre Sklaven einschleusen, um deren Ansichten und Gefühle zu ihren Lebensbedingungen zu ermitteln. Die Häufigkeit dieses Vorgehens hat dazu geführt, dass sich unter den Sklaven die Maxime »Eine stille Zunge macht einen klugen Kopf« durchgesetzt hat. Lieber unterdrücken sie die Wahrheit, als dass sie die Konsequenzen auf sich nehmen, die sich ergeben, wenn sie sie aussprechen, und mit diesem Verhalten erweisen sie sich als Teil der menschlichen Familie. Wenn sie überhaupt etwas über ihre Herren zu sagen haben, dann meist zu deren Gunsten, besonders wenn sie mit einem ungeprüften Menschen sprechen. Als ich noch ein Sklave war, wurde ich oft gefragt, ob ich einen gütigen Herrn hätte, und ich erinnere mich nicht, jemals eine negative Antwort gegeben zu haben; noch glaube ich, bei der Verfolgung dieses Kurses die reine Unwahrheit geäußert zu haben; denn die Güte meines Herrn habe ich stets an dem Maßstab der Güte gemessen, den die Sklavenhalter um uns herum aufstellten. Zudem sind Sklaven genau wie andere Menschen und übernehmen gern weitverbreitete Vorurteile. Ihre eigene Lage halten sie für besser als die der anderen. Unter dem Einfluss dieses Vorurteils halten viele ihren eigenen Herrn für besser als die Herren anderer Sklaven; mitunter sogar dann, wenn das genaue Gegenteil der Fall ist. In der Tat ist es nicht ungewöhnlich, dass Sklaven sich über die vergleichsweise Güte ihrer Herren streiten und entzweien, wobei jeder behauptet, die Güte seines eigenen Herrn übertreffe die der anderen Herren. Gleichzeitig verfluchen sie ihre jeweiligen Herren, wenn sie sie gesondert würdigen. So war es auch auf unserer Plantage. Wenn Colonel Lloyds Sklaven den Sklaven von Jacob Jepson begegneten, schieden sie selten voneinander ohne einen Streit über ihre Herren; die Sklaven von Colonel Lloyd behaupteten, dieser sei der Reichste, die von Mr Jepson, dieser sei der Klügste und der Männlichste. Die Sklaven von Colonel Lloyd prahlten mit dessen Fähigkeit, Jacob Jepson jederzeit kaufen und verkaufen zu können. Die Sklaven von Mr Jepson prahlten mit dessen Fähigkeit, Colonel Lloyd jederzeit auspeitschen zu können. Derartige Streitigkeiten endeten fast immer in einem Handgemenge zwischen den Parteien, und diejenigen, die es mit dem Auspeitschen hielten, hatten die Streitfrage vermeintlich für sich entschieden. Sie schienen zu glauben, dass die Größe ihrer Herren auf sie selbst übertragbar sei. Sklave zu sein galt als schlimm genug; doch Sklave eines armen Mannes zu sein wurde als regelrechte Schande erachtet!