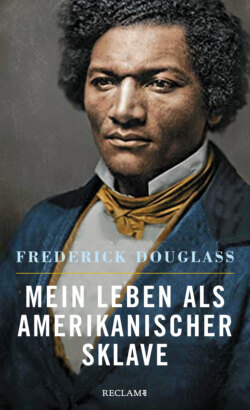Читать книгу Mein Leben als amerikanischer Sklave - Frederick Douglass - Страница 9
Sechstes Kapitel
ОглавлениеMeine neue Herrin erwies sich als genau das, was sie zu sein schien, als ich ihr das erste Mal an der Tür begegnete – als eine Frau mit dem gütigsten Herzen und den feinsten Empfindungen. Vor mir hatte ihr noch nie ein Sklave unterstanden, und vor ihrer Heirat war sie für ihren Lebensunterhalt auf den eigenen Fleiß angewiesen gewesen. Sie war Weberin von Beruf, und dank ihres unermüdlichen Einsatzes für ihr Gewerbe war sie vor den verderblichen und entmenschlichenden Auswirkungen der Sklavenhaltung in erheblichem Maße bewahrt worden. Ihre Güte versetzte mich in großes Staunen. Ich wusste kaum, wie ich mich ihr gegenüber verhalten sollte. Sie war vollkommen anders als jede andere weiße Frau, die ich je gesehen hatte. So, wie ich es bei anderen weißen Frauen gewohnt war, konnte ich mich ihr nicht nähern. Meine frühe Erziehung war nun völlig fehl am Platz. Geduckte Unterwürfigkeit, bei einem Sklaven normalerweise eine so akzeptable Eigenschaft, taugte nichts, wenn ich sie ihr gegenüber an den Tag legte. Ihre Gunst konnte ich damit nicht gewinnen; eher schien sie sich daran zu stören. Sie empfand es nicht als unverschämt oder unmanierlich, wenn ein Sklave ihr ins Gesicht blickte. Dem gemeinsten Sklaven wurde in ihrer Gegenwart die Befangenheit genommen, und keiner ging, ohne sich besser zu fühlen, weil er sie gesehen hatte. Ihr Gesicht war von himmlischem Lächeln und ihre Stimme von ruhiger Musik.
Aber ach!, dieses gütige Herz hatte nur wenig Zeit, so zu bleiben, wie es war. Das tödliche Gift unverantwortlicher Macht lag bereits in ihren Händen und begann in Kürze sein teuflisches Werk. Unter dem Einfluss der Sklaverei wurde das heitere Auge bald rot vor Zorn; die Stimme süßen Wohllauts verwandelte sich in eine Stimme harten und hässlichen Missklangs; und das engelsgleiche Gesicht wich dem eines Dämons.
Sehr bald, nachdem ich zu Mr und Mrs Auld gezogen war, begann sie freundlicherweise, mir das ABC beizubringen. Nachdem ich dieses erlernt hatte, half sie mir, Wörter mit drei oder vier Buchstaben zu buchstabieren. Als ich eben so weit fortgeschritten war, fand Mr Auld heraus, was vor sich ging, und verbot Mrs Auld sogleich, mich weiter zu unterrichten, indem er ihr unter anderem sagte, es sei nicht nur ungesetzlich, sondern auch gefährlich, einem Sklaven das Lesen beizubringen. Um seine eigenen Worte zu verwenden: »Wenn du einem Nigger den Finger reichst, nimmt er gleich die ganze Hand. Ein Nigger sollte nichts weiter können, als seinem Herrn zu gehorchen – zu tun, was man ihm sagt. Lernen würde den besten Nigger der Welt verderben. Nun«, fuhr er fort, »wenn du diesem Nigger (er sprach von mir) das Lesen beibringst, wäre er nicht mehr zu halten. Es würde ihn als Sklaven für immer unbrauchbar machen. Er würde sofort aufsässig und wäre ohne jeden Wert für seinen Herrn. Ihm selbst würde es nichts nützen, sondern erheblich schaden. Es würde ihn unzufrieden und unglücklich machen.« Diese Worte drangen tief in mein Herz, weckten schlummernde Gefühle in mir und lösten einen völlig neuen Gedankengang aus. Es war eine neue und ungewöhnliche Offenbarung, die jene dunklen und geheimnisvollen Dinge erklärte, mit denen mein jugendlicher Verstand zwar gerungen, jedoch vergeblich gerungen hatte. Nun endlich begriff ich, was eine höchst verwirrende Angelegenheit für mich gewesen war – nämlich die Macht des weißen Mannes, den schwarzen Mann zu versklaven. Es war ein großer Triumph, den ich sehr zu schätzen wusste. Von diesem Moment an erkannte ich den Weg aus der Sklaverei in die Freiheit. Es war genau das, was ich wollte, und es geschah zu einer Zeit, da ich es am wenigsten erwartete. Während der Gedanke, die Unterstützung meiner gütigen Herrin zu verlieren, mich betrübte, freute ich mich über die unschätzbare Belehrung, die mir rein zufällig durch meinen Herrn zuteilgeworden war. Obwohl mir bewusst war, wie schwierig es sein würde, ohne Lehrerin zu lernen, begann ich voller Hoffnung und mit festem Vorsatz, lesen zu lernen, wie viel Anstrengung es mich auch kosten mochte. Die Entschiedenheit, mit der er gesprochen und sich bemüht hatte, seiner Frau die üblen Folgen meiner Unterweisung vor Augen zu führen, diente nur dazu, mich davon zu überzeugen, dass er sich der Wahrheiten, die er aussprach, zutiefst bewusst war. Das gab mir größte Zuversicht, dass ich mich vertrauensvoll auf die Resultate verlassen konnte, die sich, wie er sagte, aus dem Leseunterricht ergeben würden. Was er am meisten fürchtete, das wünschte ich mir am meisten. Was er am meisten liebte, das hasste ich am meisten. Was für ihn ein großes Übel war, das es sorgfältig zu meiden galt, war für mich ein hohes Gut, das es eifrig zu suchen galt; und das Argument, das er so energisch gegen das Lesenlernen vorbrachte, diente nur dazu, mich erst recht mit dem Wunsch und der Entschlossenheit zu beseelen, lesen zu lernen. Dass ich es lernte, verdanke ich also fast ebenso sehr dem erbitterten Widerstand meines Herrn wie der gütigen Unterstützung meiner Herrin. Ich erkenne den Beitrag beider an.
Ich hatte erst kurze Zeit in Baltimore gewohnt, als ich einen deutlichen Unterschied in der Behandlung der Sklaven beobachtete, im Vergleich zu dem, was ich auf dem Land erlebt hatte. Verglichen mit einem Plantagensklaven ist ein Stadtsklave geradezu ein freier Mann. Er ist viel besser genährt und gekleidet und genießt Privilegien, die dem Sklaven auf der Plantage gänzlich unbekannt sind. Es gibt hier einen Rest von Anstand, ein Gefühl der Scham, das viel dazu beiträgt, die Ausbrüche scheußlicher Grausamkeit, die sich so häufig auf der Plantage ereignen, zu hemmen und einzudämmen. Nur ein verzweifelter Sklavenhalter würde hier die Menschlichkeit seiner Nachbarn, die keine Sklaven halten, mit den Schreien seines geschundenen Sklaven schockieren. Nur wenige sind bereit, das Odium auf sich zu nehmen, das mit dem Ruf verbunden ist, ein grausamer Herr zu sein; vor allem aber möchten sie nicht dafür bekannt sein, dass sie einem Sklaven nicht genug zu essen geben. Jeder städtische Sklavenhalter ist darauf bedacht, dass man von ihm weiß, wie gut er seine Sklaven ernährt; und zu ihren Gunsten lässt sich sagen, dass die meisten von ihnen ihren Sklaven wirklich genug zu essen geben. Allerdings gibt es einige schmerzliche Ausnahmen von dieser Regel. In der Philpot Street direkt gegenüber von uns lebte Mr Thomas Hamilton. Er besaß zwei Sklavinnen. Sie hießen Henrietta und Mary. Henrietta war um die zweiundzwanzig Jahre alt, Mary etwa vierzehn; und von allen verstümmelten und ausgemergelten Kreaturen, die ich je gesehen habe, waren diese beiden die elendesten. Sein Herz musste härter sein als Stein, dass er sie so ungerührt betrachten konnte. Marys Kopf, Hals und Schultern waren buchstäblich in Stücke geschnitten. Oft betastete ich ihren Kopf und fand ihn fast ganz mit schwärenden Wunden bedeckt, verursacht von der Peitsche ihrer grausamen Herrin. Ich weiß nicht, ob auch ihr Herr sie jemals ausgepeitscht hat, aber ich war Augenzeuge der Grausamkeit Mrs Hamiltons. Ich hielt mich fast jeden Tag in Mr Hamiltons Haus auf. Mrs Hamilton saß immer in einem großen Sessel in der Mitte des Raumes, die schwere Peitsche aus roher Kuhhaut stets neben sich, und es verging kaum eine Stunde am Tag, die nicht vom Blut einer dieser Sklavinnen gezeichnet war. Nur selten gingen die Mädchen an ihr vorbei, ohne dass sie rief: »Mach schneller, du schwarze Gaunerin!« Gleichzeitig versetzte sie ihnen einen Peitschenhieb auf den Kopf oder auf die Schultern, wobei oft Blut floss. Dann rief sie: »Nimm das, du schwarze Gaunerin!«, und fuhr fort: »Wenn du nicht schneller machst, mach ich dir Beine!« Zusätzlich zu den grausamen Auspeitschungen, denen diese Sklavinnen ausgesetzt waren, wurden sie fast ausgehungert. Sie wussten kaum, was es bedeutet, eine volle Mahlzeit zu sich zu nehmen. Ich habe gesehen, wie Mary sich mit den Schweinen um die Fleischabfälle stritt, die auf die Straße geworfen wurden. Mary wurde so oft getreten und zerschlitzt, dass sie häufiger die »Zerhackte« gerufen wurde als mit ihrem richtigen Namen.