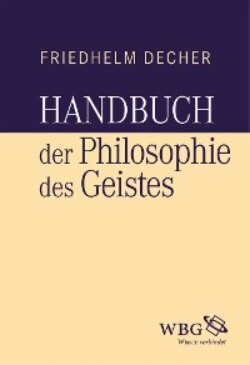Читать книгу Handbuch der Philosophie des Geistes - Friedhelm Decher - Страница 18
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Geist als höchste Funktion der Seele:
Aristoteles
ОглавлениеAristoteles (384/83–323/22 v. Chr.) war zwanzig Jahre Schüler Platons, bevor er eine eigene Schule gründete, in der er Lehrinhalte vortrug, die in mancher Hinsicht von denen seines Lehrers abwichen. So auch hinsichtlich der Seele und ihres Verhältnisses zum Körper. Für Aristoteles konstituiert sich ein Lebewesen aus Körper und Seele. Wenn er in seiner Schrift Über die Seele vorträgt, die Seele sei der „Grund der Lebewesen“2 und die Beseelung lege den Schnitt zwischen Belebtem und Unbelebtem, dann dokumentiert sich hierin die für die griechisch-antike Welt charakteristische Überzeugung, die Psyche stelle das belebende Prinzip dar, eine Überzeugung, die uns ja bereits wiederholt begegnet ist. Aristoteles will das so verstanden wissen, dass die Seele nicht vom Körper abtrennbar ist. Demnach bestreitet er eine vom Körper unabhängige Seele – und damit zugleich auch ihre Immaterialität. Allerdings will er seine Überzeugung, Körper und Seele machten zusammen das Lebewesen aus, nicht so gelesen haben, als sei die Seele der Körper, als seien beide identisch. Vielmehr, so stellt er klar, ist die Seele „etwas am Körper“, ist sie „in einem Körper“, und zwar „in einem so und so beschaffenen Körper“.3 Aber auch das wiederum darf man nicht so auffassen, als befinde sich die Seele in einem bestimmten Körperteil oder als sei sie mit einem bestimmten Teil des Körpers identisch. Nein was Aristoteles uns zu bedenken aufgeben will, ist: Die Seele ist, mit seinen Worten, die ein wenig der Erläuterung bedürfen, gesagt, „Wesenheit im Sinne der Form des natürlichen Körpers, der seiner Möglichkeit nach Leben hat“.4 Im Hintergrund dieser Sicht des Verhältnisses von Seele und Körper steht die Aristotelische Grundüberzeugung, alles Seiende bestehe einerseits aus Körper, Stoff, Materie (Hyle) und andererseits aus Form (Morphe), wobei die Materie, der Stoff, als bloße Möglichkeit begriffen wird, der durch die Form Wirklichkeit verliehen wird. Diese Lehre wurde später unter der Bezeichnung „Hylemorphismus“ tradiert. Im Blick auf Aristoteles’ Definition der Seele, der zufolge sie die Form des Körpers ist, ist damit zu verstehen gegeben: Die Seele verleiht dem Körper, der als solcher nur Möglichkeit ist, Wirklichkeit. Das heißt, sie formt das bloße Material, aus dem ein Organismus besteht, und strukturiert es so, dass der Organismus als ganzer funktioniert. Modern gesprochen könnte man sagen, die Seele ist die Struktur oder auch funktionale Organisation des Körpermaterials. Auf diese Weise verabschiedet Aristoteles Platons Vorstellung von den Seelenteilen und ersetzt sie dadurch, dass er der Seele bestimmte Funktionen, genauer gesagt: Lebensfunktionen, zuschreibt.
Was sind nun solche Lebensfunktionen? Zunächst sei daran erinnert, dass die Aristotelische Seelendefinition für alle belebten Körper, also alle Lebewesen gelten soll, mithin für Pflanzen, Tiere und Menschen gleichermaßen. Und als fundamentale Lebensfunktionen gelten ihm Ernährung, Stoffwechsel, Reproduktion sowie Wachstum und Vergehen. Diese fundamentalen Lebensfunktionen sind kennzeichnend für alle Pflanzen, Tiere und Menschen. Pflanzen, so fährt Aristoteles fort, verfügen nur über die genannten grundlegenden Funktionen. Andere Lebewesen, also Tiere und Menschen, besitzen weitere Funktionen, die sie in die Lage versetzen, Wahrnehmungen zu machen, Vorstellungen zu haben, Lust und Schmerz zu fühlen, etwas anzustreben – also etwas zu begehren – sowie sich im Raum fortzubewegen. Beim Menschen nun tritt nach Aristotelischer Psychologie eine weitere Funktion hinzu: die nämlich, zu denken.
Dergestalt hat Aristoteles ein Stufenmodell des Lebendigen, eine scala naturae entwickelt. Systematisiert man seine Ausführungen in der Schrift über die Seele, dann wird deutlich: Auf der Ebene der Pflanzen hat die Psyche die Funktionen, Ernährung, Stoffwechsel, Fortpflanzung, Wachstum und Vergehen zu organisieren. Dies ist später als vegetative Seele und als ‚Pflanzenseele‘ bezeichnet worden. Auf der Stufe der Tiere kommen als weitere Funktionen hinzu: Wahrnehmungen, Vorstellungen, Lust- und Schmerzempfindungen, Streben und Begehren, Ortsbewegung. Zusammengefasst haben wir es hier mit der animalischen Seele zu tun. Und auf der Stufe des Menschen schließlich ist die Psyche über all diese Funktionen hinaus zudem durch ‚Geist‘ ausgezeichnet: Hier hat sie auch die Funktion, zu denken.
Für unser Thema ist hieran vor allem zweierlei bemerkenswert.Zunächst als Erstes: Zwar stehen die drei Stufen des Lebendigen, die Aristoteles aufzählt, statisch übereinander – Aristoteles erkennt, mit anderen Worten, zwischen ihnen keinen dynamischen Zusammenhang, keinen evolutionären Prozess –; gleichwohl lässt sich aus ihnen eine Verbindung zwischen fundamentalen Lebensprozessen und affektiven und geistigen Funktionen herauslesen. Bezogen auf Affekte wird das von Aristoteles ausdrücklich hervorgehoben, schreibt er doch, die Affektionen und Affekte der Seele schienen ihm alle mit dem Körper verbunden zu sein. Als Beispiele führt er an: Zorn, Milde, Furcht, Mitleid, Wagemut, Freude, Liebe, Hass. Von ihnen allen, sagt er, werde „der Körper in Mitleidenschaft gezogen“: „Ein Zeichen dafür ist, daß man manchmal beim Vorliegen von starken und deutlichen Einwirkungen nicht in Erregung oder Furcht gerät, zuweilen aber von geringen und schwachen bewegt wird, wenn der Körper in Schwellung ist und es mit ihm so steht, wie wenn man im Zorne aufwallt. Noch auffälliger ist folgendes: Ohne daß etwas Furchterregendes vorliegt, gerät man in den Zustand dessen, der sich fürchtet. Wenn dem so ist, so ist klar, daß die Affekte materiegebundene Begriffe sind“.5 Damit tendiert sein Konzept in eine andere Richtung als dasjenige seines Lehrers Platon, der ja in einigen seiner Dialoge, wie wir gesehen haben, seinen Sokrates die Lehre von der Trennung von Seele und Körper vertreten ließ. Nun, ganz frei geworden von einer solchen Ansicht ist auch Aristoteles noch nicht, betont er doch wiederholt in seiner Schrift über die Seele, zwar nicht die Seele, jedoch der Geist sei vom Körper getrennt6 und man nehme mit gutem Grund nicht an, dass er mit dem Körper vermischt sei. Denn dann bekäme er ja eine bestimmte Beschaffenheit, würde etwa kalt oder warm7 – eine Vorstellung, die Aristoteles offenbar als abwegig erschienen ist.
Und dann als Zweites: Geist bestimmt Aristoteles näher als „Denkkraft“;8 seine „Bewegung“, schreibt er, sei das „Denken“.9 Dies bringt spezifische Konsequenzen für das Lebewesen Mensch mit sich, die Aristoteles in anderen Schriften herausgearbeitet hat. So bestimmt er in seiner Politikvorlesung den Menschen als dasjenige Lebewesen, das den „Logos“ besitzt.10 „Logos“ verwendet er hierbei in der doppelten Bedeutung von „Vernunft“ und (artikulierter) „Sprache“. In dieser Wesensdefinition des Menschen spricht sich mithin die Einsicht aus, der Mensch verfüge über Sprache, weil er Vernunft, oder zumindest Vernunftfähigkeit, besitze und ebendiese Vernunft in der artikulierten Sprache zum Ausdruck gelangt. Demnach hängen für Aristoteles Vernunft und Sprache aufs Engste zusammen: Über Sprache verfügen wir, weil wir vernünftig-geistige Lebewesen sind, und unsere Vernunft, unsere denkende Seele, artikuliert sich als Sprache. Näher besehen bedeutet das, vernunftgekoppelte sprachliche Verständigung dient nicht nur dazu, die jeweilige Befindlichkeit auszudrücken, sondern sie ermöglicht uns Einsicht, zielgerichtetes Wollen, bewusste Zwecksetzungen, das Formulieren abstrakter Gedanken und Ideen sowie deren Austausch mit anderen Menschen.
Seinen Schriften zur Ethik, etwa der Nikomachischen Ethik, lässt sich entnehmen: Weil der Mensch über eine denkende Seele, über Geist verfügt, ist er – als das einzige der Lebewesen – in der Lage, aufgrund von Überzeugungen und aus Gründen zu handeln. Zudem kann er seine Absichten, seine Handlungen sowie die Mittel, die er zwecks Erreichen seiner Absichten einzusetzen gedenkt, daraufhin befragen und beurteilen, ob sie den moralischen Standards, die in einer Gesellschaft gelten, entsprechen oder nicht, ob sie, anders gesagt, moralisch gut oder schlecht sind.
Nun war sich Aristoteles bei alldem durchaus darüber im Klaren, dass Menschen sich bei ihrem Handeln und Verhalten nicht immer oder überwiegend von vernünftigen Überlegungen, mithin von ihrem Geist leiten, sondern sich oft genug von ihren Affekten steuern lassen. Das rührt sicherlich auch daher, dass, wie er ausdrücklich betont, nicht alle Menschen in gleicher Weise über Denkkraft, sprich Geist, verfügen.11 Aber zumindest sind wir Menschen potentiell vernünftige, sind wir potentiell denkende Wesen. Und Aristoteles hat herausgearbeitet, welche Konsequenzen das für unser theoretisches wie praktisches Weltverhalten mit sich bringt – oder vorsichtiger formuliert: mit sich bringen könnte.
Zu diesen Konsequenzen rechnet er auch und insbesondere, dass uns als Geistwesen eine besondere Form von Glück, von Eudaimonia, erreichbar ist. Glück, so formuliert Aristoteles in der Nikomachischen Ethik als seine grundlegende Überzeugung, sei Tätigkeit im Sinne der Trefflichkeit beziehungsweise der Tugend – der Areté – der Seele. Und die beweist und bewährt sich als ethische Trefflichkeit im Treffen der Mitte zwischen extremen praktischen Verhaltensweisen. Im zehnten Buch der Nikomachischen Ethik nun ergänzt er diese Sichtweise um den bemerkenswerten Gedanken, die „höchste“ Areté sei die Tätigkeit der „obersten Kraft“, sei die Tätigkeit des Besten in uns – und das sei der Nous, der Geist. Diese Kraft, so ist Aristoteles überzeugt, sei „wesenhaft herrschend, führend, auf edle und göttliche Gegenstände gerichtet“.12 Und das konkretisiert er dahingehend, die Tätigkeit des Besten in uns, also des Geistes, sei ein „geistiges Schauen“, sei, wie er sagt, eine „betrachtende“ Tätigkeit, sei Theoria: ein betrachtendes Verweilen bei einer Sache, ein Sich-Versenken in einen, ein Aufgehen in einem Gegenstand. Ein solches geistiges Schauen begreift Aristoteles als „vollendetes“ Glück, womit er zu verstehen gibt: Ethisches Handeln ist durchaus als Glück zu begreifen; aber dieses Glück wird überboten durch dasjenige, das in und mit der geistigen Schau gegeben ist. Dies begründet er mit einer Reihe von Argumenten.13 Als erstes Argument führt er an, die betrachtende Tätigkeit sei die höchste Form menschlicher Tätigkeit, denn der Geist sei das Beste in uns, und den obersten Rang unter den Erkenntnisobjekten hätten die des Geistes inne. Zweitens können wir die betrachtende Tätigkeit des Geistes in stärkerem Maße als jede andere Tätigkeit ununterbrochen vollziehen. Ihr kommt also am meisten Dauer zu; und Dauer ist für Aristoteles ein nicht unwesentliches Moment des Glücks. Drittens ist Glück für Aristoteles mit Lustempfinden verbunden. Am lustvollsten von allen menschlichen Tätigkeiten nun ist für ihn das Tätigsein des betrachtenden Geistes – und zwar aufgrund seiner Reinheit und Beständigkeit. Zudem kommt, viertens, der geistigen Schau Autarkie im höchsten Maße zu, bedarf man doch zu ihrer Verwirklichung keines anderen Menschen. Während zum Beispiel der Gerechte anderer Menschen bedarf, denen gegenüber er seine Areté bewähren kann, kann man sich der geistigen Schau auch dann hingeben, wenn man ganz bei sich ist. Dergestalt genügt sich derjenige, der sich in die Theoria versenkt, selbst. Vielleicht, überlegt Aristoteles, gelingt ihm das geistige Betrachten besser, wenn er Freunde hat, die ihn dabei unterstützen; gleichwohl bleibt er der Unabhängigste. Fünftens ist die Tätigkeit des Geistes die einzige, die um ihrer selbst willen geliebt wird, geht es ihr doch rein um den Vollzug der geistigen Schau, während man vom praktischen Wirken neben dem bloßen Handeln noch mehr oder minder großen Gewinn haben kann.
Kurz und gut, aus all diesem folgt für Aristoteles, dass die geistige Tätigkeit „das vollendete Menschenglück darstellt, falls es ein Vollmaß des Lebens dauert“.14 Ein solches von der Theoria bestimmtes Leben hält Aristoteles nun selbst für „übermenschlich“, für ein Leben mithin, das höher steht, als es dem Menschen als Menschen zukommt. Und so betont er, man könne es in dieser Form nicht leben, sofern man Mensch ist, sondern nur insofern ein göttliches Element in uns wohne. Dieses göttliche Element in uns Menschen sei eben der Nous, der Geist. Daher kann er festhalten: „Ist also, mit dem Menschen verglichen, der Geist etwas Göttliches, so ist auch ein Leben im Geistigen, verglichen mit dem menschlichen Leben, etwas Göttliches“. Und er fordert uns auf, soweit wir können, „alles [zu] tun, um unser Leben nach dem einzurichten, was in uns das Höchste ist“.15 Denn ebendieses Höchste, der Geist, ist „unser wahres Selbst“, stellt es doch „den entscheidenden und besseren Teil unseres Wesens“ dar.16
Aristoteles unterstützt diese Überzeugung mit zusätzlichen Überlegungen, die ihren Ausgang von dem Volksglauben nehmen, die Götter seien die seligsten und glücklichsten Wesen. Den Göttern nun schreibt ebendieser Volksglaube zu, ihre Tätigkeit bestehe im reinen Betrachten, im rein geistigen Schauen. Folglich, schließt Aristoteles, hat jenes menschliche Tun, das dem Wirken der Gottheit am nächsten kommt, am meisten vom Wesen des Glücks in sich.
Glück im Sinne der Theoria, der betrachtenden, geistigen Schau zeichnet den Menschen, wie Aristoteles überdies darlegt, vor allen anderen Lebewesen aus. Kein anderes Lebewesen hat an diesem Glück teil, weil es neben dem Menschen kein Lebewesen gibt, das zu der betrachtenden Tätigkeit, die das Glück der Götter ausmacht, in der Lage wäre. Ganz pointiert formuliert er: In dem Maße, in dem sich die geistige Schau entfaltet, ist auch das Glück umfassend. Wer demnach ein aktives Leben des Geistes führt und den Geist pflegt, von dem darf man nach Aristoteles sagen, „sein Leben sei aufs beste geordnet und er werde von den Göttern am meisten geliebt“. So beschließt er seine Ausführungen über den Zusammenhang von Glück und Geist mit den Worten: „Daß dies aber im höchsten Grade bei dem Philosophen zu finden ist, darüber besteht kein Zweifel. Und so wird er von den Göttern am meisten geliebt. Als Liebling der Götter aber genießt er auch das höchste Glück. Und so ist also der philosophische Mensch auch von dieser Seite her im höchsten Maße glücklich“.17
Über das göttliche Leben und das geistige Schauen der Gottheit hat sich Aristoteles anderenorts näher ausgesprochen, nämlich im siebten und neunten Kapitel des zwölften Buchs seiner Metaphysik, in dem er seine ‚Theologie‘ formuliert. Dort legt er dar, unter allen Erscheinungen, die wir kennen, scheint uns das Höchste und Beste Vernunft, scheint Denken zu sein. Ja Vernunft und Denken gelten uns geradezu als „das Göttlichste“.18 Folglich müsse man sich, so Aristoteles weiter, das Sein der Gottheit als „Denken“ – Noesis – vorstellen. Das Denken nun kann sich entweder auf sich selbst oder auf etwas anderes, etwas von ihm Verschiedenes richten. Als höchstes Ziel schwebt allem Denken das Einswerden mit dem Gedachten vor. Dieses Ziel wird in vollkommener Weise dann erreicht, wenn sich das Denken auf sich selbst richtet, wenn es sich selbst zum Gegenstand hat. Und genau das ist für Aristoteles das Kennzeichen der geistigen Tätigkeit der Gottheit. Die geistige Tätigkeit der Gottheit kennt keine Trennung mehr zwischen Denken und Gegenstand; beides ist in ihr vollkommen eins. Das göttliche Denken, so lautet die berühmte Wendung des Aristoteles, ist „Denken des Denkens“ (Noesis noeseos). Eine vollkommenere geistige Tätigkeit ist uns nicht vorstellbar, denn ein Denken des Denkens ist ganz auf sich gerichtet, ist ganz bei sich, ist mithin im Vollsinn des Wortes autark, ist in sich vollendet und daher vollkommen.
Auf diese Weise gelingt es Aristoteles, indem er der geistigen Tätigkeit nachspürt, eine Verbindung zwischen Psychologie – der Lehre von der Seele – und Theologie – der Lehre von der Gottheit – herzustellen. Es ist demnach die geistige Tätigkeit, die es ihm ermöglicht, im Zuge ihrer Erforschung eine empirisch unterfütterte Seelenlehre mit einer spekulativen Theologie in Beziehung zu setzen: Ist doch die höchste Funktion der menschlichen Psyche die geistige, die denkende Tätigkeit, und charakterisiert eben sie in vollendeter und vollkommener Weise die Seinsweise der Gottheit.