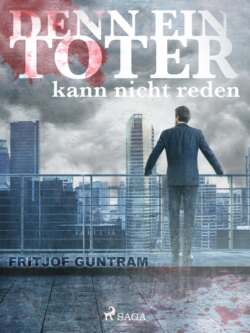Читать книгу Denn ein Toter kann nicht reden - Fritjof Guntram - Страница 4
ОглавлениеDas Haus Randolph Freemans, des Direktors der Freeman-Miller-Bank, lag in einem großen Park, der teilweise der Stadt Hamilton, teilweise aber auch zum Haus gehörte. Da keine Grenze zwischen beiden Teilen war, wirkte das ganze Anwesen sehr großzügig. Der breite Weg mit seinen hundertjährigen Eichen, welcher schnurgerade durch den Park hindurchführte, diente gleichzeitig auch als Auffahrt zu Freemans Haus, und wer ihn besuchte, hatte den Eindruck, einen König in seinem Schloß zu besuchen.
Das Gebäude selbst paßte würdig in diesen Rahmen. Es war ein großes, schneeweißes Holzhaus mit kleinen Erkern, einer weit vorspringenden, überdachten Terrasse und weißen Säulen vor dem Eingang. Es hatte früher einmal einem Bürgerkriegsgeneral als Ruhesitz gedient; man wurde an diese Tatsache durch eine kleine eiserne Kanone erinnert, welche auf dem gepflegten Rasen vor der Terrasse stand und die jeden Morgen von John, dem Diener Freemans, mit einem Metallputzmittel behandelt wurde. Freeman gab auf diese Weise seinen Sinn für die Tradition seines Landes kund, und seine Mitbürger in Hamilton wußten es an ihm zu schätzen, wie sie überhaupt vieles an ihm zu schätzen wußten. Randolph Freeman hatte für das neue Schulhaus zehntausend Dollar gestiftet, er arbeitete ehrenamtlich im Stadtrat mit und war Vorsitzender des Schulausschusses. Er war ferner im Vorsitz des Hamilton-Chors, arbeitete im Ausschuß zur Verschönerung der Grünanlagen mit und stiftete regelmäßig bei der großen Wohltätigkeitstombola, die von der Gattin des Bürgermeisters veranstaltet wurde, ein schönes Geschenk. Im vergangenen Jahr war es ein Nerzmantel gewesen, der heute noch das Gesprächsthema der Klatschbasen von Hamilton bildete.
Hauptberuflich leitete Freeman die Freeman-Miller-Bank, ein alteingeführtes Unternehmen, das bei den Geschäftsleuten der Umgebung einen guten Namen hatte. Seit dem Ausscheiden des alten Miller war Freeman der alleinige Chef der Bank, und zu dieser Position hatte er es hauptsächlich durch seine Heirat mit der Tochter des alten Miller gebracht. Miller war der Gründer der Bank gewesen; er hatte keinen Sohn und hatte es für das zweckmäßigste gehalten, Bank und Tochter in dieselben Hände zu geben. Freeman war ihm dafür als der geeignetste erschienen; er hatte genügend Geld mitgebracht, um als Geschäftspartner etwas darzustellen, und er hatte sich bereit gefunden, über kleine körperliche Mängel der Millertochter, die heimlich auf allen Parties besprochen wurden, hinwegzusehen.
Millers Hochzeitsgeschenk an Freeman war die Villa im Park gewesen — so wußte man es allgemein in der Stadt. Niemand hatte eine Ahnung davon, daß der alte Miller für alle möglichen Fälle Vorsorge getroffen hatte. In dem geheimen Vertrag zwischen ihm und Freeman hieß es, daß er die Villa sofort an den Alten zurückgeben mußte, wenn er sich von der Tochter scheiden ließ oder geschäftlich nicht mehr das Vertrauen des Alten genießen sollte. Umgekehrt war seine Stellung als Bankdirektor von der guten Durchführung seiner Ehe abhängig, und der alte Miller holte sich regelmäßig Bericht von seiner Tochter ein — was für Freeman keineswegs angenehm war. Diese Dinge geschahen geheim. Niemand hatte eine Ahnung davon, daß der alte Miller am Gashahn saß und ihn nach Belieben auf und zu drehen konnte.
Randolph Freeman empfand dies jedoch nicht als Nachteil. Miller konnte nicht ewig leben, und mit seinem Tode war er sein Nachfolger — der Nachfolger des reichsten und einflußreichsten Mannes der Gegend. Dafür hatte Freeman Jahrzehnte gearbeitet, wenn auch vielleicht das Wort Arbeit nicht ganz der richtige Ausdruck ist für das, was er tat.
An einem für die Gegend außergewöhnlich kalten Januartag jedoch veränderte sich die Lage plötzlich. Mit einem Schlage wurde Freeman vor Augen geführt, wie unsicher seine Position war und wie leicht sie gefährdet werden konnte — von jemandem, der die Vergangenheit des Bankdirektors kannte. Doch zunächst war Freeman noch ahnungslos.
Es hatte den ganzen Tag geregnet; gegen Abend setzte Nebel ein. Weiße Schwaden krochen durch den Park und hüllten das Haus ein. Es wurde schnell dunkel.
Freeman verließ den Rauchsalon und sagte John, er solle die Hintertür verschließen. Dann ging er in die Küche und überzeugte sich davon, daß der Wein kalt stand. Er erwartete noch Gäste. Bill Haines und seine Frau hatten zugesagt, zu einer Party Bridge zu kommen. Freeman sah auf die Uhr. Es war kurz nach acht.
Eleanor kam aus der Küche, wo sie mit Marthe, der Köchin, gesprochen hatte. Sie war eine große, hagere Frau, absolut nicht das, was man sexy nannte, aber sie konnte prächtig repräsentieren.
„John hat wieder die Kerzen vergessen“, sagte sie mit einem nervösen Blick auf den Bridgetisch. „Ich muß es ihm sagen. Kerzen wirken viel stilvoller. Wir müssen auf unseren Ruf achten.“
„Schon gut, Darling“, sagte Freeman und küßte sie flüchtig auf die Stirn. „Ich werde es ihm sagen.“
„Ich will nicht, daß du dich auch noch mit solchen Dingen abgeben mußt“, sagte sie, „die Bank nimmt dich schon genug in Anspruch. Wozu haben wir Personal? Wenn die Leute ihre Arbeit nicht richtig tun, werden wir sie entlassen und uns neue einstellen.“
„John ist über sechzig“, sagte Freeman, „er würde keine neue Stellung finden.“
„Was geht das mich an!“ erwiderte sie. „Man kann mir keine Schuld daran geben, wenn andere Leute alt werden.“
„Schon gut, Darling“, sagte Freeman und ging rasch zurück ins Rauchzimmer. Es hatte keinen Sinn, mit seiner Frau zu streiten. Ihr Vater würde zwölf Stunden später den Bericht in Händen halten mit allen Einzelheiten, dann würde er ihn anrufen: „Hören Sie, Randolph, ich finde, Sie haben Eleanor gegenüber etwas gutzumachen. Ich erwarte, daß Sie sich bei ihr entschuldigen. Würde es bedauern, wenn Sie es nicht täten.“ Und er würde es tun, denn der alte Miller war ein sturer Kerl, mit dem sich anzulegen keinen Sinn hatte. Freeman würde diese Bevormundung seiner Ehe nie ertragen, wenn er nicht auch seine Ehe als einen Teil seines Geschäftes betrachten würde.
Er zündete sich eine Zigarette an und starrte zum Fenster hinaus. Vom Park war nichts zu sehen. Das aus dem Zimmer fallende Licht brach sich im Nebel und erreichte nicht einmal den Erdboden.
Wenn der alte Miller nicht so kerngesund wäre. Dann könnte man etwas machen, irgend etwas — es würde ihm schon das Richtige einfallen. Aber so mußte er damit rechnen, daß Miller noch zehn Jahre lebte. Dann war er selbst schon Ende der Fünfzigerjahre. Sein Sohn Pat würde Mitte Zwanzig sein. Nein, es mußte etwas geschehen. Er mußte den Alten loswerden. Aber wie?
Freeman wandte sich vom Fenster ab, um sich einen Scotch zu mixen. Er nahm die Flasche aus dem Schrank und goß ein Glas halbvoll. Dann sah er, daß kein Sodawasser da war. Er dachte daran, daß in der Küche im Kühlschrank welches sein würde. Unschlüssig hielt er sein Glas in der Hand. Er nahm schließlich einen großen Schluck. Der Whisky brannte in der Kehle. Dann ging er durch den Flur in die Küche.
Marthe war nicht da. Er hörte sie im Wohnzimmer mit Eleanor sprechen. Die schrille Stimme seiner Frau drang durch das ganze Haus.
Der Kühlschrank stand neben der Glastür, welche zu der Veranda führte. An schönen Sommerabenden, wenn Gartenparties veranstaltet wurden, benützte man diese Tür, um die Speisen nach draußen zu bringen.
Freeman bückte sich ein wenig und öffnete die Tür des Kühlschrankes. Mit einer Flasche Sodawasser in der Hand richtete er sich wieder auf. Sein Gesicht war nur wenige Zentimeter von der Glastür entfernt. Plötzlich zuckte Freeman zusammen, ein eisiger Schreck durchfuhr ihn. Er starrte in ein fremdes Gesicht, in das Gesicht eines Mannes, der draußen vor der Glastür stand und ihn aus stechenden, dunklen Augen beobachtete.
Langsam löste sich Freeman aus seiner Erstarrung. Vorsichtig ging er rückwärts. Wenn es ihm gelang, mit einem Satz die angelehnte Tür zu erreichen und sich im Flur in Sicherheit zu bringen, war er gerettet. Im Rauchzimmer bewahrte er seinen Revolver auf.
Der Mann draußen hob den Arm und deutete gebieterisch auf den Hebel, mit dem die Glastür von innen verschlossen war. Freeman blickte verstohlen nach links. Er war vielleicht noch zwei Meter vom Ausgang entfernt.
In diesem Augenblick schien der Mann draußen seine Absicht erkannt zu haben. Blitzschnell hob er den Arm, Freeman sah etwas Metallisches blinken, dann zersplitterte die Scheibe. Freeman wagte nicht, sich zu rühren. Der Gegenstand, mit dem der Mann die Scheibe zerschlagen hatte, war ein Revolver. Und die Mündung dieses Revolvers zeigte genau auf ihn.
Freeman konnte jetzt das Gesicht des Mannes genauer erkennen. Es machte einen verstörten, gehetzten Eindruck. Die Haare hingen ihm wirr in die Stirn. Besonders auffällig war der Schnurrbart über seinen schmalen, zusammengepreßten Lippen. Er trug einen dunklen Anzug, der ebenfalls reichlich mitgenommen aussah.
Jetzt langte er mit der Revolverhand durch das Loch in der Scheibe und hebelte die Tür selbst empor. Gleich darauf trat er in die Küche. Der Revolver lag immer noch schußbereit in seiner Hand.
Freeman starrte ihm verstört ins Gesicht. Mein Gott, dieses Gesicht kannte er doch irgendwoher. Er hatte es vor vielen Jahren das letzte Mal gesehen, doch hatte sich dieser Anblick unauslöschlich in sein Gedächtnis eingeprägt. Nie würde er dieses Gesicht vergessen können. Viele Jahre hatte er gehofft, es nie wiedersehen zu müssen. Jetzt war diese Hoffnung tot.
„Archie“, stammelte er, „Archie Ballister! Wie kommst du hierher?“
Der unheimliche Besucher blickte ihn an, ohne das Gesicht zu verziehen.
„Ich sehe, du erinnerst dich noch an mich“, sagte er schließlich. Sein Mund bewegte sich kaum beim Sprechen. Seine Stimme klang tief und heiser.
„Natürlich, Archie, wie sollte ich dich je vergessen!“ Freeman schluckte. Was, zum Teufel, wollte Archie von ihm? Das letzte, was er von Archie gehört hatte, war, daß er nach Mexiko gegangen war. Das lag aber schon lange zurück, fast zwanzig Jahre. Die Dinge, wegen derer er damals das Land verlassen mußte, waren sicher längst verjährt. War er deswegen zurückgekommen?
„Warum hast du nicht vorher angerufen?“ tastete sich Freeman vor. „Ich hätte dich dann im Wagen abholen können, und wir hätten uns irgendwo in der Stadt treffen können!“ Alles Lüge, dachte er, wenn Archie sich vorher angemeldet hätte, hätte er zu seinem Revolver gegriffen und ihm gesagt, er solle sich zum Teufel scheren.
„Du weißt, daß ich Ueberraschungen liebe“, sagte Archie, der immer noch den Revolver auf Freeman gerichtet hielt. Er wies mit dem Kopf zur Tür. „Wer spricht da draußen?“
„Meine Frau“, sagte Freeman rasch.
„Sind noch mehr Leute im Haus?“ wollte Archie wissen.
„Die Köchin und der Diener“, sagte Freeman, „aber was soll das Ganze. Bist du vielleicht …“
„Red nicht so viel“, unterbrach ihn Archie, „wo können wir uns ungestört unterhalten?“
„Wir könnten zusammen in die Stadt fahren“, beeilte sich Freeman zu versichern, „wir können irgendwo essen — ich lade dich gerne ein.“
„Nein, ich werde hierbleiben“, erklärte Archie, „ich werde mich für einige Zeit bei dir niederlassen, und du wirst dafür sorgen, daß kein Mensch davon erfährt. Still!“
Im Flur hörte man Schritte. Marthe kam aus dem Wohnzimmer.
„Schaff sie weg“, zischte Archie.
Freeman ging zur Tür und öffnete sie. Marthe blieb erschrocken stehen.
„Oh je, Mr. Freeman, ich habe nicht gewußt, daß Sie da sind“, sagte sie.
„Gehen Sie zu meiner Frau, und fragen Sie sie, ob noch Sodawasser im Haus ist“, befahl ihr Freeman.
„Es steht welches im Kühlschrank, Mr. Freeman“, sagte sie eilig, „ich habe es erst vorhin kalt gestellt.“
„Es ist keines da“, sagte Freeman schneidend, „los, gehen Sie schon. Worauf warten Sie noch?“
Als die Köchin kopfschüttelnd verschwunden war, wandte sich Freeman um.
„Du mußt verschwinden, Archie“, sagte er, „hier im Haus kannst du nicht bleiben. Kein Mensch darf dich hier sehen.“
„Ich werde hierbleiben“, sagte Archie und hob den Revolver etwas in die Höhe, „und du wirst dafür sorgen, daß niemand etwas davon merkt. Ich habe mir das Haus vorhin gut angesehen. Unten ist ein großer Keller, da findet sich bestimmt ein sicherer Platz für mich.“
„Archie!“ Freeman stand der Schweiß auf der Stirn. „Ich weiß nicht, warum die Polizei hinter dir her ist. Es geht mich auch nichts an. Aber wenn sie dich bei mir finden, bin ich auch erledigt. Du kannst hier einfach nicht bleiben. Ich werde dir Geld geben, soviel du brauchst. Die mexikanische Grenze ist nicht weit …“
„Ich brauche kein Geld“, sagte Archie und holte ein Bündel Dollarnoten aus der Tasche, „ich kann dir sogar bezahlen, was du für mich ausgibst.“ Er warf das Bündel Freeman vor die Füße. „Was ich brauche, ist ein sicherer Platz, und den finde ich nur hier. Denn du darfst es nicht riskieren, daß die Polizei mich hier findet. Also hast du selbst das größte Interesse an meiner Sicherheit.“
„Ich bin nicht an den Verbrechen beteiligt, wegen derer du jetzt gesucht wirst“, erklärte Freeman verzweifelt.
„Aber du warst es einmal“, sagte Archie mit plötzlich schneidender Stimme, „wenn ich gewisse Einzelheiten aus deiner Vergangenheit bei der Polizei erzähle, ist es aus mit all dem, was du hier so großartig besitzt.“
„Also eine kleine Erpressung“, sagte Freeman und beherrschte sich nur mühsam.
„Genau“, sagte Archie, „und jetzt zeig mir, wo es in den Keller geht.“
Zähneknirschend stand Freeman da. Er wußte, daß es keinen Sinn hatte, sich Archie zu widersetzen. Sie waren vor vielen Jahren einmal Partner gewesen, und mit Schrecken erkannte Freeman jetzt, daß er diese Partnerschaft nicht einseitig lösen konnte, wie er dies viele Jahre geglaubt hatte.
Die Kellertreppe führte von der Küche aus nach unten, was sich jetzt als praktisch erwies. Sie brauchten nicht durch den Hausflur, wo sie leicht von John oder Marthe hätten gesehen werden können.
Unten führte ein langer Gang quer durch den ganzen Keller, zu dessen beiden Seiten die einzelnen Räume lagen. Archie ging langsam herum und ließ sich von Freeman erklären, was in den einzelnen Räumen war. Am Ende des Ganges lag die ehemalige Werkstatt des alten Miller. Freeman selbst hatte sie nie benutzt, doch waren die Werkzeuge alle noch vorhanden. Dieser Raum war neben dem Weinkeller als einziger abschließbar. Archie entschied sich dafür, hier einzuziehen.
„Ich brauche Matratzen, Decken und Waschzeug“, sagte er, „immerhin ist hier ein Wasseranschluß vorhanden. Du wirst mir alles noch heute herunterschaffen. Außerdem brauche ich eine Stange Zigaretten, — Filterzigaretten. Dann wäre es noch anständig, wenn du mir eine Flasche Whisky besorgst und mir jeden Morgen die neuesten Zeitungen bringst. Das wäre momentan alles.“
„Ich bringe dir alles, sobald ich es unauffällig machen kann“, versprach Freeman.
„Und noch etwas“, sagte Archie, „draußen auf dem Kiesplatz steht mein Wagen. Vielleicht stellst du ihn in die Garage — die Nummer ist bei der Polizei bekannt, und es könnte riskant sein, wenn ihn jemand sieht.“
„Was sagst du?“ Freeman brach der Schweiß aus. „Konntest du nicht deinen verdammten Wagen woanders lassen? Ich erwarte jeden Augenblick Gäste. Wenn einer davon den Wagen sieht, ist doch alles aufgeflogen.“
„Ich überlasse es dir, die Sache wieder in Ordnung zu bringen“, sagte Archie gleichmütig und steckte jetzt erst den Revolver weg. „Und vergiß nicht, alles, was du tust, tust du nicht für mich, sondern für dich.“
„Ja, Archie“, sagte Freeman gepreßt, „es ist gut, daß du mich daran erinnert hast. Ich hätte es sonst vergessen.“
Abrupt wandte er sich um und lief nach oben. In ihm kochte es. Daß Archie Ballister nach so vielen Jahren zurückgekehrt war, war so ziemlich das Unangenehmste, was ihm hatte passieren können. Und er war ganz in der Hand dieses Gauners. Am liebsten hätte er sich ans Telefon gehängt und die Polizei verständigt — aber damit hätte er sich selbst erledigt. Und weil er das so genau wußte, ließ er es bleiben.
Er sah zu, daß ihn oben niemand sah und verließ das Haus durch den Vordereingang. Das wichtigste war jetzt, daß er Archies Wagen versteckte, bevor er von jemandem gesehen wurde.
Auf dem Kiesplatz stand ein alter Chevrolet mit New Yorker Nummer. Das mußte der Wagen sein. Freeman hätte wetten wollen, daß Archie ihn gestohlen hatte.
Er war gerade im Begriff, einzusteigen, als er vom Weg her das Geräusch eines sich nähernden Wagens hörte. Das mußte Bill Haines mit seiner Frau sein. Freeman sah durch den Nebel die sich nähernden Scheinwerfer. Haines fuhr sehr langsam, aber es war trotzdem zu spät, den Chevrolet hinter das Haus zu fahren.
Freeman ging dem sich nähernden Fahrzeug entgegen und winkte. Haines fuhr bis an ihn heran und hielt dann.
„Da seid ihr ja“, rief Freeman, „ich habe mir Sorgen um euch gemacht. Dachte, ihr hättet einen Unfall durch den verdammten Nebel gehabt.“
„Das nicht“, antwortete Haines, und Freeman hoffte innerlich, er werde nicht in die andere Richtung sehen, wo der Chevrolet stand. „Wir wurden durch eine Polizeistreife aufgehalten“, fuhr Haines fort, „alle Ausfallstraßen aus Hamilton sind abgeriegelt. Sie suchen zwei schwere Jungen, die einen Raubmord verübt haben sollen. Man will einen von den beiden in Hamilton gesehen haben. Die Polizisten sagen, er fährt einen alten Chevrolet mit New Yorker Nummer. Na, und zufällig fahre ich auch einen Chevrolet. Deshalb wurden wir aufgehalten und kontrolliert.“
„Na, so was“, tat Freeman erstaunt, „was sollte denn ein Verbrecher in Hamilton suchen?“
„Das habe ich die Polizisten auch gefragt“, erzählte Haines, „aber man weiß ja, daß unser Polizeipräsident scharf auf eine Beförderung ist.“
„Ihr könnt gleich hinters Haus fahren“, sagte Freeman, „dann habt ihr es nicht so weit zu Fuß.“
„Okay“, brummte Haines und gab Gas. Langsam wälzte sich der Wagen über den Kiesplatz und bog um die Ecke. Freeman folgte ihm. Er fragte sich, ob es möglich war, daß Haines den groß und deutlich dastehenden Chevrolet nicht gesehen hatte.
Es schien so zu sein, denn als sie gemeinsam das Haus betraten, sagte Haines nichts davon. John stand im Flur und half den Gästen aus der Garderobe. Dann kam Eleanor. Nach der Begrüßung fragte sie Randolph, wo er die ganze Zeit gewesen wäre.
„Mir war nicht gut“, erzählte er, „ich bin an die Luft gegangen und habe draußen auf Haines gewartet.“
Man setzte sich an den kleinen Kartentisch. Randolph nahm die Karten und begann zu mischen. Plötzlich fiel ihm etwas ein. Er stand auf.
„Entschuldigt mich bitte einen Augenblick“, sagte er und lief hinaus. Draußen auf dem Gang stieß er auf Marthe.
Die Köchin sah ihn verstört an.
„Mr. Freeman, Sie müssen sofort kommen!“
„Was gibt’s denn?“ fragte Freeman, obwohl er genau wußte, was Marthe so in Aufregung gebracht hatte.
„Die Glastür in der Küche ist eingeschlagen. Es muß ein Einbrecher im Haus sein, Mr. Freeman. Wir müssen sofort die Polizei alarmieren.“
Freeman zwang sich ein kurzes Lachen ab.
„Ach, das ist es, Marthe. Beruhigen Sie sich, ich habe die Tür kaputtgemacht. Ja, das ist gar nicht komisch. Ich bin ausgerutscht und habe die Scheibe mit dem Ellbogen zerschlagen. Uebrigens, Sie können morgen der Aufwartefrau sagen, daß sie das Bohnern in Zukunft nicht mehr übertreibt. Ich bin zwar für saubere Böden, aber gegen eine Eisbahn im Haus.“
Er schenkte ihr einen aufmunternden Blick und ging wieder zurück ins Wohnzimmer. Hoffentlich erinnerte sie sich nicht daran, daß der Küchenboden gekachelt war und überhaupt nicht gebohnert wurde. Dieser Archie hatte ihn in eine verdammt unangenehme Lage gebracht. Man mußte ihn schleunigst loswerden. Aber er durfte wieder nicht riskieren, daß er der Polizei in die Hände fiel.
John tauchte auf mit einem Tablett voll Gläser und Flaschen. Die Damen tranken Likör, während Freeman und Haines Scotch nahmen. Die Unterhaltung kam in Gang, und Freeman war bemüht, sich so unbeschwert und gelöst wie möglich zu benehmen.
„Wer mit Randolph spricht, merkt gar nicht, daß er beruflich mit Bankgeschäften zu tun hat“, sagte Mrs. Haines, deren Mann ein bekannter Rechtsanwalt und Strafverteidiger war, und schenkte Freeman ihr bezauberndstes Lächeln.
„Ernst ist die Pflicht, heiter das Leben“, deklamierte Freeman nicht ganz richtig und breitete die Arme aus, „warum sollte ich meinen geschäftlichen Ernst in mein Privatleben übertragen. Das Leben ist kein russischer Roman.“
„Ganz recht, Darling“, bemerkte Eleanor, „die einzige Schwierigkeit des Lebens besteht darin, herauszufinden, wie man sich am besten amüsieren kann. Und das Problem, glaube ich, haben wir gelöst.“
„Ist das übrigens wahr, meine Liebe“, fragte Mrs. Haines, „daß Sie zum nächsten Unabhängigkeitstag aus Ihrer Kanone im Park Salut schießen wollen?“
„Oh, wer hat Ihnen das erzählt?“ wollte Mrs. Freeman wissen, geschmeichelt darüber, daß man ihr so etwas zutraute.
„Ich werde etwas Musik machen“, sagte Freeman und erhob sich. In der Ecke stand ein Musikschrank mit allen technischen Raffinessen, zweifellos das Teuerste, was es auf dem amerikanischen Markt gab. Freeman drehte an den Knöpfen, bis er Musik fand. Als er merkte, daß es klassische war, war es schon zu spät, da saß er wieder und wollte nicht noch einmal aufstehen.
„Mrs. Craig sagte es“, beantwortete Mrs. Haines die Frage von Mrs. Freeman.
„Uebrigens, Randolph“, sagte Haines, „der Traven Konzern wird voraussichtlich bald darangehen, einige Warenhäuser an der Ostküste aufzukaufen. Da diese Warenhäuser einer Aktiengesellschaft gehören, würde ich vorschlagen, ein hübsches, kleines Aktienpaket noch vorher aufzukaufen. Die Kurse sind zwar sehr hoch, werden aber weiter steigen, wenn die Leute erfahren, daß sich Traven dafür interessiert.“
„Das mit der Kanone ist eine sehr hübsche Idee“, sagte Eleanor zu Mrs. Haines, „aber ich fürchte, die würde beim ersten Schuß in die Luft gehen.“
„Ich habe schon immer geahnt, daß Traven so etwas vorhat“, meinte Freeman. „Ihr Tip könnte gut sein.“
„Er ist es“, versprach Haines, „ich habe es vom alten Traven persönlich erfahren. Ich kam mit ihm zusammen, weil sein Sohn einen Verkehrsunfall gebaut hatte. Volltrunkenheit am Steuer, verstehen Sie? Ich werde den Fall übernehmen. Uebrigens, wie geht es Ihrem Sohn?“
Freemans Gesicht verdüsterte sich.
„George ist seit drei Monaten weg. Ich glaube, er ist irgendwo im Norden. Wir bekamen einmal eine Karte von ihm aus New York. Es scheint, er fühlt sich ganz wohl dort.“
„Und Sie erlauben ihm, einfach zu verschwinden?“ verwunderte sich Haines.
„Was kann ich machen? George ist achtzehn. In dem Alter war ich auch schon selbständig. Ich kann ihn nicht zu Hause halten.“
„Sie sind immerhin der Vater und könnten ihn mit der Polizei zurückholen lassen!“ In Haines regte sich der Rechtsanwalt.
Freeman schüttelte den Kopf.
„Ausgeschlossen. Ich habe das schon mit Eleanor besprochen. Meine Frau und ich können uns keinen Skandal leisten. Wir lassen nicht zu, daß unser Sohn unsere gesellschaftliche Stellung zerstört.“
„Sie müssen wissen, was Sie tun“, brummte Haines, „mir jedenfalls wäre das Schicksal meines Sohnes nicht so gleichgültig.“
Einen Augenblick lang herrschte ein unbehagliches Schweigen zwischen ihnen, dann machte Freeman eine wegwerfende Handbewegung.
„Wir regen uns ja über harmlose Dinge auf“, lachte er, „ich möchte wetten, George sitzt in New York in einem komfortablen Appartement und läßt es sich gutgehen.“
Er wurde durch das Radio unterbrochen. Die Musik verstummte, und eine Stimme sagte:
„Achtung, Achtung, wir bringen eine wichtige Durchsage!“
„Schalt doch ab, Darling“, sagte Eleanor Freeman zu ihrem Mann, „was interessiert uns das?“
„Man kann ja warten, bis man weiß, worum es sich handelt“, meinte Haines.
„Na schön!“ Freeman zuckte die Schultern.
„Seit gestern“, fuhr die Stimme im Radio fort, „jagt die Polizei zwei flüchtige Schwerverbrecher, welche gemeinsam in Dover bei New York einen Raubmord begangen haben. Auf der Flucht wurden sie von einem Polizisten gestellt, der jedoch von einem der beiden Männer erschossen wurde. Dabei wurde einer der Männer erkannt. Es handelt sich um Archie Ballister, einen Verbrecher, der seit Jahren gesucht wird und vermutlich die letzten Jahre in Mexiko verbracht hat. Sein Komplice konnte nicht erkannt werden. Die beiden Verbrecher wurden heute früh in Athens im Staat Georgia in einem gestohlenen Wagen gesehen, konnten jedoch entkommen. Ihre letzte Spur führt nach Hamilton. Bürger von Hamilton! …“
„Das sind wir“, flüsterte Mrs. Freeman ziemlich überflüssig.
„Wer hat zwei verdächtige Männer gesehen?“ fuhr die Stimme fort, „wer hat einen alten Chevrolet mit New Yorker Nummer gesehen? Sachdienliche Mitteilungen nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.“
Die Stimme brach ab, und es setzte wieder Musik ein. Freeman hatte ein seltsames Gefühl in der Magengrube. Seine Gedanken kreisten um den im Keller sitzenden Archie Ballister. Mord war es also, weswegen er gesucht wurde. Raubmord! Und er, der Bankdirektor Freeman, mußte den Raubmörder schützen. So konnte das nicht lange gutgehen. Es mußte etwas geschehen.
„Was hast du, Darling?“ hörte er Eleanors Stimme neben sich.
„Nichts!“ Er fuhr sich mit der Hand geistesabwesend über die Stirn.
„Vielleicht hat ihn die Durchsage im Radio aufgeregt“, sagte Mrs. Haines.
Freeman fuhr hoch.
„Natürlich nicht.“ Er fuhr weniger heftig fort: „Ihr müßt entschuldigen. Ich bin überarbeitet. Spielen wir weiter.“ Er nahm die Karten hoch und begann sie zu verteilen.
Haines lehnte sich bequem zurück.
„Immerhin ist es doch ein unangenehmer Gedanke, daß hier in der Gegend zwei Raubmörder sein sollen. Ich würde mich in dieser einsamen Gegend nicht ganz wohl in meiner Haut fühlen.“ Er studierte nachdenklich seine Karten. „Wirklich“, sagte er, „es ist ein unangenehmer Gedanke.“