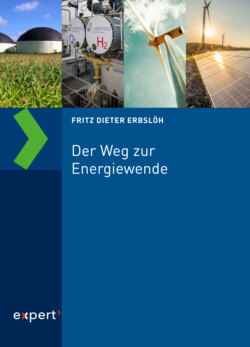Читать книгу Der Weg zur Energiewende - Fritz Dieter Erbslöh - Страница 13
6 Handlungsoptionen
ОглавлениеDie Aussagen des IPPC zur künftigen Klimaentwicklung werden von der überwältigenden Mehrheit der Klimawissenschaftler geteilt. Die seriöse Politik hat sich ihnen angeschlossen, zuletzt die deutsche Bundeskanzlerin A. MERKEL in ihrer Ansprache zum Neujahr 2021. Dass sich populistische Regierungen wie die von D. TRUMP in den USA oder J. BOLSONARO in Brasilien hierzu anders äußern, bis hin zur Leugnung der Fakten und zum Rückzug aus bereits geschlossenen Abkommen, mag ihnen innenpolitische Vorteile bringen, ändert jedoch nichts an der objektiven Lage.
Weniger eindeutig sind die sich bietenden Handlungsoptionen. Das hängt mit grundsätzlichen Einschätzungen zur Entwicklung der Welt und der Menschheit zusammen, die sich für Individuen wie Gesellschaften mit Abstufungen zwischen den Polen bewegt:
Status Quo erhalten
Welt dynamisch verstehen
Konkret kann man zunächst fragen, wie sich das Klima in den großen Zusammenhängen der Erdgeschichte darstellt. Naturgemäß gibt es hierzu quantitative Unsicherheiten, jedoch lässt sich in Abb. 6‑1 erkennen, dass Klimageschichte durch starke Veränderungen geprägt ist, mit vielen zwischenliegenden Warmzeiten. Unsere Gegenwart lässt sich hier am Ausgang der letzten Eiszeit einordnen.
Abb. 6‑1:
Erdklima in großem zeitlichem Zusammenhang; Quelle: Schönwiese, Christian-Dietrich: Klima im Wandel, Tatsachen, Irrtümer, Risiken; Deutsche-Verlags-Anstalt GmbH, 1992
Warmzeiten und Eiszeiten wechselten also ab, insbesondere auch in den letzten 1.000 Mio. Jahren. Einige Ereignisse ragen besonders heraus, so etwa die Katastrophe an der Perm-Trias-Grenze vor etwa 252 Millionen Jahren, die mit dem größten Massenaussterben der Erdgeschichte verbunden ist. Hauptverursacher war der sog. Sibirische Trapp, ein riesiger Vulkankomplex im heutigen Sibirien. Die Ausbrüche setzte nach Modellrechnungen mindestens 14,5 Billionen (?) Tonnen CO2 frei – fast das Dreifache der Menge, die durch das Verbrennen heutiger fossiler Brennstoffe auf der Erde entstehen würde. In den Jahrmillionen nach dem Vulkanereignis stiegen die Wasser- und Bodentemperaturen auf 35 bis 40 °C an, die Wassertemperatur am Äquator auf bis zu 40 °C. Die Modelle lassen auch erkennen, dass das Meer damals 76 % seines Sauerstoffs verlor.1
Die letzte Zwischeneiszeit, in der wir immer noch festhängen, begann vor etwa 10.000 Jahren mit deutlich erhöhten Temperaturen und ließ den Meeresspiegel um etwa 120m (!) steigen. Die von verschiedenen Autoren ermittelten Temperaturwerte deuten an, dass während des gesamten Holozäns erhebliche Temperaturschwankungen auftraten.2
Vor diesem Hintergrund sind Temperaturanstiege nichts grundsätzlich Neues, gegenwärtig allerdings mit einer Besonderheit: Der menschengemachte Temperaturanstieg hat sich in einem mit 100 Jahren erdgeschichtlich extrem kurzen Zeitraum vollzogen und ist damit ein neuartiges Phänomen ohne bekanntes Vorbild.3
Insgesamt folgt, dass der Zustand des Erdklimas nie der eines Status Quo war, sondern vielfachen Veränderungen unterlag und damit im Sinne der oben gemachten Unterscheidung dynamisch zu verstehen ist.
Ein Status Quo (im engen Sinn) ist erdgeschichtlich eine Hoffnung, die sich nicht erfüllen wird.
Und da der Mensch seit der Industrialisierung nicht nur kräftig in die natürliche Umwelt eingreift, sondern sich auch seine eigene Umwelt (Zivilisation) schafft und diese beständig verändert, gilt das auch für die wirtschaftsgeographische, technikhistorische und sozialgeschichtliche Perspektive.
Die massive Umgestaltung der Welt durch den Menschen hat schließlich P. CRUTZEN dazu gebracht, mit dem Anthropozän ein neues Zeitalter für unsere Gegenwart auszurufen, das seit der Mitte des 20. Jahrhunderts das Holozän abgelöst hat.4