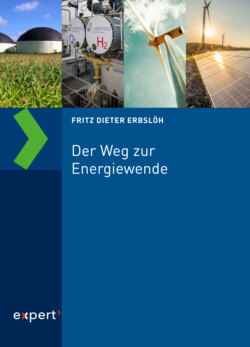Читать книгу Der Weg zur Energiewende - Fritz Dieter Erbslöh - Страница 9
4.2 Weltklimarat
ОглавлениеNeben WMO, Weltklimakonferenzen, Weltgipfeln, COP, CMP gibt es noch eine weitere internationale Einrichtung, die sich um das Weltklima und seine Stabilisierung kümmert: den IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) als Gremium der Experten.
Der IPCC wurde 1988 von der UN-Umweltorganisation (UNEP) und der WMO gegründet. Seine Aufgabe ist es, die Politik neutral über die wissenschaftlichen Erkenntnisse zur Klimaveränderung und zu möglichen Gegenmaßnahmen zu informieren. 195 Staaten sind Mitglieder des IPCC. Sie benennen jeweils Experten, meist Fachwissenschaftler, die ihre Berichte eigenständig erstellen und als (weitgehend) unabhängig gelten. Das Gremium hat seinen Sitz in Genf und betreibt keine eigene Forschung, sondern wertet eine große Zahl von anerkannten Studien aus und fasst die zentralen Erkenntnisse daraus zusammen. Den breiten wissenschaftlichen Konsens sichern mehrere tausend beim IPCC registrierte Gutachter, die die Berichte kommentieren und natürlich auch kritisieren können (und sollen).
Publizität gewinnt der IPCC regelmäßig durch seine großen Sachstandsberichte, von den bisher nach einem ersten im Jahr 1990 vier weitere im Abstand von 5‒6 Jahren erschienen sind. Der bislang letzte ist der Fünfte Sachstandsbericht (AR5) von 2013/14, der als Ergebnis eines fünfjährigen Arbeitsprozesses in drei Bänden vorgelegt wurde. Die Kernergebnisse des ersten, die naturwissenschaftlichen Grundlagen des Klimawandels und künftige Entwicklungen des Klimasystems behandelnden Bandes zeigt die nachstehende Auflistung:1
Die atmosphärische CO2-Konzentration liegt heute rund 40 % über vorindustriellem Niveau.
Die Durchschnittstemperatur an der Erdoberfläche stieg zwischen 1880 und 2012 um 0,85 °C.
Auch die Ozeane haben sich deutlich erwärmt.
Die drei Jahrzehnte seit 1980 waren jeweils wärmer als jedes andere Jahrzehnt seit 1850.
Eindeutig der Mensch ist verantwortlich für den größten Teil der Erwärmung zwischen 1951 und 2010.
Mit wenigen Ausnahmen schrumpfen weltweit die Gletscher, und das Tempo beschleunigt sich.
Die Ausdehnung des arktischen Meereises sinkt seit 1979 um durchschnittlich 3,8 % pro Jahrzehnt.
Etwa 30 % des durch menschliche Aktivität freigesetzten CO2 wurden von den Ozeanen aufgenommen, die deutlich versauern.
Die weltweiten Meeresspiegel werden bis ca. 2100 um etwa 2682cm steigen.
Steigt der Treibhausgas-Ausstoß weiter wie bisher, erwärmt sich die Erde bis ca. 2100 um 2,6 bis 4,8 °C.
Der sechste IPCC-Sachstandsbericht als Hauptprodukt des aktuellen Berichtszyklusses (2016‒2022) wird 2021/22 veröffentlicht. Daneben kennt der IPCC Sonderberichte, von denen sich der jüngste vom Oktober 2018 auf das Erreichen des 1,5-Grad-Ziels fokussierte.
Die Berichte sind in der Regel etwa 1.500 Seiten stark und durch eine Vielzahl von Mitwirkenden erstellt. Angesichts der Vielzahl zusammengetragener Informationen und der breiten Mitwirkung anerkannter Klimawissenschaftler gelten diese Berichte als der heilige Gral der Klimaforschung – sie geben letztlich den Mainstream vor.
Angesichts des Gewichtes, das dem IPPC und seinen Berichten international zugemessen wird, stellt sich naturgemäß die Frage nach seiner Unabhängigkeit und nach seiner Finanzierung ‒ auch Wissenschaftler geraten in ihrer Abhängigkeit von Fördergeldern gelegentlich in Interessenskonflikte. Abb. 4‑1 stellt zunächst die Grundstruktur der Organisation dar. Die leitenden Funktionen werden ehrenamtlich wahrgenommen; dies gilt auch für die Autoren der Berichte des IPCC. Die Autoren wie auch die Vorstände des IPCC werden in der Regel von ihren heimatlichen Instituten für die Mitarbeit bei IPCC freigestellt, ihnen werden jedoch Reisekosten erstattet. Die Geschäftsstellen der Arbeitsgruppen und das Datenzentrum werden von den Ländern finanziert, die sie beherbergen; hauptsächlich sind dies die Industrieländer.2
Abb. 4‑1:
Organisation des IPPC. Grau: Beteiligte Regierungen mit entsandten Fachleuten, grün: Wissenschaftler, blau: unterstützende Organisationen; Quelle: IPPC
Um auch die Reisen von Fachleuten aus Entwicklungsländern zu finanzieren, stehen Mittel aus einem jährlich etwa 7 Mio. € umfassenden Treuhandfonds zur Verfügung, der sich aus freiwilligen Beiträgen der Industrieländer speist und der auch die Veröffentlichung und Übersetzung von IPCC-Berichten finanziert. Bis zum Jahr 2017 beteiligten sich hier die USA mit fast 45 % des jährlichen Aufkommens; nach ihrem Austritt übernahm die EU diesen Anteil, um die Weiterarbeit des IPPC zu ermöglichen. Zur Wirklichkeit gehört allerdings auch, dass 80 % der Mitgliedstaaten keine Beiträge leisten.
Die Seriosität der Beiträge und Schlussfolgerungen wird durch ein mehrstufiges Peer-Review-Verfahren sichergestellt. Da die anthropogene Klimaänderung eine große Herausforderung ist, die alle Nationen der Erde dauerhaft dazu zwingt, weitreichende Entscheidungen über den Umgang mit diesem Problem zu treffen, blieb Kritik nicht aus. Massive Interventionen versuchten, die Klimawissenschaft und den IPCC in Misskredit zu bringen. Als Reaktion hierauf beauftragten die Vereinten Nationen und der IPCC das internationale Netzwerk von Wissenschaftsakademien (den Inter Academy Council IAC), eine Kommission zur Überprüfung der Prozesse und Verfahren des IPCC einzuberufen.
Insgesamt hat die Kommission den Assessment-Prozess des IPCC – die Aufarbeitung des wissenschaftlichen Sachstandes – als korrekt und erfolgreich bewertet.3 Die Hauptempfehlungen der Kommission betrafen Verbesserungen im Management, im Review-Prozess, in der Beschreibung von Unsicherheiten4 sowie die Kommunikation und die Transparenz im Assessment-Prozess – Details also, die nicht die Kernbefunde in Zweifel zogen.