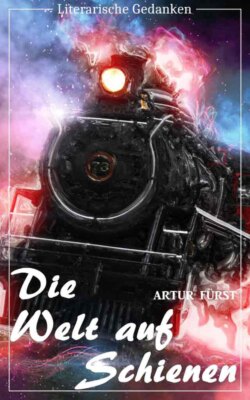Читать книгу Die Welt auf Schienen (Artur Fürst) - mit den originalen Illustrationen - (Literarische Gedanken Edition) - Fürst Artur - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
5. Geschichte des Gleises
ОглавлениеErst die Vereinigung von Lokomotive und eisernem Gleis ergibt die Eisenbahn. Keines der beiden vermag ohne das andere allzuviel Nutzen zu bringen. Das bloße Gleis ist nicht mehr als eine Vorrichtung zur Erleichterung des Fahrens ohne die Befähigung, Schnelligkeit zu verleihen. Die Lokomotive auf der Landstraße gleicht einem Schwimmvogel, der, auf das Land gesetzt, unbeholfene Bewegungen vollführt. Beide Bestandteile zusammengebracht aber verwandeln sich zu einem völlig neuen Ganzen mit großartigen Eigenschaften. Dies ist ein Vorgang, der jenem in der Chemie gleicht, wenn das giftige Chlor und das bei Berührung mit Feuchtigkeit brennende Natrium zum Kochsalz sich vereinigen, das für den Menschen unentbehrlich ist.
Gerade wie der Jüngling und das Mädchen, die später ein Paar werden sollen, heranwachsen, ohne einander zu kennen, so haben sich auch das Schienengleis und die Lokomotive getrennt voneinander entwickelt, sie, die doch schließlich, nach Stephensons bereits erwähntem Ausspruch „Mann und Weib“ geworden sind. Liebevoll wurden sie an verschiedenen Orten gehegt und gefördert, und erst als man glaubte, daß jedes von ihnen eine genügende Reife erlangt hätte, tat man sie zusammen. Aber auch hier gab es, wie das ja bei den Menschen gleichfalls manchmal vorkommen soll, einige Zeit nach der Hochzeit mancherlei Verdrießlichkeiten, was uns aus der Schilderung von Trevithicks Wirken bereits bekannt ist. Erst nach längerer Zeit, als beide gesetzter geworden waren, gewöhnten sich die Gatten aneinander; und als sie um die letzte Jahrhundertwende die eiserne Hochzeit begehen konnten, da vermochten sie auf ein gemeinschaftliches Lebenswerk von unerhörter Großartigkeit zurückzublicken.
Nachdem wir in den vorhergehenden Abschnitten die Entwicklung der Lokomotive bis zum Sieg der „Rakete“ beim Wettkampf zu Rainhill verfolgt haben, liegt es nun ob, den Werdegang des Gleises zu betrachten. Hierbei werden wir ein Stück weiter in das neunzehnte Jahrhundert vordringen müssen, da das Gleis um ein beträchtliches später seiner heutigen Form sich näherte als die Lokomotive.
Häufig wird angenommen, daß bereits die Griechen zur klassischen Zeit Geleise gekannt haben. Es ist aber unsicher, ob die Rillen, die sich tatsächlich auf den steinernen Wegen für die Opferfahrzeuge befunden haben, nicht unbeabsichtigt durch die schleifende Wirkung der Räder entstanden sind. Bestenfalls könnte es sich hier immer nur um eine vertiefte Spur handeln, die mit dem heutigen Gleis wohl den Grundgedanken, nicht aber die Ausführungsform gemeinsam hat. Wir legen ja überall, wo nicht ein querender Verkehr es anders verlangt, die Schienen nicht in Wege, sondern auf diese.
Mit Sicherheit ist das Vorhandensein von Geleisen für das zweite Drittel des sechzehnten Jahrhunderts festgestellt. Danach ist der Ursprung der Spurbahn in Deutschland zu suchen.
Zu jener Zeit stand der deutsche Bergbau, gefördert durch eine wissenschaftlich gut begründete Hüttenkunde, in voller Blüte. Die im Jahre 1544 erschienene „Cosmographia“ des Sebastian Münster schildert eine Vorrichtung, welche die deutschen Bergleute erfunden hatten, um die kleinen, mit Erzen beladenen Wagen leichter vorwärtsbringen zu können. Eine ähnliche Beschreibung findet sich in dem „Bergwerckbuch, durch den hochgelehrten und weitberühmten Herrn Georgium Agricolam, der Artznei Doktorn / vnd Bürgermeister der Churfürstlichen Statt Kemnitz / erstlich mit großem Fleiß / Mühe und Arbeit in Latein beschrieben“. Dieses wurde im Jahre 1557 durch den „hochgelehrten Philippus Beccius / der löblichen Universität zu Basel Professor“ neu herausgegeben und erlangte als brauchbares Lehrbuch eine weite Verbreitung. Danach benutzten die deutschen Bergleute damals zum Befördern der Lasten einen kleinen, vierrädrigen Wagen, den sie „Hund“ nannten, weil er „so man ihn bewegt / ein thon gibet daß etliche dunkt er habe ein thon / dem bellen der Hunden nicht vngleich“.
Das älteste Schienengleis
(Aus einem deutschen Bergwerkbuch um 1550)
Weiter heißt es bei Agricola: „Aber der Hund ist wol halber weiter dann der Laufkarren / aber vier Werckschuh lang / dritthalben Werckschuh breit vnd hoch / dieveil er aber gevierdt ist / so wird er auch mit dreyen gevierdten Blächen vmbgeschlagen / vnd gebunden vnnd vber das auch mit eysenen Stabeysen befestiget / zu seinem boden seind zwey eysene Felchin angeschlagen / vmb welcher Köpf zubeyden seiten höltzene scheiben vmbgehen / welche damit sie nicht aus den Felchin / die vest seind herab fallen / so verwahrt man das mit kleinen eysenen Neglen / daß diese so der große Nagel der auch an boden ist geschlagen / kumpff ist vorden / nicht von dem gebahnten weg / das ist / aus der höle / oder auß der gleiß der Trömen so gelegt seind abweiche.“
Das älteste Schienenfahrzeug: Förderhund mit Spurnagel
(Aus dem „Bergwerckbuch“ des Agricola 1557)
Diese Beschreibung ist so zu verstehen, daß die vier Räder des „Hunds“ auf mehr oder weniger bearbeiteten Baumstämmen rollten, die so dicht aneinander lagen, daß nur eine schmale Rinne zwischen ihnen blieb. In diese Rinne tauchte der Spurnagel und verhinderte ein Abgleiten des „Hunds“ vom Gleis. So also sah die erste Zwangsspur aus.
In dem „Bergbuch“ von Ettenhardi wird dann von sogenannten Reibeisen berichtet, die in der Länge von je einem Klafter, das ist etwa 1,8 Meter, auf die hölzerne Bahn genagelt wurden, um diese zu schonen. Hierin hat man häufig bereits den Anfang des eisernen Gleises gesehen. Es scheint jedoch, daß diese Reibeisen nicht auf die Langhölzer, sondern seitlich an deren Innenflächen genagelt wurden, um sie vor der Abnutzung durch den Spurnagel zu schützen.
In der zweiten Hälfte des sechzehnten Jahrhunderts wurden die deutschen Bergleute, nachdem die Bestimmung aufgehoben worden war, daß Ausländer in den königlichen Werken nicht beschäftigt werden durften, nach England berufen, um dessen stark zurückgebliebenem Bergbau aufzuhelfen. Sie brachten den Gedanken der Lastenförderung auf Spurbahnen mit und schufen so die ersten Geleise in dem Land, das die Wiege der Eisenbahn werden sollte. Aus der schon von Agricola erwähnten Benennung „gleiß der Trömen“ soll sich das ja heute noch lebendige englische Wort „tram“ entwickelt haben.
Es scheint jedoch, als wenn der Beginn der Entwicklung, die zum heutigen Eisenbahngleis führte, nicht unmittelbar auf die Hundsläufe in den Bergwerken zurückzuführen ist. Es wird vielmehr behauptet, daß der Gedanke, eine längere vom Bergwerk zur Verschiffungsstelle führende Straße mit einer hölzernen Bahn zu belegen, ganz selbständig in der Gegend von Newcastle am Tyne entstanden sei, das später die erste Lokomotivfabrik auf der Erde sah.
Altes englisches Holzgleis
(in einem Bergwerk bei Newcastle)
In der Gegend von Newcastle brachte man die Kohle zu Anfang auf dem Rücken von Pferden zum Fluß. Als dann die Förderung in Karren aufkam, waren die schlechten Wege bald so zerfahren, daß sie nicht mehr benutzt werden konnten. Man belegte sie daher mit zwei Bohlenstreifen, die den gleichen Abstand voneinander hatten wie die Karrenräder. Das dürfte um 1620 der Fall gewesen sein.
Holzgleis mit Spurrändern
(die das Hinunterrollen der Wagen von den Schienen verhindern sollten)
Die Last der schweren Karren verdrückte jedoch die Bohlen in dem weichen Boden so stark, daß sie die Spur nicht mehr einhielten. Da kam im Jahre 1630 ein Kohlengrubenbesitzer in Northumberland, namens Beaumont, auf den Gedanken, die gleichlaufenden Bohlenbahnen durch Querhölzer zu verbinden, auf denen sie mit Nägeln befestigt wurden. Die so angelegte Spurbahn sieht schon wie ein richtiges Gleis aus. Sie soll die Möglichkeit geschaffen haben, durch ein Pferd eine viermal größere Last zu befördern, als es bis dahin angängig war. Die einzelnen Langhölzer, die Beaumont benutzte, waren 11⁄2 Meter lang, 11 Zentimeter breit und 31⁄2 Zentimeter hoch. Als die Holzbohlen sich allzu rasch abnutzten, ging man daran, sie mit eisernen Bändern zu beschlagen.
Es blieb die unangenehme Erscheinung, daß die Karren sehr leicht seitlich von der Spurbahn hinunterrollten. Um dies zu verhindern, setzte man an den Außenkanten erhöhte Spurränder an, so daß eine zwangläufige Führung der Fahrzeuge entstand. Doch auch mit diesem schon ziemlich weit fortgeschrittenen Zustand war noch nichts endgültig Brauchbares erreicht. Der dünne Eisenbeschlag wurde von den schweren Karren verbogen, die Nägel hinausgedrückt, so daß ein glattes Fahren bald unmöglich wurde. Auch eine Verstärkung der Eisenbänder nutzte nicht viel.
Da brachte ein Zufall die Entwicklung um ein bedeutendes Stück vorwärts.
Im Jahre 1767 litten die englischen Eisenwerke stark unter einem Rückgang des Geschäfts. Das aus den Hochöfen kommende Eisen konnte nicht sogleich verkauft werden. Der Mitbesitzer der Eisenwerke zu Coalebrookdale, Reynolds, beschloß daher, aus dem Eisen dicke Barren zu gießen und einen Versuch zu machen, ob ein solcher sehr kräftiger Belag der hölzernen Schienen die Karrenförderung nicht günstig beeinflussen würde. Er wollte zunächst das Eisen nur vorübergehend für diesen Zweck zur Verfügung stellen, es nachher, sobald die Geschäfte wieder besser gingen, wieder umgießen lassen und verkaufen.
Die ersten Barren wurden in Coalebrookdale am 13. November 1767 gegossen. Kaum waren sie ausgelegt, da zeigten sich die Vorteile dieses kräftigen Belags der hölzernen Balken so deutlich, daß an ein Wiederaufnehmen des Eisens niemals mehr gedacht worden ist. Der Grubenbesitzer ließ vielmehr seine sämtlichen Geleise in solcher Weise ausstatten, und sein Vorgehen fand alsbald Nachahmung. Auf der nun zum erstenmal erzeugten wirklich glatten Bahn rollten die Karren sehr viel leichter, und die unaufhörlichen Ausbesserungsarbeiten hörten infolge der Widerstandsfähigkeit der Anlage auf. Das ist der Ursprung des heutigen eisernen Gleises.
Die Entwicklung geht nun rasch weiter.
Reynolds Eisenbarren waren, um die Fahrzeuge in der Spur zu halten, mit einer schwachen Vertiefung versehen. Da hierdurch Entgleisungen nicht mit Sicherheit verhindert wurden, schuf Benjamin John Curr in dem Bergwerk des Herzogs von Norfolk bei Sheffield im Jahre 1776 eine neue gußeiserne Schienenform, die im Querschnitt einen Winkel darstellte. Der eine Schenkel dieses Winkels lag auf dem Langholz, der andere ragte senkrecht etwa fünf Zentimeter empor. Durch diesen hohen Rand war ein Abweichen von der Spur ausgeschlossen.
Als einige der unter den Winkelschienen liegenden Langhölzer verfaulten, und man an solchen Stellen neue Auflageflächen mittels Querhölzern herstellte, die unter dem Gleis hindurchgesteckt wurden, zeigte es sich, daß die eisernen Schienen fest genug waren, um auch ohne fortlaufende Unterstützung die Last der Wagen zu tragen. So wurde, wiederum durch Zufall, das freitragende, nur in gewissen Abständen aufgelagerte eiserne Querschwellengleis erfunden. Als im Jahre 1800 die Plymouthwerke zu Merthyr-Tydvil ihre Bahn nach Aberdare-Junction eröffneten, da ruhten die verstärkten Winkelschienen nur noch auf einzelnen untergesetzten Steinwürfeln.
Bis jetzt waren die Schienen so gestaltet, daß jeder gewöhnliche Straßenwagen darauf fahren konnte, sobald nur sein Radabstand zur Spurweite paßte. Die fahrenden Räder übten jedoch ziemlich rasch einen zerstörenden Einfluß auf die Currschiene aus. Sie fraßen tiefe Rinnen in das Gleis, so daß immer noch zu häufige Auswechselungen notwendig wurden. Da erkannte Jessop, daß die Dauerhaftigkeit und zugleich die Tragfähigkeit der gußeisernen Schiene sehr verbessert würde, wenn man ihr eine im Querschnitt pilzförmige Gestalt gäbe. Seine Schiene hatte einen schmalen, senkrechten Steg und darauf einen stark verbreiterten Kopf. Bei dieser Form konnte die gleiche Tragfähigkeit mit weniger Eisen erreicht werden. Ein Einschleifen der Räder war hier nicht mehr möglich.
Um jedoch ein Entgleisen der Wagen auf solchen Schienen zu verhindern, mußten die Räder der Fahrzeuge mit vorstehenden Rändern versehen werden. Es entstand damals der Spurkranz, der bis heute jedem Eisenbahnfahrzeug eigentümlich ist. Von nun an ist die Ausgestaltung der für Schienenwege bestimmten Wagen von denen getrennt, die gebaut werden, um auf der Landstraße zu fahren. Dies ist für die Entwicklung der Eisenbahn-Fahrzeuge, die notwendig einen eigenen Verlauf nehmen mußte, sehr nützlich gewesen.
Die Beanspruchung einer solchen Pilzschiene, die freitragend zwischen je zwei festen Auflagern ruht, ist nach den Gesetzen der Festigkeitslehre am stärksten, wenn sich eine Wagenachse gerade in der Mitte der freitragenden Schiene befindet. Es war darum bei Verwendung des gegen Durchbiegung wenig widerstandsfähigen Gußeisens wünschenswert, den Schienen eine Form zu geben, welche die Tragfähigkeit in der Mitte verstärkte. Dies war am bequemsten dadurch zu erreichen, daß man die Höhe jeder Schiene von den Enden her nach der Mitte zu wachsen ließ. Auf diese Weise entstand die Fischbauchform der gußeisernen Schiene, die lange Zeit sehr weit verbreitet gewesen ist. Die ersten Lokomotiven sind auf solchen Fischbauchschienen gefahren.
So groß nun schon die Verbesserung des Gleises gegenüber der ursprünglichen Gestalt war, so wissen wir doch aus den Lebensgeschichten von Trevithick und Stephenson, mit welchen Schwierigkeiten sie ständig infolge der schlechten Beschaffenheit der Geleise zu kämpfen hatten. Die Schienen waren sorglos verlegt, so daß die Lokomotiven auf den Geleisen hüpften wie trabende Pferde, was denn auch den ersten Maschinen Stephensons in Killingworth den Beinamen „iron horses“ verschaffte. Das Scheitern von Trevithicks Versuchen ist unmittelbar auf die geringe Widerstandsfähigkeit des Gußeisens gegen Biegung und Stöße zurückzuführen. Wir wissen, wie er seine Londoner Versuche aufgab, als die Lokomotive „Catch me who can“ wieder einmal durch Schienenbruch entgleist war. Diese Zerbrechlichkeit der gußeisernen Schienen schuf überall Unannehmlichkeiten und Unsicherheit, so daß der Wunsch nach einem besseren Baustoff mit größerer Widerstandsfähigkeit sich regte. Die Verwendung des Schmiedeisens sollte den gewünschten Erfolg in vollkommenster Weise bringen.
Das erste Schmiedeisengleis wurde von dem Ingenieur Nixon auf der Wallbottle-Kohlengrube bei Newcastle ausgelegt. Es bestand aus einfachen quadratischen Stäben von 38 Millimetern Höhe. In Frankreich benutzte man längere Zeit eine noch schmalere, aber sehr hohe rechteckige Schiene aus Schmiedeisen.
Wie fast stets bei der ersten Einführung von technischen Neuerungen, die später große Bedeutung gewinnen, blieben auch hier zunächst Rückschläge nicht aus. Viele Bahnen wandten sich wieder von den schmiedeisernen Schienen ab, weil deren scharfe Kanten in die weichen Kränze der gußeisernen Räder einschnitten und diese rasch zerstörten. Das Gußeisen behauptete noch längere Zeit weiter das Feld. Dies wurde erst anders, als durch eine tief eingreifende Verbesserung des Herstellungsverfahrens die richtige Form für die Schmiedeisenschiene gefunden wurde.
Obgleich das Walzen des Eisens schon recht lange erfunden war, vermochte man doch bis zum zweiten Jahrzehnt des neunzehnten Jahrhunderts nicht über die Herstellung von glatten Stäben durch dieses Verfahren hinauszukommen. Der Leiter der Bedlington-Eisenwerke in Durham, Berkinshaw, jedoch wollte die bei gußeisernen Schienen bereits erwiesenen Vorteile der Pilzform auch bei der schmiedeisernen Schiene verwenden. Nach lang andauernden und äußerst mühseligen Versuchen gelang es ihm endlich, Walzschienen in Pilzform herzustellen.
Die Entwicklung der eisernen Schiene
(a) Die erste Eisenschiene, gegossen von Reynolds in Coalebrookdale am 13. November 1767. — b) Currs Winkelschiene, auf der gewöhnliche Wagen ohne Spurkranzräder sicher fahren konnten. — c) Jessops Pilzschiene. Diese Schienenform machte zum erstenmal die Anwendung von Spurkranzrädern notwendig. — d) Fischbauchschiene, eine lange Zeit beliebte Form der gußeisernen Schiene. — e) Berkinshaws Walzschiene. Lange, schmiedeiserne Schiene mit Fischbauchform. Alle folgenden gleichfalls aus Schmiedeisen. — f) Schiene der Eisenbahnlinie Leipzig-Dresden. Flache Form auf hölzernen Langschwellen. — g) Doppelkopfschiene, die noch heute in England hauptsächlich verwendet wird. — h) Stevens’ Breitfußschiene. Grundform für die heute am weitesten verbreitete Schienenart. — i) Neuzeitliche preußische Staatsbahn-Schiene. — Sonderarten: k) Brück-Schiene. — l) Schwellen-Schiene in Sattelform, die das Unterlegen besonderer Schwellen in der Bettung unnötig macht. — m) Schwellen-Schiene in Trägerform)
Mit der hierdurch erzielten günstigen Verteilung des Eisens auf den Querschnitt war zugleich die Möglichkeit verbunden, das einzelne Schienenstück länger zu machen. Während man bei der gußeisernen Schiene über Längen von 1 bis höchstens 11⁄2 Meter nicht hinausgekommen war, hatten Berkinshaws Walzschienen Längen von 41⁄2 Meter. Hierdurch verringerte sich die Zahl der Schienenstöße außerordentlich, was insbesondere damals bei den recht schlechten Befestigungsarten sehr vorteilhaft war.
Georg Stephensons Scharfblick ließ ihn die Vorzüge der langen Walzschiene sofort erkennen, und er trat lebhaft dafür ein, die Bahnstrecke von Stockton nach Darlington, die er zu jener Zeit gerade baute, mit einem solchen Gleis zu versehen. Aber die Liebe zum Althergebrachten machte es auch damals unmöglich, die Leiter der Bahngesellschaft von der Nützlichkeit der neuen Bauform durchgreifend zu überzeugen. Die Linie Stockton-Darlington ist deshalb nur zur Hälfte mit schmiedeisernen Schienen ausgerüstet worden, die andere Hälfte erhielt ein gußeisernes Fischbauchgleis.
Diese Sucht der Menschen, beim sogenannten Bewährten zu beharren, der wir nun schon recht häufig in der Geschichte der Eisenbahn begegnet sind, behinderte auch in einer anderen recht merkwürdigen Weise das rasche Durchdringen der so sehr viel besseren Walzschiene. Obgleich Schmiedeisen gegen Durchbiegung sehr viel widerstandsfähiger ist als Gußeisen, so daß die Berkinshaw-Schiene ohne weiteres imstande gewesen wäre, die damals noch üblichen, verhältnismäßig geringen Raddrücke zu tragen, meinte man doch, auch ihr die Fischbauchform geben zu müssen, die für einen ganz anderen Baustoff erdacht war. Mit großer Mühe ward die glatt aus den Walzen kommende Schiene ausgebaucht. Diese schwere und teure Arbeit, die ganz überflüssig war, verhinderte das Eindringen der schmiedeisernen Schiene in den Eisenbahnbetrieb lange Zeit.
Rechteckige Schiene aus Schmiedeisen
(mit scharfen Kanten)
Als man das Schmiedeisen allgemeiner zu verwenden begann, wurde auch der Versuch gemacht, Flachschienen auf hölzerne Langschwellen zu verlegen, was eigentlich ein Rückgreifen auf bereits veraltete Formen bedeutete. Die erste größere Eisenbahnstrecke in Deutschland, die Linie von Leipzig nach Dresden, wurde mit solchen Flachschienen ausgerüstet, die jedoch nicht lange hielten und bald ersetzt werden mußten.
1835 erfand nach den einen Robert Stephenson, nach den andern Georg Stephensons Schüler John Locke die doppelköpfige Schiene. Es war dies nichts anderes als eine doppelte Pilzschiene mit gleichgeformten Verdickungen am Kopf wie am Fuß. Man versprach sich hiervon den Vorteil, jede Schiene zweimal benutzen zu können, indem man sie nach Verschleiß des einen Kopfs einfach umdrehte. Bald jedoch zeigte es sich, daß der untere Teil der Schiene an den Auflagestellen rasch so stark verdrückt wurde, daß beim Wenden eine glatte Fahrbahn nicht mehr erzielt werden konnte. Auf das Umkehren der Schiene mußte daher von Beginn an verzichtet werden. Dennoch ist die Doppelkopfschiene in England bis zum heutigen Tag die am meisten verwendete Schienenform geblieben. Sie hat nur eine Änderung durch Umgestaltung zur sogenannten Bullenkopfschiene erfahren, indem man den Fahrkopf jetzt sehr viel stärker macht als die Verdickung am Fuß.
Die Befestigung der bis dahin gebräuchlichen Schienenformen an den Auflagestellen machte, wie noch näher darzulegen sein wird, große Schwierigkeiten, da stets besondere Einrichtungen zum Festhalten notwendig waren. Diese Not brachte den Amerikaner Robert Stevens auf den Gedanken, eine Schienenform zu schaffen, die eine Befestigung ohne zwischengeschaltete Hilfsmittel ermöglichen sollte. Er erfand die Breitfußschiene, die, wenn auch in etwas abgeänderter Form, in Deutschland und den meisten anderen Ländern der Erde noch heute in allgemeinster Anwendung ist. Zum erstenmal wurde sie bei der Camden-Amboybahn in Amerika verlegt. Stevens verbreiterte den Fuß besonders stark an den Auflagestellen, während bei der heutigen Breitfußschiene ein gleichmäßiger Querschnitt üblich ist.
Der verstärkte Fuß zusammen mit dem pilzförmig verdickten Kopf hat zugleich der Schiene die beste Tragform gegeben. Stellt sie doch im Querschnitt nichts anderes dar als einen Doppel-T-Träger, wie man ihn zur Aufnahme schwerer Lasten überall verwendet. Wird ein solcher Träger, der an seinen Endpunkten unterstützt ist, in der Mitte belastet, so tritt eine Beanspruchung auf Durchbiegung ein. Denkt man sich nun, daß der Träger dieser Beanspruchung nachgibt, so werden die Fasern an seinem Kopf etwas zusammengedrückt, während die Fasern am Fuß gereckt werden. Zwischen der Stauchung und der Streckung muß notwendig ein Abschnitt liegen, in dem die Fasern weder gestreckt noch gestaucht werden, also unbeteiligt bleiben. Diese Erkenntnis hat dazu geführt, das Eisen am Kopf und Fuß der Träger in breiten Flanschen anzuhäufen und für die Mitte nur einen dünnen Steg auszubilden. Die Schiene wird, wenn man sich ein Rad in der Mitte eines auf zwei Schwellen aufruhenden Schienenstücks denkt, in gleicher Weise beansprucht, und darum ist auch für sie die Trägerform am zweckmäßigsten. Das Walzen dieser Breitfußschiene machte erst außerordentliche Mühe, gelang aber alsbald zur Zufriedenheit.
Im Jahre 1836 führte Vignoles die Breitfußschiene, freilich mit sehr niedrigem Steg, in England ein. In Deutschland ist sie bei dem späteren Ausbau der Strecke Leipzig-Dresden zum erstenmal verlegt worden, und seit der Technikerversammlung des Vereins Deutscher Eisenbahnverwaltungen im Jahre 1850 ist sie bei uns die allgemein gebräuchliche Schienenform.
Eine andere eigenartige Schienenart wurde, gleichfalls in Amerika, von Strickland erfunden. Es war die hohle, sogenannte Brückschiene, die in den verschiedensten Querschnittformen gleichfalls weite Verbreitung gefunden hat. Auch in Deutschland ist sie häufig angewendet worden und wohl auch heute noch hier und da zu finden.
Barlow entwickelte später aus der Brückschiene die Sattelschiene, welche die Ausgangsform für die Schwellenschienen wurde. Es ist dies eine Schienengattung, die ohne Schwellen in die Bettung verlegt werden kann, weil ihre Form ihr gestattet, die Aufgabe der Schwellen, nämlich die Übertragung der auftretenden Kräfte auf die Bettung, selbst zu übernehmen. Eine andere Form der Schwellenschiene ist die 1854 von Adams erdachte Trägerschiene.
In den sechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts war schließlich die Anzahl der üblichen Schienenformen verwirrend groß geworden. Jeder wählte nach Gutdünken die Gattung aus, welche ihm paßte, ohne sich recht darüber klar zu werden, welche Vorteile er dadurch erringen konnte. Schließlich aber setzten sich die Doppelkopf- und die Breitfußschiene so weit durch, daß sie heute auf der ganzen Erde fast alleinherrschend sind.
Kohlenwagen zu Newcastle auf Langschwellen-Gleis 1765
Nicht weniger wichtig als die Schiene ist für die Standfestigkeit und Dauerhaftigkeit eines Gleises die Form und Art der Unterlage, auf der die Schienen ruhen. Die Schwellen, wie die Einzelteile dieser Unterlage genannt werden, haben gleichfalls recht verschiedenartige Entwicklungsabschnitte durchgemacht.
Gleis der Bahn Manchester-Liverpool
(Verlegung auf Steinwürfeln. Die Bettung ist der
besseren Übersicht wegen fortgelassen)
Die Schwelle war, wenn man es recht betrachtet, früher vorhanden als das Gleis, denn bei den ersten Spurbahnen fuhren die Wagenräder, wie wir gesehen haben, auf Langschwellen. Daraus folgte, daß auch die ersten richtigen Schienen, die nur zur Erhöhung der Dauerhaftigkeit über die Holzspur gelegt wurden, auf Langschwellen ruhten. Die Schienen hatten so eine fortlaufende, ununterbrochene Unterlage, wie sie an nicht allzu wenigen Stellen noch heute üblich ist.
Rammpfähle als Schwellen
(auf der Bahn Camden-Amboy in Amerika)
Den schärfsten Gegensatz zu den Langschwellen bilden die Einzelunterlagen aus Stein oder aus Holz. Auf Steinwürfeln ruhten die Schienen der Bahn Manchester-Liverpool und ebenso der Eisenpfad der ersten deutschen Eisenbahn von Nürnberg nach Fürth. Auch Holz ist einst in Form von eingerammten Pfählen als Einzelunterlage verwendet worden, so z. B. bei der Bahn von Camden nach Amboy in Amerika.
Doch beide Arten der Unterlage für die Schienen zeigten große Mängel. Die einzelnen Steinwürfel oder Holzpfähle veränderten allzu leicht ihre Lage gegeneinander, so daß die Spur nicht genau innegehalten wurde. Bei den Langschwellen zeigten sich bald große Schwierigkeiten bei der Entwässerung des Bettungsstücks, das zwischen den Schwellen lag. Notwendigerweise muß ja die Bahnbettung möglichst trocken gehalten werden, weshalb sie, wie wir später bei der Darstellung des neuzeitlichen Oberbaus hören werden, aus besonderen Stoffen hergestellt wird. Da die zusammenhängenden Langschwellen das auf die Bettung fallende Oberflächenwasser am seitlichen Fortfließen behindern, so bleibt der Boden zwischen ihnen sehr lange feucht, und rasches Verfaulen des Holzes ist die Folge. Wir haben ja schon gehört, daß man wegen dieses Anfaulens der Langschwellen durch Zufall auf den Querschwellenbau gekommen ist, der heute am weitesten verbreitet ist. Seit dem Jahre 1876 ist diese Bauform für die deutschen Bahnen als die beste erkannt und festgesetzt.
Die Holzquerschwellen hatten früher wechselnde Querschnittformen. So waren die halbrunde, die dreieckige und die trapezförmige Schwelle im Gebrauch. Heute wird ziemlich überall die rechteckige Form bevorzugt.
Ältere Formen hölzerner Querschwellen
Als die Bahnen sich immer weiter ausbreiteten, kam der Augenblick, in dem man mit Schrecken überdachte, ob nicht der außerordentlich starke Verbrauch von Holz, den die immer weitergehende Vermehrung der Schwellen erforderte, allmählich alle Wälder auf der Erde aufzehren würde. Nach Haarmann heißt es in einer Besprechung dieser volkswirtschaftlichen Frage vom Jahre 1876:
„Den wundesten Punkt bildet der immer riesiger werdende Bedarf an Eisenbahnschwellen. Hier kann man mit Recht fragen: ‚Wo will das hinaus?‘ Auf der ganzen Erde wächst nur ein Bruchteil von dem Eichenholz hinzu, das alljährlich unter unsere Schienen gebettet wird, um dort trotz aller Präparierung in wenigen Jahrzehnten zu verfaulen. Es ist nur zu gewiß, daß die zweite, höchstens die dritte Generation, von uns an gerechnet, vor der Unmöglichkeit stehen wird, Bahnen mit Eichenschwellen zu bauen, und wenn man sie mit Gold aufwiegen wollte! Auch die Schwellen aus anderen Holzarten werden bei ihrer viel kürzeren Dauer immer teurer und seltener werden und zuletzt nicht mehr zu beschaffen sein.“
Diese schwarzseherische Voraussage ist nicht in Erfüllung gegangen, da der in der Tat sehr starke Holzbedarf der Eisenbahnen ziemlich in allen Ländern durch sorgsame Forstwirtschaft wieder ausgeglichen wird. Dennoch blieb der Wunsch rege, Schwellen aus einem anderen Stoff benutzen zu können, und auch hierzu bot sich als selbstverständlich das Eisen an. Die Befürchtung, die man im Anfang hegte, daß man auf Geleisen mit Eisenschwellen härter fahren würde als auf solchen mit hölzernen Querschwellen und daß der Rost die eisernen Unterlagen zu schnell zerstören würde, haben sich als grundlos erwiesen.
Gußeiserne Schwellen freilich bewährten sich wegen ihrer leichten Zerbrechlichkeit ebensowenig wie das gußeiserne Gleis, und auch mit den ersten Formen der aus Schmiedeisen gewalzten Schwellen erhielt man nicht sogleich gute Ergebnisse. Man dachte zuerst, daß es genüge, den Schwellen die Form der (Doppel-T-)Träger zu geben. Das war jedoch verfehlt, da die Hauptaufgabe der Schwelle nicht ist, die Schienen zu tragen, sondern vor allem, die Beanspruchung der Fahrbahn durch die Fahrzeuge möglichst vollständig auf die Bettung zu übertragen und sie dort zu verteilen. Diese Aufgabe erfüllte schon bis zu einem gewissen Grade die schmiedeiserne Schwelle von Le Crenier aus dem Jahre 1858, aber ihre Wandstärke war noch zu gering. Die beabsichtigte Wirkung trat erst vollständig ein, als man kräftige Schwellen walzte und sie mit Endverschlüssen versah, so daß ein bedeutender Teil der Bettung vollkommen von der trogförmigen Schwelle umschlossen wurde. Heute besteht die Eisenschwelle vollberechtigt neben der Holzschwelle; beide haben Vorteile und Nachteile, aber keine der beiden Schwellenarten vermag die andere ganz zu verdrängen.
Die Befestigung der Schienen auf den Schwellen fand zu Beginn nur an den Enden der kurzen Schienenstücke statt. Erst als die schmiedeisernen Schienen die Herstellung größerer Längen gestatteten, wurden auch dazwischenliegende Verbindungen mit den Schwellen hergestellt.
Zur Festhaltung der englischen Doppelkopfschiene war und ist noch heute das Aufschrauben eines besonderen Schienenstuhls notwendig, in dem die Schiene durch sehr kräftiges Eintreiben eines hölzernen Keils gehalten wird. Die Breitfußschiene wurde zunächst durch einfaches Eintreiben von Hakennägeln in die Schwelle festgehalten. Da jedoch die Nägel sich leicht lockerten, so gab man ihnen einen widerhakenähnlichen Ansatz, der beim Eintreiben des Nagels sich einen besonderen Weg in die Schwelle bahnte und so das Lockerwerden und Herausfallen des Nagels hinderte. Eine weit innigere Verbindung stellte dann die heute noch in gleicher Weise gebräuchliche Schienenschraube mit großem Kopf her.
Erste Schwelle aus Schmiedeisen
(hergestellt von Le Crenier 1858)
Beim Befahren durch die Lokomotiven und Wagen werden die Schienen, besonders in den Krümmungen, auch durch seitliche Kräfte beansprucht, die sie nach außen umzukanten versuchen. Man ist dem schon frühzeitig dadurch entgegengetreten, daß man die Schienen über jeder Schwelle mittels eiserner Stangen verband, die durch Löcher in den Stegen gingen und dort verschraubt waren. Auch besondere Haltenasen, die von außen den Schienenkopf festhielten, wurden angewendet. Es stellte sich jedoch schließlich heraus, daß das beste Mittel zur Abwendung des Umkantens die Einschaltung von Unterlagsscheiben zwischen Schienenfuß und Schwelle sei.
Durch das ständige senkrechte Hin- und Herschwingen der Schienen unter dem rasch auftretenden und wieder verschwindenden Druck der Räder fraßen sich die Schienenfüße bald in die weichen Schwellen ein. Die Unterlagsplatte vergrößert nun die Auflagefläche zwischen Schiene und Schwelle sehr bedeutend, so daß das Einfressen geringer wird. Zugleich gestattet die Unterlagsplatte die Anbringung einer größeren Anzahl von Schrauben und Nägeln. Dadurch, daß man die Auflagefläche der Unterlagsplatte auf der Schienenseite nicht wagerecht macht, sondern sie nach außen hin schräg ansteigen läßt, bewirkt man zugleich eine nach innen geneigte Schräglage der Schienen. Diese ist vorteilhaft, weil hierdurch die stets etwas kegelförmig abgedrehten Radkränze, wenn sie seitlich auflaufen, immer wieder in die günstige Mittellage zurückgedrängt werden. Da der Schienenkopf in dieser Stellung nach außen zu immer etwas höher liegt als innen, so muß jedes Rad bei dem Versuch des seitlichen Auflaufens nach oben klettern, und die Schwerkraft zieht es dann sofort wieder zurück. Auch diese Schräglegung der Schienen ist heute wohl auf der ganzen Erde üblich. Näheres über die Unterlagsplatten ist in Abschnitt 13 zu finden.
Eisenschwelle neuzeitlicher Form
Dem Eisenbahnbau ist es im Lauf der Jahrzehnte gelungen, unerhörte Schwierigkeiten zu überwinden. Die viele tausend Kilogramm schweren Fahrzeuge rollen über unergründliche Moore hinweg, sie fliegen auf Brücken über grauenhafte Abgründe und haben sich einen Weg durch die mächtigsten Gebirgsstöcke gebahnt. Die Wüste und das Meer sind überwunden worden, aber ein Hindernis, das ganz bescheiden aussieht, hat bis zum heutigen Tag allen Bemühungen widerstanden, mit denen man versuchte, es unschädlich zu machen.
Englischer Schienenstuhl
(zur Festhaltung der Doppelkopf-Schiene mittels eingetriebenen Holzkeils)
Wenn man noch jetzt auf der Eisenbahn durch ein lebhaftes Geräusch der fahrenden Züge und hier und da unter Erschütterungen leidet, so sind daran weder der Unterbau noch der Oberbau schuld, nicht die Schwellen und nicht die Schienen an sich verursachen diese Unannehmlichkeit, sondern ein Bauteil, im einzelnen von geringer Größe aber durch seine Vielfältigkeit von größter Bedeutung, ist der Unheilstifter. Wie ein Bazillus haust er im Bahnkörper und hat sich bis jetzt allen Austreibungsversuchen zu entziehen vermocht.
Die Schiene läßt sich auch auf der Walze nicht als endloses Band herstellen, und wenn dies möglich wäre, so müßte man sie trotzdem in verhältnismäßig kurzen Stücken anfertigen, da jedes Gleis stark wechselnden Wärmegraden ausgesetzt ist. Hierbei verändert das Eisen fortwährend seine Länge, indem es sich bei Kälte zusammenzieht und bei Erwärmung wieder ausdehnt. Es ist notwendig, in gewissen, nicht allzu langen Abständen in die Geleise Lücken einzuschalten, die einen Ausgleich dieser Längenveränderungen gestatten. Der Schienenstoß ist also eine Notwendigkeit und wird es immer bleiben, solange Schienen ohne vollständige Einbettung daliegen.
Während die Räder über die Rücken der Schienen glatt hinweglaufen, erhalten sie jedesmal einen schweren Schlag, wenn sie am Stoß von einem Schienenstück auf das andere übergehen. Es ist wohl gelungen, hier einige Verbesserungen gegen die Anfangszeit zu schaffen, aber im Grund wirkt der Stoß, wenn man die gesteigerte Geschwindigkeit in Betracht zieht, heute gerade noch so schädlich wie zu der Zeit, als Stephenson seine Strecken baute.
Hakennagel mit Sperransatz
(zur Befestigung der ersten Breitfußschienen auf Holzschwellen)
Spurstange
(zur Sicherung der Schienen gegen Umkanten)
Über die Vorgänge, die sich am neuzeitlichen Schienenstoß vollziehen, wird gleichfalls in Abschnitt 13 Näheres mitgeteilt werden. Hier haben wir nur von der Entwicklung des Schienenstoßes bis in die Nähe seiner heutigen Form zu sprechen.
Haltenase
(zum Verhindern des Schienenumkantens)
Die Reynoldsschen Gußbarren wurden mit je drei Nägeln auf die Längsbohlen genagelt. Eine besondere Berücksichtigung des Stoßes fand nicht statt. Jessops Pilzschienen hatten an den Enden Verbreiterungen zur Aufnahme der Befestigungsnägel. Eine Verbindung der Schienenstücke untereinander wurde auch hier nicht vorgenommen.
Um 1820 trifft man die ersten Stoßstühle an. Sie waren notwendig geworden, weil die Jessopschen Verbreiterungen sehr leicht abbrachen. Es schien darum besser, das Befestigungsmittel von der Schiene selbst zu trennen. Man hielt die Schienen im Stuhl dadurch fest, daß durch jedes der beiden Schienenenden ein Bolzen gesteckt wurde.
Es stellte sich bald heraus, daß diese Befestigungsart sehr schädlich auf die Fahrzeuge einwirkte, welche über die Schienen rollten. Jedesmal wenn ein Rad von einem Schienenstück auf das andere überging, erhielt es einen schweren Stoß. Zusammen mit William Losh erfand Georg Stephenson 1816 den ersten Überblattungsstoß. Hierbei stießen nun die Schienen nicht mehr stumpf zusammen, sondern die Enden waren in Z-Form ineinandergefügt und im Stuhl durch einen gemeinschaftlichen Bolzen befestigt. Hierdurch sollte ein gleichmäßigeres Sinken der beiden Schienenenden unter dem Raddruck herbeigeführt werden, was in der Tat auch bis zu einem gewissen Grad gelang. Für die Bahn Stockton-Darlington sind die Schienen, auch die aus Schmiedeisen, mit diesem Stoß verlegt worden.
Älteste Stoßverbindung
(Stoßstuhl mit besonderen Bolzen für jedes Schienenende)
Überblattungsstoß
(Die Schienenenden werden durch einen gemeinsamen Bolzen zusammengehalten)
Alle bis jetzt erwähnten Schienenendbefestigungen sind feste Stöße. Durch ihre unmittelbare Auflagerung auf den Schwellen wirken sie hart und unnachgiebig auf die Räder, hammerartig auf die Schwellen. Es war darum eine sehr bedeutende Verbesserung, als Bridges Adams im Jahre 1847 auf die Vorzüge des schwebenden Stoßes aufmerksam machte, der seitdem überall eingeführt worden ist. Der schwebende Stoß liegt zwischen den Schwellen. Die Schienenenden sind durch Laschen miteinander verbunden. Adams legte diese noch ohne besondere Befestigung in die Stühle ein. Aber schon 1850 verwendete Ashkroft Laschen, die durch je zwei Schraubenbolzen an den zusammenstoßenden Schienenstücken befestigt waren. Insbesondere nachdem die Schienen eine solche Form erhalten hatten, daß die Lasche als feste Stütze zwischen den scharf unterschnittenen Kopf und Fuß geklemmt werden konnte, bürgerte sich dieser verlaschte Schienenstoß überall ein, und er ist auch als die Grundform für die Bauart unseres heutigen Schienenstoßes anzusehen.
Schwebender Stoß nach Bridges Adams
(Die Stoßfuge liegt zwischen den Schwellen. Die Laschen sind lose eingesetzt)
Schwebender Stoß von Ashkroft
(mit verschraubten Laschen)
Wichtig ist noch die Lage der Stöße in den Schienen eines Gleises zueinander. Man kann die Stöße winkelrecht einander gegenüberlegen, oder man kann sie gegeneinander versetzen. Im ersten Fall spricht man vom Gleichstoß, die zweite Anordnung nennt man Wechselstoß.
Wechselstoß
(Die Stoßfugen liegen im Gleis nicht einander gegenüber)
Beim Wechselstoß schlagen die beiden Räder einer Achse nicht zu gleicher Zeit gegen die Schienenköpfe; aber dieser Vorzug ist doch sehr rasch als gering erkannt worden gegenüber dem Nachteil, daß für das Gefühl der Fahrgäste in den Wagen die Zahl der Stöße sich verdoppelt. So hat der Wechselstoß auf der geraden Strecke nur wenig Anwendung gefunden. In Deutschland ist er niemals üblich gewesen. In Krümmungen hat man ihn früher öfter eingebaut, da bei solcher Schienenlage der vollkommene Gleichstoß nicht ohne weiteres zu erzielen ist. Im Bogen ist ja die äußere Schiene länger als die innere. Heute ist bei uns auch im gekrümmten Gleis der Gleichstoß überall vorgeschrieben, die Unterschiede in den Schienenlängen werden vor jedem Stoß durch Ausgleichschienen behoben.
Knüppelweiche in hölzernem Gleis
(Weichen dieser Art sind heute noch in siebenbürgischen Bergwerken in Gebrauch)
Die feste Führung der Fahrzeuge auf den Spurbahnen macht es notwendig, besondere Einrichtungen vorzusehen, damit man die Züge von einem Gleis auf das andere überführen kann. Wir nennen diese Einrichtungen Weichen.
Eine der ältesten Weichen-Bauarten wird noch heute auf der Apostelgrube Brad in Siebenbürgen verwendet. Eine solche Weiche ist in der ausgezeichneten Schienensammlung des Königlichen Verkehrs- und Baumuseums in Berlin ausgestellt. Diese Sammlung, die ein unvergleichliches lebendiges Bild von der Entwicklung des Gleises gibt, ist dem Museum von dem verstorbenen Generaldirektor des Georg-Marien-Bergwerks- und Hüttenvereins in Osnabrück, Haarmann, gestiftet worden, der sie mit außerordentlichem Fleiß allmählich zusammengebracht hat. Haarmann ist auch der Verfasser des großen Werks „Das Eisenbahngeleise“, einer umfassenden geschichtlichen Darstellung des Gegenstands, dessen Darlegungen hier größtenteils gefolgt wurde.
Die Brader Weiche hat nur ein einziges bewegliches Stück, in dem die beiden wichtigsten Teile der Weiche, die Zunge und das Herzstück, zusammengefaßt sind. Die Weichenzunge hat die Aufgabe, das Rad des über sie rollenden Fahrzeugs auf die Abzweigung hinüberzudrücken, indem sie den Spurkranz zur Seite zwingt. Das Herzstück ist diejenige Stelle des Gleises, in der die dem abzweigenden Strang näher liegende Schiene des geraden Strangs von der darüber laufenden des abzweigenden Strangs geschnitten wird. An diesem Punkt muß notwendigerweise eine Unterbrechung des Gleises stattfinden, damit die Spurkränze der Räder hindurchlaufen können. Die Brader Weiche, die für ein Gleis von nur 40 Zentimetern Spurweite bestimmt ist und eine sehr scharfe Krümmung hat, ist so kurz, daß der Drehpunkt der Weichenzunge zugleich das Herzstück bildet, was im eigentlichen Eisenbahngleis niemals vorkommt. Die Zunge ist nichts weiter als ein Holzknüppel, der mit dem Fuß verschoben werden kann.
Schon bei den Weichen, die von Stephenson auf der Bahnstrecke Stockton-Darlington angewendet wurden, finden wir eine Ausgestaltung, die sich den heute üblichen Bauarten sehr stark nähert. Zungenteil und Herzstück sind selbstverständlich getrennt, da auf Lokomotivbahnen ganz scharfe Knicke niemals angewendet werden konnten, und es findet sich bereits eine Zunge an jeder der beiden Schienen, was unserer heutigen Zweizungenweiche entspricht.
Bei manchen der ersten Eisenbahnen, z. B. auch bei der im Jahre 1835 eröffneten Linie Brüssel-Mecheln war die sogenannte Schleppweiche im Gebrauch. Ihre Bauart, die auf Bild 64 zu erkennen ist, erlaubt eine sehr einfache Ausgestaltung. Sie hat jedoch den schweren Nachteil, daß jedes Fahrzeug, welches aus dem Strang kommt, für den die Weiche nicht gestellt ist, notwendig entgleisen muß. Wegen dieser Gefahr, die sie bieten, ist die Anwendung von Schleppweichen bei uns jetzt verboten.
Eine ältere Bauart, die wir heute gleichfalls nicht mehr kennen, ist die Radlenkerweiche (Bild 65). Bei dieser waren zwei miteinander verbundene Zwangsschienenstücke innerhalb des Gleises beweglich. Das heranrollende Rad lief, je nach der Stellung der Weiche, gegen die Seitenfläche der einen oder der anderen Zwangsschiene und wurde so entweder auf das gerade oder auf das abzweigende Gleis hinübergedrückt — ein Vorgang, den man sich bei unseren heutigen Schnellzügen nicht ohne Beängstigung vorstellen kann.
Dasjenige Bahnmaß, welches den größten Einfluß auf die Gestaltung der feststehenden und beweglichen Eisenbahnbauten ausübt, ist die Spurweite, das heißt der Abstand der Schienen eines Gleises, gemessen von Innenkante zu Innenkante des Kopfs. Von ihr sind die Ausmaße des Unterbaus und die zulässigen Krümmungen ebenso abhängig, wie die Breiten der Wagen und Lokomotiven. Um so eigenartiger ist es, daß die heute vorherrschende sogenannte Regelspur ohne rechte Überlegung mehr zufällig entstanden ist. Man kann dem blinden Schicksal, das hier obwaltete, kein Loblied singen. Wenn es denkbar wäre, die Spurweite der Bahnen heute noch zu ändern, so würde man zum mindesten für die Hauptbahnen einen breiteren Schienenabstand wählen. Insbesondere die Lokomotivbauer werden durch den geringen Raum, der ihnen in der Breite zur Verfügung steht, fortwährend in ihren Entwürfen behindert. Es fällt ihnen immer schwerer, neue Bauteile auf der Lokomotive unterzubringen.
Nachdem im achtzehnten Jahrhundert bei den mit Pferden betriebenen Kohlenbahnen Spurweiten von einem halben Meter und weniger üblich gewesen, wurde für die im Jahre 1800 eröffnete Merthyr-Tydvil-Bahn in England eine Spur von 5 Fuß = 1,524 Meter gewählt; dieses Maß bedeutet hier den Abstand der Innenflächen, der an den Currschen Winkelschienen außen angeordneten Spurränder. Es wurde mit Rücksicht auf die Radabstände der in Nordengland damals gebräuchlichen Straßenfuhrwerke gewählt, denen die Möglichkeit gegeben werden sollte, die Bahn zu benutzen. Der Betrieb auf der Strecke mit dieser Spur muß sich wohl als recht günstig erwiesen haben, denn der gleiche Schienenabstand wurde beibehalten, als durch die Einführung der Jessopschen Pilzschiene Wagen mit Spurkranzrädern notwendig wurden, so daß ein Befahren der Geleise durch Straßenfuhrwerk nicht mehr möglich war. Stephenson wendete bei seinen ersten mit Lokomotiven befahrenen Bahnen die gleiche Spurweite an, deren Maß, das jetzt nicht mehr zwischen außen angeordneten Spurrändern, sondern zwischen Schieneninnenkanten anzulegen ist, 4 Fuß 6 Zoll = 1,372 Meter betrug. Als der Meister sich dann aber später beim Bau seiner Lokomotiven in der Fabrik zu Newcastle in dem Raum zur Unterbringung der Dampfzylinder sehr beengt sah, erweiterte er, nach Haarmann, die Spur der von ihm zu erbauenden Bahnen, so auch bereits bei der Strecke Stockton-Darlington, um 21⁄2 Zoll. Auf diese Weise entstand die heutige Regelspur von 4 Fuß 81⁄2 Zoll = 1,435 Meter. Ihre Ausbreitung von England über viele andere Länder, zu denen auch Deutschland gehörte, geschah dadurch, daß in der Anfangszeit des Eisenbahnbaus fast sämtliche Lokomotiven aus Newcastle bezogen wurden.
Älteste Zweizungen-Weiche
(benutzt auf der Bahn Stockton-Darlington)
Ganz ohne Kampf aber konnte sich die Regelspur doch nicht durchsetzen. Der berühmte Erbauer des ersten Tunnels unter der Themse, Isambart Kingdom Brunel, befürwortete im Jahre 1833 bei der Erbauung der Großen Westbahn dringend eine größere Spurweite, weil er hoffte, daß man auf dem breiteren Gleis mit den hierauf möglichen geräumigeren Lokomotivkesseln eine höhere Geschwindigkeit würde erreichen können. Stephenson sprach sich in einem Gutachten dagegen aus. Dennoch wurde die Große Westbahn mit einer Spur von 7 Fuß = 2,135 Meter angelegt.
64. Schleppweiche
(Ältere, sehr einfache aber betriebsgefährliche Weichenform,
deren Anwendung in Deutschland verboten ist)
Diesem Beispiel folgten drei andere Bahnen in England und Irland. Und bald griff das böse Beispiel so weit um sich, daß, nach Launhardt, schließlich in Großbritannien 70 verschiedene Spurweiten vorhanden waren. Die Abmessungen bewegten sich zwischen der 59 Zentimeter breiten Spur der Bahn von Festiniog nach Port Madoc und der Spur von 2,135 Meter auf der Großen Westbahn. Es wurde schließlich notwendig, dem immer fühlbarer werdenden Übel durch die Gesetzgebung ein Ende zu machen. Der Spur-Ausschuß des Parlaments setzte fest, daß in England und Schottland keine Bahn mehr mit einer anderen als der Regelspur gebaut werden dürfe. Jede Gesellschaft, die eine andere Spurweite anwende, habe eine Strafe von 125 Mark für jedes Kilometer und für jeden Tag ihres Bestehens zu bezahlen. Ja, der Staat erhielt das Recht, solche Eisenbahnen einfach beseitigen zu lassen. Für die Insel Irland wurde die Spur von 1,6 Meter vorgeschrieben, wie sie dort noch heute besteht.
Radlenker-Weiche
(mit verschiebbaren Zwangsstücken für die Räder)
Seltsamerweise durfte aber die Große Westbahn ihre breitere Spur noch beibehalten. Sie sah sich zwar schließlich genötigt, eine dritte Schiene zur Ermöglichung des Durchgangsverkehrs einzulegen, beseitigte jedoch die letzte Breitspurstrecke erst im Jahre 1892.
In Amerika versuchte man gleichfalls hier und da die Breitspur. Sie hatte dort jedoch keinen großen Erfolg. Überall wurde der breitere Schienenabstand bald wieder zur Regelspur umgebaut. Im Jahre 1871 brachte eine kanadische Bahn das echt amerikanische Kunststück fertig, ihre 547 Kilometer lange Strecke durch ein Arbeiterheer von 2720 Mann an einem einzigen Tag umzulegen.
Deutschland blieb von dem Kampf der Spurweiten glücklicherweise fast völlig verschont. Die badischen Bahnen, die Anfang der dreißiger Jahre ein Spurmaß von 1,8 Meter hatten, fügten sich bald dem üblichen ein.
Breitspur haben heute in Europa nur die Bahnen in Rußland (1,524 Meter) und in Spanien und Portugal (1,676 Meter).
Bei der Entwicklung des Eisenbahngleises ist von den Ingenieuren kühne und rasche Arbeit geleistet worden. Mit Fleiß und Ausdauer wurde immer von neuem versucht, die vorhandenen Fehler zu beseitigen, jeder neue Gedanke ward erprobt und, wenn er irgend brauchbar war, ausgestaltet. Trotz alledem ist die eigentümliche Tatsache zu beobachten, daß der an sich so einfache technische Gegenstand, den das Eisenbahngleis darstellt, noch heute, nach mehr als neun Jahrzehnten der Entwicklung, von der Vollkommenheit sehr weit entfernt ist. Eigentlich probt und bastelt man an den verschiedenen Bauarten heute noch geradeso herum wie zu Stephensons Lebzeiten.
Das Gleis ist ja eigentlich nichts anderes als eine Brücke mit sehr engen Jochen. Während aber bei den großen, weit gespannten Brücken über Flüsse oder Täler vollkommen zufriedenstellende Festigkeitsergebnisse erreicht sind, ist das bei der Gleisbrücke nicht der Fall. Der Grund liegt darin, daß die Kräfte, durch welche die Brückenpfeiler beansprucht werden, der Berechnung verhältnismäßig leicht zugänglich sind. Das Gleis aber liegt nicht fest auf seiner Unterlage, sondern in nachgiebiger Bettung; die Joche erhalten an den Schienenstößen fortwährend furchtbare Schläge, deren Kraft man nicht kennt, so daß hier immer wieder nur die nackte Erfahrung maßgeblich ist. Die Hoffnung, zu einer endgültigen Form des Eisenbahngleises zu gelangen, ist auch heute noch sehr gering. Das hat aber nicht den ungeheuren Fortschritt gehindert, den das Stellen der Fahrzeuge auf die eiserne Bahn der Menschheit gebracht hat.