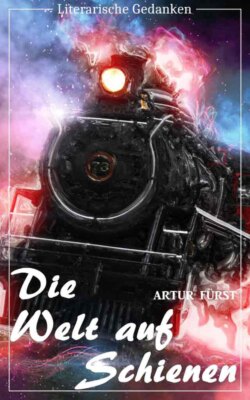Читать книгу Die Welt auf Schienen (Artur Fürst) - mit den originalen Illustrationen - (Literarische Gedanken Edition) - Fürst Artur - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
6. Eisenbahnfrühling in Deutschland
ОглавлениеUnser Vaterland war in seiner Gestaltung nach den Freiheitskriegen nicht dazu geeignet, eine so neue und großartige Einrichtung, wie Stephenson sie geschaffen hatte, rasch aufzunehmen und bei sich zu entwickeln. Ein Großgewerbe gab es damals in deutschen Landen überhaupt noch nicht; der Ackerbau war vorherrschend.
Niemals hatte die Kleinstaaterei in üppigerer Blüte gestanden. Jedes der kleinen und kleinsten Ländchen schloß sich gegen das andere ab, wollte sich großtun, wollte ein Mittelpunkt sein. Gegen alle Vernunft und selbst gegen den eigenen Nutzen wurde in jedem Ländle ein Verkehrsschwerpunkt hochgezüchtet, der eigentlich gar keiner war, und durch diese künstliche Stauung konnte ein natürliches Fließen der Verkehrsgegenstände überhaupt nicht eintreten.
Zu dieser Mißgestalt des wirtschaftlichen Lebens gesellten sich die kümmerlichen politischen Zustände. Es war die Zeit des schärfsten Rückschritts in Deutschland. Der Geist Metternichs und der Heiligen Allianz erdrückte jede freiheitliche Regung. Die Regierungen waren ängstlich darum besorgt, das Selbstherrschertum gegen das immer dringendere Begehren des Volks nach Mitwirkung bei der Lenkung des Staats zu schützen, und sie wandten sich voller Scheu von jeder frischen Neuerung ab, weil der damals herrschende Geist nur in dumpfen Stuben zu gedeihen vermochte.
Der Eisenbahngedanke aber bedarf, um sich entwickeln zu können, eines weiten Wirkungsfelds, einer großen, geschlossenen Wirtschaftsgemeinschaft und zukunftsfreudiger Seelen. So ist es denn kein Wunder, daß die Anlage der ersten Schienenwege in Deutschland ohne rechten Plan erfolgte und daß die einzelnen Glieder vorerst gar keinen Zusammenhang miteinander hatten. Ganz ließ sich trotz der redlichen Bemühungen aller rückschrittlich Gesinnten die große neue Erfindung nicht fernhalten. Denn auch in dem damaligen Deutschland lebten Männer, die im Innersten ihres Herzens fühlten, daß durch die Einführung des neuen Verkehrsmittels eine große, vaterländische Aufgabe zu lösen war.
Zwei Gestalten insbesondere sind es, die aus der damaligen Zeit bis heute hinüberleuchten: Friedrich Harkort und Friedrich List. Sie sind die Begründer der deutschen Eisenbahnen.
Mit tiefer Achtung, ja ehrfurchtsvoll werden die Namen der beiden Männer heute bei uns ausgesprochen. Aber zu der Zeit, als sie gegen unerhörte Widerwärtigkeiten und rücksichtsloseste Angriffe wirkten, ward ihnen nur wenig Vertrauen entgegengebracht. Beider Lebensschicksale sind erschütternd. Der eine, Harkort, sah wohl, als er in hohem Alter starb, Deutschland schon von Eisenbahnlinien erfüllt, aber keine einzige der Strecken ist schließlich durch seine unmittelbare Einwirkung entstanden. List gar schied als ein Verkannter, Verdammter durch eigene Entschließung aus dem Leben. Der endlich hervorbrechende volle Strom des deutschen Eisenbahnverkehrs ging über die beiden Männer hinweg, deren Lebensarbeit es gewesen war, die hindernden Felsblöcke aus seinem Bett hinwegzuräumen.
Im Eröffnungsjahr der Stockton-Darlington-Bahn, im März 1825, erschien in der westfälischen Zeitung „Hermann“ ein Aufsatz, der zum erstenmal die deutsche Öffentlichkeit auf die Bedeutung der Eisenbahnen aufmerksam machte. Sein Verfasser war Friedrich Harkort. Der Aufsatz hatte folgenden Wortlaut:
Eisenbahnen (Railroads).
„Durch die rasche und wohlfeile Fortschaffung der Güter wird der Wohlstand eines Landes bedeutend vermehrt, welches Kanäle, schiffbare Ströme und gute Landstraßen hinlänglich bewähren.
„Der Staat sollte aus diesem Grunde die Weggelder nicht als eine Finanzquelle betrachten, sondern nur die Kosten einer vorzüglichen Unterhaltung erheben.
„Größere Vortheile wie die bisherigen Mittel scheinen Eisenbahnen zu bieten.
„In England sind bereits zu diesem Behuf über 150 Millionen Preuß. Thaler gezeichnet: ein Beweis, daß die Unternehmungen die öffentliche Meinung in einem hohen Grade für sich haben.
„Auch in Deutschland fängt man an, über dergleichen Dinge wenigstens zu reden, und folgende Bemerkungen liefern vielleicht einige Beiträge dazu.
„Meine Absicht ist nicht, in die Einzelheiten der Sache einzudringen; vorläufig genügen wohl einige allgemeine Umrisse.
„Die westliche Eisenbahn von London nach Falmouth wird eine Länge von 400 engl. Meilen erhalten.
„Von Manchester nach Liverpool ist eine neue Eisenbahn von 32 engl. Meilen in Vorschlag gebracht, obgleich eine Wasserverbindung vorhanden.
„Versuche, welche deshalb in Killingworth angestellt wurden, ergaben, daß eine Maschine von 8 Pferde Kraft ein Gewicht von 48 Tonnen mit einer Geschwindigkeit von 7 Meilen pro Stunde auf einer Ebene bewegte.
„Denken wir uns nun eine solche Fläche von Elberfeld nach Düsseldorf, so würden 1000 Zentner in 21⁄2 Stunden von einem Orte zum andern geschafft werden, mit einem Kohlenaufwande von 5 Scheffel für die Reise.
„Eine Maschine von 8 Pferde Kraft würde innerhalb 3 Stunden 1000 Scheffel Kohlen von Steele nach dem Rheine schaffen, das heißt die Ruhrschiffahrts-Cassa völlig aufs Trockene setzen.
„Die sämmtlichen Ruhr-Zechen erhielten durch eine Eisenbahn den unschätzbaren Vortheil eines raschen, regelmäßigen Absatzes unter großen Frachtersparungen.
„Innerhalb 10 Stunden könnten 1000 Centner von Duisburg nach Arnheim geschafft werden; die Beurtschiffer liegen allein 8 Tage in Ladung.
„Man macht vielleicht den Einwand, daß nur selten eine Ebene sich ausmitteln läßt. Dagegen erwidere ich, daß zwar nach Verhältniß des Steigens mehr Kraft erforderlich ist oder die Geschwindigkeit abnimmt, die Rückfahrt indessen um so viel rascher von Statten geht und die mittlere Geschwindigkeit bleibt.
„Die größte Neigung des Weges zu Killingworth war 1 Fuß in 840 und das höchste Steigen 1 in 327.
„Die Eisenbahnen werden manche Revolutionen in der Handelswelt hervorbringen. Man verbinde Elberfeld, Köln und Duisburg mit Bremen oder Emden, und Holland’s Zölle sind nicht mehr!
„Die Rheinisch-Westindische Compagnie darf Elberfeld als einen Hafen betrachten, sobald der Centner für 10 Silbergroschen binnen 2 Tagen an Bord des Seeschiffes in Bremen zu legen ist.
„Zu diesem Preise ist es für die Holländer unmöglich, selbst vermittelst Dampfbooten, die Güter zu übernehmen.
„Wie glänzend würden die Gewerbe von Rheinland-Westfalen bei einer solchen Verbindung mit dem Meere sich gestalten!
„Möge auch im Vaterlande bald die Zeit kommen, wo der Triumphwagen des Gewerbefleißes mit rauchenden Kolossen bespannt ist und dem Gemeinsinne die Wege bahnet!“
Diese Darlegungen erregten großes Aufsehen, aber die Schwerfälligkeit des deutschen öffentlichen Lebens sorgte dafür, daß sie nicht sogleich greifbare Folgen nach sich zogen.
Der Mann, der hier als Vorkämpfer des neuen Verkehrsmittels auftritt, Friedrich Wilhelm Harkort, war am 22. Februar 1793 auf dem väterlichen Hof Harkorten in der Grafschaft Mark, unweit Hagen, geboren. Er entstammte einem alten Geschlecht, das schon viele Menschenalter hindurch auf eigenem Boden gesessen hatte und in ganz Westfalen ein großes Ansehen besaß.
Zwischen Hagen und Schwelm erstreckt sich die alte Enneper Straße, die schon Ernst Moritz Arndt im Auge hatte, als er von der Stätte sprach, „wo der Märker Eisen reckt“. Dort, wo heute ein Fabrikhaus neben dem andern liegt, standen damals in kurzen Zwischenräumen die Häuschen der Eisenschmiede. Reckhämmer nannte man die ungefügen Schläger, durch deren Aufpochen das Eisen in seinem inneren Gefüge verbessert und in rohe Form gebracht wurde. Die Wasserkraft des Ennepe-Flusses, der in die Ruhr fällt, war es, die jene Hämmer in Bewegung setzte. Hier ist die Wiege des mächtigen rheinisch-westfälischen, ja des deutschen Großgewerbes.
Auch der Vater Friedrichs, Johann Caspar Harkort, betrieb zusammen mit seinem Bruder vier Hammerwerke an der Enneper Straße. So kamen die „Harkorter Jungens“ — Friedrich hatte noch sechs Brüder — schon früh mit dem Handwerk in Berührung.
Friedrich, der als ein schöner, kraftvoll gebauter Jüngling geschildert wird, machte als Leutnant die Feldzüge von 1814 und 15 mit. Er wurde hierbei mehrfach verwundet, so auch in der Schlacht bei Ligny. Des öfteren hatte er Gelegenheit, sich als einer der Tapfersten zu erweisen.
Als nach Napoleons Sturz die Heere aufgelöst worden waren, begann rasch jene Zeit der Unterdrückung aller politischen Freiheiten. Auch Friedrich Harkort litt schwer darunter und beteiligte sich durch Wort und Schrift mit großer Tatkraft an dem Kampf. Aber ebensosehr lag es ihm am Herzen, das gewerbliche Leben in Deutschland zu erwecken. Er kannte die Erfolge der Engländer auf dem Gebiet der Eisenindustrie, die ihnen insbesondere durch die Ausnutzung der neuen Wattschen Dampfmaschine möglich geworden waren. Harkort meinte, daß man es bei genügendem Eifer den Engländern in Deutschland wohl nachtun könnte.
So gründete er auf der alten Burg Wetter an der Ruhr im Jahre 1818 eine Maschinenfabrik. Sie ist die Lehrstätte der deutschen Maschinenbauer geworden. Schon 1820 war die erste in Wetter gebaute Fördermaschine in Tätigkeit. Die Bezirke von Elberfeld und Barmen, in denen heute so viele Tausende von Rädern sich drehen, erhielten, nach dem Schilderer von Harkorts Leben, Berger, die ersten Dampfmaschinen gleichfalls aus Wetter. Im Jahre 1822 erklärte Beuth, die Harkortsche Fabrik gehöre „unter die merkwürdigsten und bewundernswerten Anstalten in Deutschland“. Die Maschinen, die dort erzeugt wurden, seien vollkommen und könnten sich den besten englischen an die Seite stellen. Auch die Einführung des für die Eisenaufbereitung so wichtigen Puddelverfahrens in Deutschland ist Harkorts Werk. So kann man es verstehen, daß in Westfalen das Sprichwort umging: „Fritz Harkort macht uns das Bett, und wir andern legen uns hinein“.
Das Vertrauen seiner Mitbürger berief später den kühn schaffenden Mann in die Preußische Nationalversammlung von 1848. Er hat dem Norddeutschen und auch noch dem ersten Deutschen Reichstag angehört.
Es ist ganz selbstverständlich, daß ein Mann solcher Art die in seiner Umgebung bestehenden Verkehrsübelstände scharf empfinden mußte. Harkort sah, wie die Holländer, welche sich seit dem Wiener Kongreß im Besitz der Rheinmündungen befanden, den deutschen Überseehandel gewaltsam niederhielten, indem sie unmäßig hohe Ausgangszölle erhoben. In seinem Aufsatz im „Hermann“ betonte er darum, daß eine Verbindung der Rheinnebenflüsse mit der Ems oder der Weser durch eine Eisenbahn die Möglichkeit schaffen würde, beim Ausgang der Handelsschiffe ins Meer Holland ganz zu vermeiden und Bremen oder Emden an die Stelle von Rotterdam zu setzen.
Bei dem schlechten Zustand der damaligen Landstraßen waren ja die Flüsse die einzigen verhältnismäßig bequemen Verkehrswege, die zur Verfügung standen. Vorläufig konnte noch nicht weiter gedacht werden, als die Eisenbahn nur zur Überbrückung solcher Gebiete zu benutzen, die nicht von einem schiffbaren Wasserlauf durchzogen wurden. Harkort erhoffte insbesondere viel von der Errichtung einer Eisenbahn zwischen Minden an der Weser und Lippstadt an der Lippe, einem Nebenfluß des Rheins, durch die ein Güteraustausch zwischen den beiden großen voneinander getrennten Flußnetzen möglich werden sollte.
Obgleich das Nützliche dieses Gedankens jedem einleuchten mußte, und obwohl, wie schon angedeutet, der Aufsatz Harkorts im „Hermann“ viel beachtet wurde, fand er doch keinen Widerklang in den Kreisen, die dem Werk wirklich hätten förderlich sein können. Mit Recht wies, wie Berger mitteilt, eine Zuschrift im „Hermann“ auf die für die damalige Zeit geltende Wahrheit hin, „daß in unserem Vaterland nützliche Erfindungen gewöhnlich erst dann in Anwendung gebracht werden, wenn uns das Ausland den besten Teil der Vorteile, die dadurch zu erreichen gewesen sein würden, vorweggenommen hat“.
Aber Harkort war von der Bedeutung der Eisenbahnen so fest überzeugt, daß er sich nicht mit Worten allein begnügte. Er schritt, seiner ganzen Natur entsprechend, sogleich zu einer Tat. Im Jahre 1826 erbaute er im Garten der Museumsgesellschaft zu Elberfeld eine Probebahnstrecke. Leider wählte er hierfür nicht die in England bereits vielfältig bewährte Bauart der zweischienigen Standbahn, sondern benutzte als Vorbild eine von Palmer ersonnene, etwas seltsame Bahngattung. Es wurden Baumstämme in die Erde gerammt, hierüber eine hoch über dem Boden schwebende Schiene befestigt und die Wagen zu beiden Seiten an darüber gelegte Querstangen gehängt. Es war also eine Art Schwebebahn, wenn auch ganz verschieden von der heute gerade in Elberfeld benutzten Bauart.
Große Erfolge ließen sich mit einer solchen Bahnstrecke nicht erzielen. Dennoch wurde allen, die den Bau sahen, klar, daß man wirklich auf einer eisernen Schiene Gefährte weit leichter fortbewegen könne als auf der Straße, und darauf kam es Harkort an. Die Art des Antriebs schien ihm gleichgültig. In jener Zeit war die Lokomotive noch nicht viel mehr als ein fremdartiges Tier. Der Begriff „Eisenbahn“ bedeutete nichts weiter als einen Schienenweg, auf dem Wagen durch irgendein Zugmittel, meistens durch Pferde, fortbewegt wurden.
Es tauchte alsbald die Absicht auf, von Steele an der Ruhr eine Eisenbahn nach Elberfeld zu bauen, um die Ruhrkohle leichter dorthin schaffen zu können. Aber ehe noch der Antrag zur Genehmigung dieser Bahnstrecke bei der Staatsregierung gestellt war, erwachten auch in Westfalen jene Geister, die wir schon in England beim Auftauchen der ersten Eisenbahnentwürfe bei ihrer neuerungsfeindlichen Tätigkeit gesehen haben. Es ertönte das gleiche Geschrei wie jenseits des Kanals: daß die Einnahmen aus den Landstraßengeldern zum Schaden der Allgemeinheit fortfallen, daß die Kohlenfuhrleute wie die Wagenbauer zugrunde gehen müßten, wenn der Staat derartige unsinnige Unternehmungen begünstigte.
Die mit lauter Stimme vorgebrachten Einwendungen hatten Erfolg, und am 31. Oktober 1826 wurde den Antragstellern in der Tat die Genehmigung zur Ausführung der Strecke versagt. Es ist das die erste Äußerung der preußischen Staatsregierung zur Eisenbahnfrage. Die Ergebnislosigkeit dieses ersten Vorstoßes ist vielleicht nicht so sehr zu bedauern, da die von Harkort erkorene Einschienenbahn kaum zu günstiger Entwicklung hätte gelangen können. Er ging denn auch bald von dieser Bauart ab.
Indessen mehrte sich der Unwille gegen die Willkürherrschaft der Holländer an den Rheinmündungen weiter. Immer größere Kreise erkannten die Wichtigkeit einer Eisenbahnverbindung zwischen Weser und Lippe, das heißt unter Benutzung der Ruhr mit dem Rhein. Man lenkte die Aufmerksamkeit des weitblickenden preußischen Finanzministers von Motz darauf, und dieser griff den Gedanken mit Lebhaftigkeit auf. Im Jahre 1828 schrieb er in dem Hauptverwaltungsbericht, den er dem König erstattete:
„Noch wichtiger (nämlich als der Ausbau der großen schlesischen Landstraße) ist es — womöglich mit einer Eisenbahn von Minden bis Lippstadt und damit zugleich einer Verbindung auf der schiffbaren Lippe mit dem Rhein — eine ganz neue gewisse Richtung für den Verkehr von Bremen nach dem westlichen und südlichen Deutschland innerhalb der eigenen Grenze Ew. Königlichen Majestät Staaten hervorzurufen.“
Mit den letzten Worten deutete Motz darauf hin, daß die Eisenbahn nicht nur die Umgehung Hollands bringen, sondern auch einen ganz in Preußen verlaufenden Verkehrsweg von der See nach Süddeutschland erschließen würde, auf dem man Hannover und Kurhessen, also das „Ausland“ vermeiden könnte, was bei Benutzung der Flußläufe nicht möglich war.
Trotzdem geschah auch jetzt nichts von seiten des Staats zur Förderung der Angelegenheit. Da der allgewaltige Finanzminister sich für die Förderung des Eisenbahngedankens ausgesprochen hatte, so standen diesem nun allerdings die Beamten in Westfalen nicht mehr so feindlich gegenüber wie vorher. Auch die Holländer bekamen einen heilsamen Schreck und ermäßigten ihre Zölle. So hat hier die Eisenbahn schon allein in gedanklicher Form verkehrsfördernd gewirkt.
Immerhin wurden in den nächsten Jahren bereits ein paar kleine Schienenwege für Pferdebetrieb in Westfalen gebaut, von denen der wichtigste die Prinz Wilhelm-Eisenbahn von Steele nach Vohwinkel war. Zu ihrer Errichtung war auf Harkorts Veranlassung ein Aktienverein gebildet worden, die erste Eisenbahngesellschaft in Deutschland. Der damalige Generalgouverneur von Rheinland-Westfalen, Prinz Wilhelm, der spätere erste deutsche Kaiser, besichtigte die Bahnstrecke im Jahre 1831 und gab die Erlaubnis, ihr seinen Namen beizulegen.
Die Kunde von dem Lokomotivwettkampf zu Rainhill erregte bald darauf alle fortschrittlichen Geister in Deutschland. Immer klarer traten der Nutzen und die große Bedeutung der Eisenbahnen hervor. Harkort bewirkte, daß der Westfälische Provinziallandtag die Ausführung der Bahnstrecke Minden-Lippstadt zur Versorgung des Wuppertals mit Ruhrkohle beschloß und zwar als eine Anlage, die von den Provinziallandständen mit staatlicher Beihilfe gebaut werden sollte. Es ist bemerkenswert, daß in diesem Beschluß ausgedrückt wurde, die Bahn solle „einer Chaussee gleichen, welche ein jeder unter Wahrnehmung allgemeiner Polizeivorschriften gegen Erlegung des Wegegelds befahren könne“. Man war also auch hier der Meinung, daß einheitlicher Betrieb auf einer Bahnstrecke nicht unbedingt notwendig sei. Es wurde eine Bittschrift an den König aufgesetzt, die in der Hauptsache von Harkort verfaßt war und mit den Worten schloß:
„Ew. Majestät gnädige Gesinnungen lassen uns hoffen, daß ein so großartiges und für unsere Provinz so rühmliches und nützliches Unternehmen durch Allerhöchstdero Huld auf das baldigste ins Leben gerufen werden möge.“
Diese Hoffnung sollte jedoch nicht in Erfüllung gehen. Die Eingabe des Landtags blieb zunächst einmal 11⁄2 Jahre lang unbeantwortet. Dann erging im Juli 1832 der Bescheid, daß die Regierung „einer zu gründenden Aktiengesellschaft möglichstes Entgegenkommen bezeugen wolle, daß sie sich auch zur Übernahme von Aktien verstehen werde, aber weiter zu gehen, sei nicht angemessen, weil das jetzige Kommunikationsbedürfnis durch die Chaussee gesichert sei und die künftige kommerzielle Wichtigkeit der Anlage auf unsicheren Voraussetzungen beruhe“. Da die Regierung hiermit ausgedrückt hatte, daß sie Eisenbahnen für überflüssig und nicht entwicklungsfähig halte, so wurde trotz der in dem Bescheid gewährten Zugeständnisse die Entwicklung durch diese Antwort weiter verzögert.
Noch einmal entschloß sich Friedrich Harkort zu einem Vorstoß. Im Jahre 1833 veröffentlichte er seine Schrift „Die Eisenbahn von Minden nach Köln“, die also, nachdem der Lippstädter Plan gescheitert war, für eine größere Linie unmittelbar zum Rhein eintrat. Wie klar sein Blick in die Zukunft schaute, beweisen die Worte, die er in dieser Schrift über die militärische Bedeutung der Eisenbahnen äußerte:
„Die Kunst der Feldherren neuerer Zeit besteht darin, rasch große Streitmassen nach einem Punkte zu bewegen.
„Während ein preußisches Korps sich von Magdeburg auf Minden oder Kassel begibt, erreicht in derselben Zeit ein französisches Heer von Straßburg aus Mainz, von Metz aus Coblenz, von Brüssel aus Aachen; wir verlieren also zehn Tagemärsche, welche oft einen Feldzug entscheiden.
„Diesen Nachteil würde die Eisenbahn heben, indem 150 Wagen eine ganze Brigade in einem Tage von Minden nach Köln schafften, wo die Leute wohl ausgeruht mit Munition und Gepäck einträfen. — —
„Denken wir uns eine Eisenbahn mit Telegraphen auf dem rechten Rheinufer von Mainz nach Wesel. Ein Rheinübergang der Franzosen dürfte dann kaum möglich sein, denn bevor der Angriff sich entwickelte, wäre eine stärkere Verteidigung an Ort und Stelle.
„Dergleichen Dinge klingen jetzt noch seltsam, allein im Schoße der Zeiten schlummert der Keim so großer Entwicklung der Eisenbahnen, daß wir die Resultate nicht zu ahnen vermögen!“
Der Westfälische Provinziallandtag entschloß sich von neuem zu einem Genehmigungsgesuch bei der Regierung. Aber schon im Rheinischen Landtag dachte man anders über die Angelegenheit. Dort sagte der Abgeordnete Schuchart:
„Aber, meine Herren, mir schaudert vor der furchtbaren Umwälzung, wenn ich mir denke, daß Deutschland, mit den schönsten Kunststraßen übersäet, nach allen Richtungen mit guten Verbindungswegen versehen, plötzlich mit einer Eisenbahn durchschnitten werden sollte!“
Dieser Meinung schloß sich das preußische Ministerium an, indem es erklärte, die gewünschte Zinssicherung für die Bahn nicht gewähren zu können, da es die Gelder vorschriftsmäßig nur „zum allgemeinen Besten“ verwenden dürfe, hier aber — bei einer so bedeutenden Eisenbahnstrecke! — kein öffentliches, sondern nur ein örtliches Interesse vorliege.
Damit enden die Bemühungen, Westfalen zum Ursprungsbezirk des deutschen Eisenbahnnetzes zu machen. Harkort hörte, durch eigene Sorgen, durch die Tätigkeit für seine Maschinenfabrik und anderes in Anspruch genommen, fortab auf, weiter für seinen Lieblingsgedanken zu kämpfen. Im Jahre 1835 klagte er einem Freund:
„Heute sind es zehn Jahre geworden, als ich im ‚Hermann‘ zum erstenmal über Eisenbahnen schrieb. Großes hätte man in Preußen erreichen, alles mit einem Schlag voranbringen können, wenn die Sache damals energisch angegriffen würde. Stattdessen ist nichts geschehen; wir haben noch nicht eine Meile Bahn, und unsere Nachbarn, das junge Belgien voraus, schöpfen das Fett von der Suppe. Pfui über unsere unüberwindliche deutsche Schlafmützigkeit!“
Der Mißerfolg seines Lebenswerks hat Friedrich Harkort nicht das Herz gebrochen. In der allgemeinen Politik blieb er weiter tätig. Daß er so getrost im öffentlichen Leben fortwirken konnte, nachdem in späteren Jahren in Westfalen eine Eisenbahnstrecke nach der andern ohne sein Zutun gebaut wurde, erklärt sich vielleicht aus einem Ausspruch, den er über sich selbst getan hat: „Mich hat die Natur zum Anregen geschaffen, nicht zum Ausbeuten; das muß ich anderen überlassen!“ Seine Tätigkeit als Anreger bleibt denn auch in der Geschichte der deutschen Eisenbahnen unvergessen. Sicherlich wären die tatsächlichen Anfänge, die an anderen Stellen erfolgten, ohne sein Wirken erst weit später zutage getreten.
Friedrich Harkort ist, 87 Jahre alt, im Jahre 1880 auf seinem Gut Hombruch bei Dortmund gestorben.
Vor dem ersten „Anreger“ Harkort hat es in Deutschland noch einen allerersten gegeben. Es war dies der bayerische Oberbergrat Ritter Joseph von Baader, der schon im Jahre 1814 darauf hingewiesen hatte, daß die benachbarte Lage der Städte Nürnberg und Fürth, sowie der rege Personenverkehr zwischen den beiden Orten die Anlage eines Schienengleises als notwendig erscheinen lasse. Obgleich nun Baader, im Gegensatz zu Harkort, nicht in einen Kampf für seinen Gedanken eintrat, sollte er doch dessen Verwirklichung sehen. An der Stelle, auf die Baader aufmerksam gemacht hatte, wurde die erste Lokomotiv-Eisenbahnstrecke in Deutschland eröffnet. Allerdings war die Linie nicht sehr bedeutend, denn sie hatte nur eine Länge von sechs Kilometern.
Der unmittelbare Urheber des Eisenbahnbaus war der Nürnberger Bürger Johannes Scharrer, der neunzehn Jahre nach dem Vorschlag Baaders mit großer Tatkraft daran ging, eine Schienenverbindung zwischen den Nachbarorten zu schaffen. Vom 20. Januar 1833 ab wurde, um die nötigen Anhaltspunkte zu schaffen, vierzig Tage lang eine Zählung der Fußgänger, Wagen und Reiter veranstaltet, die sich auf der Landstraße zwischen Nürnberg und Fürth bewegten. Es stellte sich heraus, daß durchschnittlich 1720 Personen täglich den Weg zwischen den beiden Städten zurücklegten. Das schien genügend, um ein Bahnunternehmen mit der Hoffnung auf guten Erfolg zu begründen. An eine Güterbeförderung wurde überhaupt nicht gedacht, und sie ist auch erst in späterer Zeit aufgenommen worden.
Am 14. Mai 1833 erschien die Aufforderung zur Zeichnung des Aktienkapitals von 132 000 Florin = 224 000 Mark. Es wurde in Aussicht gestellt, daß jeder Aktienbesitzer zwölf vom Hundert an Zinsen erhalten sollte. Trotzdem nahm man die Aufforderung keineswegs mit Begeisterung auf. Es dauerte ein paar Monate, bis die erforderliche Summe beisammen war. Die bayerische Staatsregierung stellte sich dem Unternehmen zwar nicht entgegen, aber sie tat auch herzlich wenig zu seiner Förderung. Der Staat übernahm nur zwei Aktien zu je 100 Florin; es kostete die leitenden Männer sogar noch einige Mühe, diese kleine Summe wirklich aus der Staatskasse zu erhalten. Als endlich doch das Geld in der gewünschten Höhe beisammen war, gestattete König Ludwig I., daß das Eisenbahnunternehmen seinen Namen erhielt.
An Feinden hat es auch der Ludwigs-Bahn nicht gefehlt. Die Zöpfe wackelten auch in Bayern gewaltig ob dieser Neuerung, und selbst die hohe Wissenschaft glaubte, sich der neuen Verkehrsgattung entgegenstellen zu sollen, obgleich doch schon seit Jahren öffentliche Bahnen in England bestanden, ohne daß die Welt deswegen aus den Fugen gegangen oder die Erde entvölkert worden wäre. In der Werdezeit der Nürnberg-Fürther Bahn war es, als das bayerische Obermedizinalkollegium sein kulturgeschichtlich unvergeßliches Gutachten abgab:
„Die schnelle Bewegung muß bei den Reisenden unfehlbar eine Gehirnkrankheit, eine besondere Art des delirium furiosum erzeugen. Wollen aber dennoch Reisende dieser gräßlichen Gefahr trotzen, so muß der Staat wenigstens die Zuschauer schützen, denn sonst verfallen diese beim Anblick des schnell dahinfahrenden Dampfwagens genau derselben Gehirnkrankheit. Es ist daher notwendig, die Bahnstrecke auf beiden Seiten mit einem hohen, dichten Bretterzaun einzufassen.“
Am 18. November 1833 wurde dennoch die Gesellschaft der Ludwigs-Eisenbahn im Rathaussaal zu Nürnberg begründet. 207 Aktienbesitzer waren zugegen. Man nahm sogleich in Aussicht, einen oder zwei Dampfwagen zu bestellen, aber in der Hauptsache sollte der Betrieb durch Pferde vollzogen werden. „Nebst der Kostenersparnis“, so hieß es in dem erstatteten Bericht, „würde hieraus noch der Vorteil hervorgehen, daß die Fahrt auch zur Nachtzeit im Winter stattfinden könnte (warum?), und daß auch diejenigen Personen für die Bahn gewonnen werden, welche aus Besorgnis oder Furcht bei der Dampffahrt zurückblieben, jedenfalls würde dadurch unsere Unternehmung an Sicherheit und an Rente bedeutend gewinnen.“
Nachdem alle Vorbedingungen glücklich erfüllt waren, hieß es nun, den Baumeister für die Strecke zu bestellen. Man wandte sich an Herrn von Baader, aber dieser hatte vielerlei Bedenken und erklärte endlich, „er getraue sich’s nicht.“ Da den leitenden Männern in ganz Deutschland kein Ingenieur bekannt war, so wandte man sich an Stephenson nach Newcastle und war gerade im Begriff, für schweres Geld einen englischen Bauleiter kommen zu lassen, als Scharrer durch Zufall mit dem bayerischen Bezirksingenieur Paul Denis bekannt wurde. Dieser hatte auf seinen Reisen in England und Amerika den Eisenbahnbau gründlich kennen gelernt und erklärte sich sofort bereit, die Ausführung zu übernehmen.
Mit der Wahl dieses ersten Eisenbahningenieurs in Deutschland tat die Verwaltung der Ludwigs-Eisenbahn einen vorzüglichen Griff. Nach kurzer Zeit hatte Denis bereits alle Pläne aufgestellt, und nach einer Bauzeit von nur neun Monaten lag die Bahn fertig da.
Sämtliche Teile des Oberbaus stammten aus deutschen Fabriken. Aber das war nur deshalb der Fall, weil die bayerische Regierung durchaus nicht den Eingangszoll für englische Schienen erlassen wollte, wie es die Bahngesellschaft gewünscht hatte. Man hätte gar zu gern die Schienenbestellung nach England vergeben, da man zu den deutschen Fabriken gar kein Vertrauen hatte. Trotzdem gelang es der Firma Remy & Cons. in Rasselstein bei Neuwied, die Schienen zu vollster Zufriedenheit herzustellen.
Das Gleis der ersten deutschen Eisenbahn Nürnberg-Fürth
(Querschnitt durch Schienen, Steinschwellen und Bettung;
rechts eine Bettungsstampfe)
Für den Oberbau hatte man die Bahnlinien Stockton-Darlington und Manchester-Liverpool zum Vorbild genommen. Die Schienen ruhten auf steinernen Pfosten, die durch ringsherum gestampfte Steine von Faustgröße im Boden gehalten wurden. Auf den Steinschwellen waren, dem englischen Vorbild entsprechend, gußeiserne Stühle mit Hilfe von eisernen Nägeln in Holzdübeln befestigt und in diese die Schienen mit Keilen festgeklemmt. Mit Rücksicht auf den Pferdebetrieb hatte man den Raum zwischen den Schienen gepflastert. Ein Stück der Bahn war jedoch auch auf Holzquerschwellen verlegt.
Schienenbefestigung auf der ersten deutschen Eisenbahn
(Eiserner Schienenstuhl mit Nägeln, Dübeln und Filz-Unterlage auf Steinschwelle)
Daß die Lokomotive aus Newcastle bezogen werden mußte, war selbstverständlich. Sie leistete etwa 15 Pferdestärken und kostete 24 000 Mark. Man taufte sie auf den stolzen Namen „Adler“. Zur Bedienung der Maschine war ein Mechaniker aus England mit hinübergekommen, der alsbald sehr berühmte erste Lokomotivführer in Deutschland, Wilson. Auf allen Bildern, welche die Nürnberg-Fürther Bahn in ihrer Anfangszeit darstellen, sieht man ihn mit der steifen Haltung des Stockengländers auf der Lokomotive stehen. Er muß jedoch ein sehr tüchtiger Mensch gewesen sein, denn in einer der ersten Generalversammlungen erklärte ein Mitglied der Bahnleitung, daß man sehr zufrieden wäre, einen so brauchbaren Mann gefunden zu haben, der sehr nützlich sei, „obgleich es mit Schwierigkeiten und Kosten verbunden wäre, von seiner Gegenwart den besten Nutzen zu ziehen, da er kein Wort Deutsch spräche“. Die Wichtigkeit dieses mit dem geheimnisvollen Bau der Lokomotive vertrauten Manns drückte sich auch dadurch aus, daß er ein Gehalt von 2250 Mark bezog, während der Leiter der Bahngesellschaft selbst nur ein Einkommen von 1360 Mark hatte.
Bevor die Ludwigs-Eisenbahn eröffnet wurde, hatte der Vorstand der Gesellschaft noch Gelegenheit, der Einweihung der Strecke Brüssel-Mecheln beizuwohnen, wofür eine Einladung der belgischen Regierung nach Nürnberg gelangt war. Am 5. Mai 1835 begannen die Fahrten auf dieser Strecke, welche die erste Lokomotivbahn auf dem europäischen Festland war. Am 7. Dezember desselben Jahrs wurde dann die Linie Nürnberg-Fürth eröffnet.
Die Betriebsmittel waren zu Beginn eine Lokomotive und elf Pferde. Es herrschte auch durchaus der Pferdebetrieb vor; im ersten Jahr kamen auf je drei Lokomotivfahrten immer acht Pferdefahrten.
„Der Adler“, Lokomotive der ersten deutschen Eisenbahn
(erbaut in Stephensons Lokomotiv-Fabrik zu Newcastle)
Das Unternehmen entwickelte sich sogleich sehr günstig. In der Generalversammlung von 1836, also nach einjährigem Betrieb, konnte Scharrer die erfreuliche Mitteilung machen, daß von der Bahn 450 000 Personen befördert worden und 102 000 Mark eingenommen worden wären. Mit besonderer Freude betonte Scharrer, daß sich kein einziger Unfall ereignet hätte. Auch das Gleis liege ausgezeichnet, und es sei fast noch keine Schienenauswechslung notwendig gewesen. Stephensons Dampfwagen aber sei ein Meisterstück; er habe während des ganzen Jahrs mit Ausnahme eines einzigen Tags ununterbrochen im Betrieb gestanden. Scharrer fügte hinzu:
„Die Wirkung unserer Anstalt beschränkt sich nicht bloß auf die so wichtige Beförderung des Gewerbsverkehrs der zwei hierin so innig verwandten Städte; sie ist auch ein neues schönes Glied in der Kette des geselligen Lebens, ein erfreulicher Vereinigungspunkt aller Klassen und Stände, ein wohlfeiles Mittel des Vergnügens und der Erholung, eine Wohltat für die zahlreichen Boten und Lastenträger, welche ehedem in glühender Hitze oder Kälte auf den Wegen ihre Kräfte erschöpften und nun Gelegenheit haben, mit wenigen Kosten ihre Kräfte und Gesundheit zu schonen und einen reicheren Erwerb zu gewinnen.“
Die weitere Voraussage Scharrers, daß das Unternehmen alle Aussicht habe, sich günstig fortzuentwickeln, ist in Erfüllung gegangen. Keine Wirklichkeit geworden aber ist ein anderes kühnes Bild, das dem gern ins Hohe und Große aufsteigenden Geist dieses Manns vorschwebte. Er meinte, die Ludwigs-Eisenbahn werde dereinst ein Teil des Landverkehrswegs von England nach Ostindien sein, „weil sie einen Bestandteil der großen Kommunikationslinie bilde, welche den europäischen Kontinent von Westen nach Osten durchschneidet und an die Küsten Asiens führt“. Seltsamerweise ist vielmehr die Ludwigs-Eisenbahn bis zum heutigen Tag eine vereinsamte kleine Strecke geblieben. Sie hat niemals auch nur den Anschluß an das bayerische Eisenbahnnetz gefunden. Die große Schnellzugstrecke München-Nürnberg-Berlin, die auch Fürth berührt, hat sich einen neuen besonderen Schienenweg geschaffen. Die Ludwigs-Eisenbahngesellschaft besteht noch jetzt selbständig fort, und sie betreibt nach wie vor nichts weiter als die sechs Kilometer lange Strecke zwischen Nürnberg und Fürth.
Die Bedeutung, die erste Lokomotiveisenbahn in Deutschland gewesen zu sein, bleibt der kleinen Strecke trotzdem erhalten. Wie stark die Gemüter damals durch das Ereignis der Bahneröffnung bewegt wurden, zeigt am besten ein Bericht des „Stuttgarter Morgenblatts“, der hier, nach Vogtländers Quellenbüchern, wiedergegeben sei:
„Am 7. Dezember morgens um neun Uhr fand die feierliche Eröffnung der Ludwigs-Eisenbahn zwischen Nürnberg und Fürth auf dem eingehegten Platze statt, welcher zu dem Verwaltungslokal der Eisenbahngesellschaft gehört.
„Die freudigste und nicht zu erschöpfende Aufmerksamkeit widmete man dem Dampfwagen selbst, an welchem jeder so viel Ungewöhnliches, Rätselhaftes zu bemerken hat, den aber in seiner speziellen Struktur nach äußerem Ansehen selbst ein Kenner nicht zu enträtseln vermag.
„Auf den Achsen von Vorder- und Hinterrädern wie ein anderer Wagen ruhend, hat er mitten zwischen diesen zwei größere Räder, und diese sind es, welche von der Maschine eigentlich in Bewegung gesetzt werden (Die Treibräder). Wie? läßt sich zwar ahnen, aber nicht sehen.
„Zwischen den Vorderrädern erhebt sich, wie aus einem verschlossenen Rauchfang, eine Säule von ungefähr 15 Fuß Höhe, aus welcher der Dampf sich entladet. Zwischen den Vorder- und Mittelrädern erstreckt sich ein gewaltiger Zylinder nach den Hinterrädern, wo der Herd und Dampfkessel sich befindet, welcher von einem zweiten, vierrädrigen angehängten Wagen aus mit Wasser gespeist wird. Dieser hintere Wagen nämlich, auf welchem der Platz für das Brennmaterial ist, hat auch einen Wasserbehälter, aus welchem Schläuche das Wasser in die Kanäle des eigentlichen Dampfwagens leiten. Außerdem bemerkt man eine Anzahl von Röhren, Hähnen, Schrauben, Ventilen, Federn, die alle wahrzunehmen mehr Zeit erfordert, als uns vergönnt war.
„Überdies nahm das ruhige, umsichtige, Zutrauen erweckende Benehmen des englischen Wagenlenkers uns ebenso in Anspruch. Wer möchte in einem solchen Mann nicht den ganzen Unterschied der modernen und der alten, wie der mittleren Zeit personifiziert erblicken! Jedes körperliche Geschick, welches gleichwohl nicht fehlen darf, tritt bei ihm in den Hintergrund, in den Dienst der verständigen Beachtung auch des Kleinsten, als eines für das Ganze Wichtigen. Jede Schaufel Steinkohlen, die er nachlegte, brachte er mit Erwägung des rechten Maßes, des rechten Zeitpunktes, der gehörigen Verteilung auf den Herd. Keinen Augenblick müßig, auf alles achtend, die Minute berechnend, da er den Wagen in Bewegung zu setzen habe, erschien er als der regierende Geist der Maschine und der in ihr zu der ungeheuren Kraftwirkung vereinigten Elemente.
„Als der Dampf sich stark zu entwickeln begann, regnete es aus der sich augenblicklich bildenden Wolke durch die etwas rauhe Morgenluft auf uns herab; ja, der Gegensatz der glühenden Dämpfe und der Atmosphäre machte, daß zugleich ein Hagelstaub niederfiel.
„Als darauf auch der nach einer Heideloffschen Zeichnung gefertigte, sehr einfache Denkstein mit der einfachen Inschrift: „Deutschlands erste Eisenbahn mit Dampfkraft. 1835“ enthüllt war, wurde Sr. Maj. dem König ein Lebehoch gebracht. — Hierauf begann die erste Fahrt in den mit Fahnen geschmückten Wagen; ein Kanonenschuß verkündete den Abgang des ersten Zuges. Alle neun Wagen waren angefüllt und mochten etwa 200 Personen fassen.
„Der Wagenlenker ließ die Kraft des Dampfes nach und nach in Wirksamkeit treten. Aus dem Schlot fuhren nun die Dampfwolken in gewaltigen Stößen, die sich mit dem schnaubenden Ausatmen eines riesenhaften antediluvianischen Stieres vergleichen lassen. Die Wagen waren dicht aneinandergekettet und fingen an, sich langsam zu bewegen; bald aber wiederholten sich die Ausatmungen des Schlotes immer schneller, und die Wagen rollten dahin, daß sie in wenigen Augenblicken den Augen der Nachschauenden entschwunden waren. Auch die Dampfwolke, welche lange noch den Weg, den jene genommen, bezeichnete, sank immer tiefer, bis sie auf dem Boden zu ruhen schien; die erste Festfahrt war in neun Minuten vollendet, und somit eine Strecke von 20 000 Fuß (6 Kilometer) zurückgelegt.
„Die Fahrt wurde an diesem Tage noch zweimal wiederholt. Das zweitemal bin auch ich mitgefahren, und ich kann versichern, daß die Bewegung durchaus angenehm, ja wohltuend ist. Wer zum Schwindel geneigt ist, muß es freilich vermeiden, die vorüberfliegenden, nähergelegenen Gegenstände ins Auge zu fassen.
„Es war eine unvergeßliche Menschenmenge vorhanden, und sie jauchzte und jubelte zum Teil den Vorüberfahrenden zu; in der Tat, es gewährt der Anblick des vorüberdrängenden Wagenzuges fast ein größeres Vergnügen, als das Selbstfahren. Wenigstens drängt sich uns das Gefühl der gewaltigen, wundersam wirkenden Kraft bei jenem Anblick weit mehr auf; es imponiert, wenn man den Wagenzug mit seinen 200 Personen wie von selbst, wenn auch nicht pfeilgeschwind, doch gegen alle bisherige Erfahrung schnell, unaufhaltsam heran-, vorüber- und in die Ferne dringen sieht.
„Das Schnauben und Qualmen des ausgestoßenen Dampfes, der sich sogleich als Wolke in die Höhe zieht, verfehlt auch seine Wirkung nicht. Pferde auf der nahen Chaussee sind daher beim Herannahen des Ungetüms scheu geworden, Kinder haben zu weinen angefangen, und manche Menschen, die nicht alle zu den ungebildeten gerechnet werden dürfen, haben ein leises Beben nicht unterdrücken können. Ja, es möchte wohl keiner, der nicht völlig phantasielos ist, ganz ruhigen Gemütes und ohne Staunen beim ersten Anblick des wunderwürdigen Phänomens geblieben sein.“
Eröffnung der ersten deutschen Eisenbahnstrecke
Nürnberg-Fürth am 7. Dezember 1835
(Bürgermeister Binder bringt das Hoch aus, Direktor Scharrer spricht mit dem Regierungsvertreter, Regierungspräsidenten von Stichauer (in Uniform). Hinter ihnen der Erbauer der Strecke, Denis. Auf der Lokomotive der englische Führer Wilson)