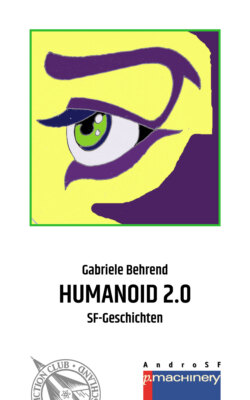Читать книгу HUMANOID 2.0 - Gabriele Behrend - Страница 7
Soft Skills, Hard Days
ОглавлениеIch schlafe. Ich wache. Ich träume. Ich bin. Einatmen, ausatmen – tief dringt der Duft des weed in meine Lunge, bringt Bilder mit sich; Bilder, die sich aus einem Nebel heraus klären, fokussieren. Mit nadelspitzen Stichen werden sie fieberhaft hinter meine Lider gestickt. Welten entstehen, greifbare Universen. Ich kann sie riechen, fühlen, schmecken. Meine Nerven summen, die Muskeln spannen sich an, mein ganzer Körper ist auf dem Sprung. Alles, was eben noch weich war, biegsam und sanft, wird hart und unnachgiebig. Ich suche nicht länger den Kompromiss, ich suche die Konfrontation.
Da sind Hände auf mir; zarte Hände, warme, weiche Hände; die Finger lang und schmal. Ich spüre sie, möchte sie packen, möchte mein Gesicht in ihnen vergraben, doch meine Arme sind festgebunden. Sie hat es getan, sie hat mich gefesselt, als es noch nicht nötig war. Als ich eben so weich und nachgiebig und reif war wie sie. Küss mich, denke ich. Schenke mir Erlösung. Doch sie streichelt nur; langsam und quälend. Hin und wieder lässt sie ihren Fingerspitzen freien Lauf, lässt sie verspielt tänzeln, Muster auf meine Haut zeichnen, die tief in mein Fleisch einsinken. Das Sehnen in mir wächst und wächst, es wird mich zerreißen, doch ich will nicht, dass sie aufhört.
Ich presse die Augen hinter der Seidenmaske zusammen. Es ist die Seidenmaske, die ich vor einer gefühlten Ewigkeit übergestreift habe; damals, als ich diesen Raum betrat; damals, als ich meine Kleider abgelegt habe, mich auf diesen Stuhl gesetzt habe, mit klopfendem Herzen und trockener Kehle. Die Zeitspanne im Niemandsland, zwischen meinen ersten wirren Erwartungen und ihrem Eintreten schärft alle Sinne, macht das innere Auge weit. Die Fantasie treibt ihre Blüten.
Kein Lichtstrahl der hiesigen Realität soll mich stören. Allein den Reizen ihrer Hände ausgesetzt, strecke ich mich fern von Zeit und Raum, werde groß und mächtig. Das Sehnen verleiht mir Beine, lange, gestreckte, kraftvolle Beine. Ich steige mutwillig auf die Hinterhand, lasse mich auf den Sandboden zurückfallen, scharre mit den Hufen und sprinte unvermittelt los. Laufen, Laufen, nur Laufen. Der Wind umgibt mich. Für einen Moment ist er Kamerad, doch nur einen Herzschlag später wird er zum Konkurrenten.
Ich strecke mich, spanne jeden Muskel dieses Körpers, der mir inzwischen so vertraut ist. Und schon bin ich dem Wind voraus. Eine Nasenlänge, zwei – ich laufe und laufe. Ihre Hände, diese unschuldigen, nachgiebigen Hände, begleiten mich, fordern mich, zwingen mich hinein in diese Raserei. Ich sehe den Horizont hinter der Klippe auftauchen, die ich entlang presche. Er kommt mit jedem Atemzug näher. Nach der Klippe folgt eine gähnende Leere, hintendran das Meer. Doch vorher viele Felsen, scharfkantig und gnadenlos. Aber ich habe keine Angst, die kenne ich hier nicht; nicht hier, nicht in meiner Welt. Mit einem Lachen werfe ich den Kopf zurück, stoße mich vom harten Boden ab, springe – hinauf, hinauf! Breite die Flügel aus, die mir gerade jetzt aus den Schultern brechen, wie Schneeglöckchen durch den schorfigen Firn.
Mit dem Wind unter den Schwingen brauche ich die Beine nicht mehr, ziehe sie wieder ein. Noch in der Hetze gefangen, schlage ich mit den Flügeln, hinauf, hinauf, der Sonne entgegen, solange bis ich ruhiger werde, Luft hole, mich treiben lasse auf den Strömen der Thermik. Aller Druck weicht von meinen Schultern. Mein Herz beruhigt sich allmählich, der Atem geht gleichmäßig und ruhig. Ich segle. Ich weine. In diesem Moment existiert der wahre Friede. Die Hände schweigen. Sie ruhen auf meinen Schultern, weißen Friedenstauben gleich, lassen mir Raum und Zeit im Überfluss. Diese Freiheit aber, je länger, je tiefer ich sie erfahre, schnürt mir Herz und Seele zu. Ich bin zu klein, um das hier wirklich zu begreifen. Und doch strecke ich mich gleichzeitig weit hinaus. Meine Schwingen werden raumgreifend. Ich möchte diese Welt umarmen, möchte sie an mein wundes Herz pressen und mich an ihrer Kühle laben.
Ich atme tief – ein, aus, ein, aus. Der Nebel lichtet sich etwas. Meine Augen wollen wieder klar sehen. Ich merke, wie die Spannung von ihnen abfällt. Ich kehre zurück, bin sicher gelandet hinter den Blindfolds.
Ich weiß, dass sie jetzt hinter mir steht. Ich spüre ihren warmen, weichen Körper, der sich unaufdringlich an meinen Rücken schmiegt. Ich möchte mich nach hinten fallen lassen, hinein in ihre Arme, möchte ihr erzählen, was ich erlebe, was ich empfinde, möchte wieder so weich werden wie sie. Doch wir werden uns nie näher sein als in diesem Moment, auch später nicht. Dieser kurze Moment, in dem sie hinter mir steht und ihre Brust sich im Gleichklang meines Herzens hebt und senkt.
Gerade als ich mich dem Rhythmus ihres Seins hingeben will, begeben sich ihre Hände wieder auf Wanderschaft, streichen an der Außenseite meiner Arme hinunter, streifen an der Innenseite wieder hinauf.
»Vertraust du?«, flüstert ihre Altstimme in meinem Kopf. »Kannst du das? Willst du das?«
Das wohlbekannte quälende Ziehen meldet sich wieder, diesmal direkt aus meinen Lenden.
»Vertraust du?«
Die Stimme zwingt zu einer Antwort, immer noch leise, doch hart wie Stahl. Die Fingerspitzen halten inne, bohren sich leicht in meinen Muskeln. Ihre Nägel dringen ein in meine Haut, die daraufhin schlagartig aushärtet, kristallisiert. Mich kann nichts verletzen, niemand wird mir ein Leid antun. Ich nicke.
Eine frische Wolke weed trifft meinen Geist mit voller Wucht. Ich ertrinke in der Dunkelheit, meine Lungen stehen kurz vor dem Zerbersten. Die Spannung steigt, potenziert sich, alles potenziert sich, alles wird möglich. Ich sterbe, ich kämpfe. Mir wird niemand ein Leid antun, das wird niemand wagen. Ich wüte, ich rase. Die Fesseln halten mich zurück, die Ketten klirren, die Welt ist schwarz um mich und rot und feuerstrahlend.
Allein bin ich jetzt, sie steht nicht mehr hinter mir. Stattdessen greifen Wirbel nach mir, ihre Hände, ihre schlanken, quälenden Hände spielen Fangen und Tauziehen mit meiner sterblichen Hülle. Die Reize kommen von überall, anschwellend, abschwellend in ihrer Stärke. Mein Körper schafft es nicht, sich daran zu gewöhnen. Die Nerven liegen blank, spielen verrückt, mein Hirn will explodieren, doch es geht nicht, es geht nicht, es will nie gehen. Für einen Moment werde ich schwach, will um Erlösung flehen, um Vergebung. Will nicht mehr kämpfen, will nicht mehr siegen. Doch sie lässt es nicht zu. Sie ist der Puppet-Master, sie weiß, an welchem Nervenstrang sie ziehen muss. Arme, Beine, Brust, Bauch – ich spüre sie auf einmal überall, spüre ihren Atem auf mir, ihr Haar, ihren Duft, der immer körperlicher wird, spüre ihre Lippen, ihre Zunge und immer, immer ihre Hände. Sie beherrscht die Klaviatur meines verräterischen Körpers, die empfindlichsten Stellen, die Untiefen und die Meeresgräben. Sie ist die Perlentaucherin und ich bin ihr Weidegrund. Und als sie schließlich mit beiden Händen zupackt, als sie den letzten unversehrten Nerv trifft, bäume ich mich auf. Wachse über meine Grenzen hinaus. Mein Geist erstrahlt in gleißendem Licht, ergießt sich in das Chaos, schlägt die Feinde nieder, die Namenlosen, und lässt mich schreiend triumphieren.
Die Wirbel ziehen sich zurück, die Schwärze vor meinem inneren Auge wird brüchig. Dort wo sie aufreißt, entsteht das Bild, das ich mir stets von ihr mache, machen muss, denn ich habe kein anderes. Für mich ist sie die inkarnierte Madonna, von Munch vorhergesehen und auf eine ahnungslose Leinwand gebannt.
Still steht sie da, lichtbekränzt, bereit zur Hingabe und Ekstase. Sie ist der Preis, die Belohnung. Was sind Tränen? Diesmal will ich nicht weinen. Es gibt nichts zu beweinen. Der Stuhl, auf dem ich bis eben noch ein hilfloses Wesen war, ihrem Wollen ausgeliefert, dient mir jetzt als Thron.
Mit einem leisen Klirren fallen die Fesseln zu Boden, die mich bislang zurückgehalten haben. Sie nimmt meine Hände und birgt ihr Gesicht darin. Sie führt mich die wenigen Schritte bis zum Bett, lässt sich auf die Laken sinken und zieht mich mit sich. Ruhig bin ich geworden, ruhig aber unnachgiebig. Und so nehme ich mir, was des Siegers ist, beschlafe diese Frau, wie es schon immer Brauch war. Es geht nicht mehr um Befriedigung – die habe ich vorher umfassend erfahren. Das hier ist einzig die Demonstration meiner Kraft.
Ich bin nicht mehr die Frau, die ich zu Beginn dieses Intermezzos war. Ich bin Herrscher. Ich bin Mann, in allem Tun und Denken. Systematisch erkunde ich ihren Körper, ihre Haut, sauge ihren Duft in mich ein, erforsche ihre dunkle, triefende Höhle. Widerstand? Gibt es nicht! Und wenn schon – es hätte keinen Sinn. Sie bäumt sich unter meinen Händen auf, ihr Schoß zuckt und krampft, und die Musik ihrer Ekstase wird zu meinem Wiegenlied …
… das zurückhaltende Zirpen des Filotops auf dem Nachttisch bahnt sich seinen Weg durch die weedgeschwängerten Nachbilder. Einen Moment lang lausche ich ihm mit geschlossenen Augen, dann streife ich widerwillig die Seidenmaske ab und richte den Blick zur Decke. Über mir kann ich direkt ins helle, leichte Blau eines Frühlingstages sehen, so wie ich es zu jeder Jahres-, Tages- oder Nachtzeit tun könnte.
Das Filotop zirpt weiter. Es wird unermüdlich so weitermachen, bis ich – und nur ich – meine Hand auf sein Display lege, um ihm sein digitales Mundwerk zu verschließen.
Der Platz neben mir ist leer, wie immer. Für einen Moment bereue ich es, doch dann erinnere ich mich an das, was ich gespürt, erlebt, getan habe – und bin froh über die Einsamkeit.
Ich hebe die Hand, betrachte meine Finger, die nicht die ihren sind, schließe noch einmal die Augen und atme tief den Duft ein, der meiner Haut anhaftet, ihren Duft. Ich küsse meine Fingerspitzen, die kurz zuvor noch ihr Innerstes erforscht und in Besitz genommen haben, und es ist mir, als würde ich sie küssen. Ich weiß letztlich nicht, ob meine Hände ihr soviel Vergnügen bereiten, wie es umgekehrt der Fall ist. Auf der anderen Seite ist es auch gar nicht mein Job. Sie ist die Socialista, nicht ich. Ich bin nur eine Frau in diesem alltäglichen Haifischbecken, die gleich in einem wichtigen Meeting bestehen muss, und sich vorher die Stärke geholt hat, die sie dafür braucht.
Sauber, diskret, auf Kostenstelle.
Mit einem Seufzen erhebe ich mich, lasse die Seidenlaken hinter mir und ziehe mich wieder an. Bringe das Filotop endlich zum Schweigen, das seine Zurückhaltung inzwischen verloren hat. Richte mich mit ein paar Handgriffen her, verweigere den Blick in den Spiegel – ich weiß, wie ich nach einer solchen Sitzung aussehe, weiß, wie sich wahre Größe in meiner Ausstrahlung ausdrückt – und schlendere zur Tür. Lege meine Hand auf das biometrische Abrechnungsfeld, zögere nicht, den Extra-Obolus zu berechnen. Die Stimme des allgemeinen OMS bedankt sich höflich-neutral.
Am Anfang hatte es mich irritiert, dass man kein Bild von ihr zu Gesicht bekam, nicht mit ihr sprechen konnte, noch nicht einmal per Mono-Sprachleitung – aber inzwischen habe ich den Grund verstanden. So wie wir Mitarbeiter vor ihr geschützt werden, vor einer persönlichen Beziehung, einer emotionalen Abhängigkeit, so wird auch sie vor uns geschützt. Das ist nur fair. Schließlich bleibt unsere Socialista nicht mehr als eine gesichtslose Berufsbezeichnung.
Woher bezieht sie ihre Stärke?, frage ich mich für einen Moment. Wer gibt ihr Kraft? Wer …?
»Ihr Meeting beginnt in fünf Minuten, das Office Shuttle steht bereit.« Das OMS tönt zwischen meine Gedanken. Erinnert mich an die anstehende Aufgabe, erregt meinen Unmut.
Die weiße Flamme meines Geistes lodert auf. Ein, zwei Herzschläge lasse ich das Licht durch meine Adern kreisen. Trete dann in den Flur hinaus.
Ich bin bereit.