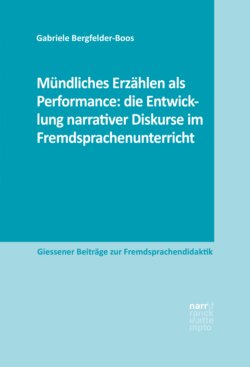Читать книгу Mündliches Erzählen als Performance: die Entwicklung narrativer Diskurse im Fremdsprachenunterricht - Gabriele Bergfelder-Boos - Страница 35
3.5.3 Modellierungsmöglichkeiten konzeptioneller Mündlichkeit
ОглавлениеDie konzeptionelle Mündlichkeit eines Textes bzw. Diskurses übernimmt in der werkinternen Kommunikation die Rolle eines Gegenpols zur konzeptionellen Schriftlichkeit. Beide Prinzipien bilden ein Spannungsfeld, zwischen dem sich der Text bzw. Diskurs bewegt, wobei die konzeptionelle Schriftlichkeit1 das Prinzip kommunikativer Distanz, die konzeptionelle Mündlichkeit das Prinzip kommunikativer Nähe darstellt. Zur begrifflichen Unterscheidung zwischen konzeptioneller Schriftlichkeit und konzeptioneller Mündlichkeit als Gegensatzpaar zur medialen Schriftlichkeit / Mündlichkeit stütze ich mich im Wesentlichen auf die Ergebnisse der Oralitätsforschung von Koch / Oesterreicher (1985) und des Freiburger Sonderforschungsbereichs „Übergänge und Spannungsfelder zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit“ (Raible 1988b, 1991b, 1991c). Zur präzisen Erarbeitung der Kategorien für die funktionale Analyse des mündlich-fiktionalen Erzähldiskurses (Kap. 3.6) verbinde ich die in der Oralitätsforschung gewonnenen Gestaltungsprinzipien von Texten bzw. Diskursen mit denen der intermedialen Narrativik.
Für eine Übertragung der Prinzipien konzeptioneller Schriftlichkeit und Mündlichkeit auf text- bzw. diskursgenerierenden Prinzipien narrativer Werke bieten sich Erzählmodus und Erzählhaltung an – darin insbesondere die Merkmale telling vs. showing (Antor 2004: 115), Situationsentbundenheit vs. Situationsverschränkung, Strukturiertheit vs. Vorläufigkeit, (Koch / Oesterreicher 1985: 23), Entspanntheit vs. Gespanntheit der Sprecherhaltung (Weinrich 2001: 47-53) – ferner Strukturprinzipien wie z.B. die syntaktischen Narreme sowie besondere Versprachlichungsstrategien der Textoberfläche. Da im Zusammenhang der Studie überwiegend von einem mündlichen narrativen Werk ausgegangen wird, werde ich zur Bezeichnung der Gegenpole statt ‚konzeptioneller Schriftlichkeit vs. konzeptioneller Mündlichkeit‘ die Begriffe konzeptionelle Distanz vs. konzeptionelle Nähe (Koch / Oesterreicher 1985: 21) verwenden.
Während bei der Medialität der Mündlichkeit ein Entweder – Oder (Raible 1991b: 7) vorliegt, d.h. die narrative Präsentationsform entweder mündlich oder schriftlich erfolgt, ist die konzeptionelle Mündlichkeit graduierbar. Die Bezugnahme eines Textes bzw. Diskurses auf die mediale Mündlichkeit lässt sich demzufolge auf einem Skalar zwischen den Polen konzeptioneller Distanz und konzeptioneller Nähe positionieren. Die Regulierung des Verhältnisses zwischen konzeptioneller Nähe und konzeptioneller Distanz fasse ich als Modellierung der diskursinternen, konstruierten, konzeptionellen Mündlichkeit. Die Modellierung erfolgt mithilfe narrativer Verfahren, die sich den Merkmalen narrativer Texte bzw. Diskurse zuordnen lassen. Sie stehen dem schriftlichen Text wie auch dem mündlichen Diskurs zur Verfügung, werden jedoch unterschiedlich, im Hinblick auf das ‚Bedienen‘ des jeweils intendierten Rezeptionsmodus genutzt.
Die Bezugnahme narrativer Werke auf die Mündlichkeit kann in zwei „Großformen“ (Bergfelder-Boos /Bergfelder 2015: 11-13) realisiert werden2. Die erste Großform (A) setzt vor allem auf den „Schein mündlichen Kommunizierens“ (Ewers 1991b: 106) durch Illusionsbildung. Dafür stehen narrative Verfahren zur Verfügung, die an charakteristische Merkmale alltäglicher mündlicher Kommunikation anknüpfen bzw. sie fingieren, weshalb diese Verfahren auch als ‚fingierte Mündlichkeit‘ (Koch / Oesterreicher 1985: 24, Anm. 23, Müller-Oberhäuser 2004a: 475) bezeichnet werden. Als zweite Großform (B) stehen gattungstypologische Verfahren diverser Textgenres (wie z.B. die des Märchens, der Legende, aber auch der Novelle und des Romans) und der Rekurs auf poetische Verfahren vergangener oder aktueller poésie orale zur Verfügung (Zumthor 1983: 47, 62).
Die folgende Übersicht (Abb. 3) listet, aufgeteilt in die Großformen A und B, Ansatzpunkte zur Modellierung konzeptioneller Mündlichkeit auf:
Abb. 3:
Ansatzpunkte zur Modellierung konzeptioneller Mündlichkeit
Für die Großform A sind fünf Merkmale der Tiefen- und Oberflächenstruktur des narrativen Diskurses aufgeführt. Den Merkmalen werden unter der Rubrik Distanz-Prinzip und Nähe-Prinzip die Gestaltungsprinzipien der Merkmale zugeordnet3. Die mittlere Position (ausgeglichen) wird angezeigt, aber nicht begrifflich ausdifferenziert. Die Möglichkeiten der Modellierung konzeptioneller Mündlichkeit werden im Folgenden anhand der in der Übersicht aufgelisteten Gestaltungsprinzipien vorgestellt.