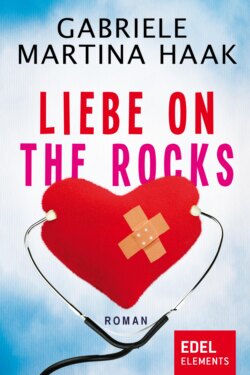Читать книгу Liebe on the rocks - Gabriele Martina Haak - Страница 4
Kapitel 2
ОглавлениеDen Morgen danach würde Sophie bis an ihr Lebensende nicht vergessen. Wie eine Steinstatue lag sie im Bett und wartete darauf, daß Felix hereinstürmen, sich aufs Bett werfen und seine geistige Verwirrung vom Vorabend unter langen Küssen ungeschehen machen würde. Bis ihr einfiel, daß ihr Wohnungsschlüssel, also eigentlich seiner, irgendwo unter dem Bett liegen mußte, dort, wo er ihn im Eifer des Gefechts hingepfeffert hatte. Als diese Erkenntnis Sophies Hirnwindungen durchdrang, sprang sie auf und rannte ins Bad.
Hier waberte, erkaltet, die mit Rosenöl getränkte Brühe in der Wanne. Zitternd saß die vierunddreißigjährige Karrierefrau auf dem Klodeckel und starrte in die kleinen Öltröpfchen. Sollte sie, Sophie Lackmann, sich so sehr in einem Menschen getäuscht haben? Besaß sie nicht einen Funken Menschenkenntnis? Hatte Felix denn immer nur gelogen, wenn er über ein gemeinsames Kind sprach? Seine Frau, das hatte er doch immer betont, wollte keine Kinder, und die Trennung war nur eine Frage der Zeit. Hatte sie, die durchaus selbstsichere Sophie mit der exzellenten Ausbildung und den rosigen Zukunftsaussichten, sich so sehr blenden lassen? War sie etwa zwei Jahre lang die willige Gespielin des Herrn Professors gewesen?
»Nein, so kann es nicht sein. Das ist doch echte Liebe. Felix wird sicher bald anrufen, und alles wird wieder gut«, versuchte sie sich selbst mit fester Stimme einzureden. Vielleicht fühlte er sich nur überrumpelt. Vielleicht hatte sie einfach den falschen Tag erwischt, war zu dominant mit ihren Tacos und dem sprungreifen Ei dahergekommen? »Beruhige dich, Mädchen, atme tief durch, es wird sich klären«, riet sie sich selbst.
So ähnlich mußte sich auch Vivien Leigh aus ›Vom Winde verweht‹ gefühlt haben. Als Scarlett stand sie vor den Trümmern ihres Zuhauses, vor den Scherben ihrer Ehe mit Rhett Buttler und behauptete dennoch trotzig: »Morgen wird mir schon einfallen, wie ich ihn mir wieder erobere. Schließlich, morgen ist auch ein Tag.«
Nicht daß sich Sophie eingestehen wollte, daß sie mit Männern immer Pech hatte, aber ihre Gedanken drifteten an diesem Morgen gefährlich in die Nähe von Selbstmitleid und Weltuntergangsstimmung. Vielleicht waren ihre Ansprüche nur zu hoch, vielleicht wollte sie nur mehr, als solch ein Y-Chromosom überhaupt in der Lage war zu geben. Auf dem männerspezifischen Y-Chromosom waren soundso nur wenige rudimentäre genetische Informationen. Das hatten Forscher erst kürzlich zweifelsfrei festgestellt. Nur die Bildung der Hoden, die Reifung der Spermien und zum Teil die Körpergröße schienen von Genen des Y-Chromosoms gesteuert zu werden. Genetisch gesehen, keine Glanzleistung. Eine Art Krüppel-Chromosom, hatten Feministinnen in den diversen Fachzeitschriften genüßlich kommentiert. An diesem Morgen fand Sophie, daß sie allesamt recht hatten. Wie konnte ein Mann etwas sagen und etwas anderes meinen, und wie konnte eine Frau, die nicht auf den Kopf gefallen war, darauf hereinfallen?
Bei den meisten Beziehungen war Sophie spätestens nach einem halben Jahr klar, daß die Verbindung endlich sein würde. Wenn es sie morgens schon nervte, wie der augenblickliche Herzallerliebste sein Ei köpfte, dann wußte sie – und wenn sie ehrlich drauf war, konnte sie es sich sogar eingestehen –, daß es nicht mehr lange gutgehen würde. Die besten Rezepte, um sich von einem Freund zu trennen, hatte Sophie alle ausprobiert. Es gab mehrere Möglichkeiten, das Ende einer Liebe zu beschleunigen. Das war ihr schon seit Jahren klar.
1. À la Rosenkrieg: Wenn schon Ende, dann wenigstens Genugtuung bis zur bitteren Neige.
2. Die ehrliche Aussprache: Das ging nur zu Beginn, wenn man schonungslos jede Veränderung der Gefühlslage benannte und nichts verschwieg.
3. So weitermachen wie bisher: Auf den Glücksfall hoffen, daß sich vielleicht der andere entfernte – die Variante für Feiglinge.
4. Die Verzweifelte spielen: »Ich kann nicht mehr, bitte versteh mich.« Depressive Züge entwickeln und unausstehlich werden. Der Nachteil: Das kostete Kraft und dauerte lange.
5. Die Rambo-Nummer: Man ließ sich absichtlich beim Seitensprung erwischen und brauchte nicht mehr viel zu erklären.
6. Die Keine-Leiche-im-Keller-Nummer: Trennung langsam und behutsam, aber deutlich vorbereiten. Nachteil: Das konnte Monate dauern.
Sophie hatte alle Varianten getestet und war zu guter Letzt immer bei Nummer 6 geblieben. Erfahrung, was zu tun war, wenn Männer sich von ihr trennen wollten, konnte sie allerdings nicht vorweisen. Normalerweise reagierte sie sensibler und kündigte die Beziehung auf, ehe es der Liebhaber vielleicht Monate später getan hätte. Bei Felix hatten sie ihre Instinkte verlassen, wobei ja eigentlich nicht gesagt war, daß er sie verlassen hatte. Seine letzten Worte waren gewesen: »Mich erpreßt man nicht.« Was ja soviel heißen mußte, daß die Liebesbeziehung durchaus wieder einzurenken wäre, wenn Sophie reumütig die Baby-Idee zurückziehen würde. Wäre dann nicht wieder alles beim alten?
»Mensch, Sophie, Felix ist der tollste Mann, der dir je über den Weg gelaufen ist, er liebt dich, er bietet dir sexuell und intellektuell genau das, was du brauchst. Reiß dich zusammen und warte einfach noch ein Jahr mit dem Baby. Wer weiß, wie sich die Dinge dann entwickelt haben«, so redete sie auf sich selbst ein und bekam langsam einen klareren Kopf. Warum sollte eine Frau wie sie, einigermaßen attraktiv, intelligent, loyal, warmherzig und sexy, sich die Seele aus dem Leib heulen?
»Gut, ich rufe ihn an, übermorgen vielleicht. Immerhin soll er wissen, daß man mit mir nicht beliebig umspringen kann.«
Doch was wäre zu tun, wenn er, derart schockiert, gar nicht mehr wollte? Nach den vielen Möglichkeiten, wie man sich trennen konnte, wenn man sich trennen wollte, fielen ihr auf die Schnelle nur drei praktikable Varianten ein, was zu tun war, wenn man ›getrennt wurde‹:
1. Fatal attraction: nicht aufgeben und kämpfen.
2. Vogel Strauß: weg und vergessen.
3. Subtile Demontage: den anderen schlecht reden, schlecht denken und am Ende auch schlecht finden. Das hieße: Sie müßte ihr inneres Bild von Herrn Professor Felix Northeim neu einfärben, von rosarot in giftgrün.
Sophie entschied sich am Mittwoch morgen, nachdem sie im Büro angerufen hatte, daß erst mittags mit ihrem Erscheinen zu rechnen sei, für den dritten Ansatz. Der Tag verging wie in Trance – Felix rief nicht an, wie einen ja sowieso nie jemand anrief, wenn man es sich wünschte – und abends sah sie sich ihr gemeinsames Album an. Das war sonst der Trost einsamer Sonntagnachmittage gewesen. Jeder Tag und jede Nacht waren in diesem Tagebuch der Liebe dokumentiert. Datum, einige Bemerkungen, ein Weinetikett, eine Hotelrechnung, ein Foto – Erinnerungen aus einer anderen Welt.
Sophie hatte wenig Übung in Demontage, und deshalb waren ihre ersten Versuche auch eher täppisch. Lächelte er hier vor dem Hotel in Florenz nicht sehr selbstgefällig? Und da: Bevor sie im ›Spago‹ in Beverly Hills gegessen hatten – die Rechnung belief sich auf gut dreihundert Dollar – mußte sie da nicht zwanzig Minuten im Bad warten, bis er mit seiner Frau telefoniert hatte? Hier mußte er einen Tag früher aus München zurückfliegen, weil der Vater seiner Frau gestorben war.
Aber Felix Northeim widerstand der Demontage energisch. Sie liebte ihn einfach viel zu sehr. Dann klingelte das Telefon.
»Hallo Süße, bist du okay?«
»Nein.«
»Soll ich vorbeikommen, ich hätte ein halbe Stunde Zeit.«
»Ja.«
Sophie flitzte ins Bad, schmiß sich in den engen roten Hausanzug, räumte die Küche auf, stellte den Champagner ins Eisfach, zündete die Kerzen an, packte das Album weg und legte seinen – also ihren – Schlüssel auf den Tisch und wartete.
Felix nahm sie in die Arme, hielt sie ganz fest. Er hatte Tränen in den Augen. Sie hatte sich also doch nicht getäuscht.
»Meine Geliebte, du ahnst nicht, wie sehr ich dich liebe, dich begehre, dich brauche. Ich kann ohne dich gar nicht leben.«
Sie hatte doch gewußt, daß der gestrige Abend nur ein böser Traum gewesen war. Felix und Sophie saßen auf der blaugemusterten Ralph-Lauren-Bettdecke. Er hielt ihre Hand und drehte langsam an dem Ring, den er ihr zum Geburtstag im August geschenkt hatte. Ein kleines Herz aus Gold. Felix redete mit einer Stimme, so weich und sexy, mit absolutem Schmelztimbre, daß Sophie den Inhalt seiner Sätze erst allmählich begriff.
»Schatz, ein Kind ist undenkbar. Du bist neun Monate schwanger, womöglich ist dir Sex plötzlich nicht mehr so wichtig. Du wirst dich schrecklich unförmig fühlen, und dann die Geburt, glaub mir, ich weiß, wovon ich spreche, das ist eine Tortur. Ich erlebe das jeden Tag in der Klinik. Es gibt Frauen, die hassen ihre Männer dafür, was sie ihnen angetan haben. Das ist doch kein Zuckerschlecken.« Felix sprach sanft und leise, aber nichtsdestotrotz eindringlich auf Sophie ein.
Sophie sagte keinen Ton. Ihr rechter Zeigefinger zeichnete wie in Zeitlupe das Muster der Decke nach. Felix streichelte über ihre Haare und sprach weiter.
»Allein diese Verantwortung. Das kann man doch nicht überstürzen, vielleicht später. Außerdem kann ich das meiner Frau jetzt unmöglich antun. Sie plagt sich mit einer verschleppten Bronchitis herum und muß sich schonen. Das mußt du verstehen. Jetzt kann ich mich nicht trennen; du mußt mir Zeit lassen. Außerdem habe ich gerade solch einen Ärger. Sie wollen mir in der Klinik einen zweiten Chefarzt, der vor allem die Geburtshilfe übernehmen soll, an die Seite stellen, stell dir das mal vor – das kostet mich im Moment einfach zuviel Kraft, später, ja vielleicht, später.« Seine Stimme hatte einen bittenden, ja flehenden Unterton bekommen. Er klang so verzweifelt, so schutzbedürftig.
Ihr Herz flüsterte ›ja, du hast recht, mein Geliebter‹; ihr Verstand schrie ›welch schäbige Hinhaltetaktik‹. Sie ließ ihn sich weiter um Kopf und Kragen reden und schaute Felix in die blaßgrünen Augen, und irgendwie war nichts mehr so, wie es einmal gewesen war.
Wie beginnt doch der Film ›Jenseits von Afrika‹ so wehmütig: ›Ich hatte eine Farm in Afrika. Am Fuße der Ngong-Berge.‹ Genauso zart und memorabel, dachte Sophie plötzlich, könnte doch meine Geschichte beginnen: ›Ich liebte einen verheirateten Mann. Und habe fest an die Zukunft geglaubt. Wir hatten zwei wundersame Jahre, so intensiv und unwirklich, daß wir wohl beide an unsere Zukunft geglaubt haben. Es war eine Illusion von unendlicher Freundschaft und Hingabe.‹ Diese Gedanken ließen sie nicht mehr los.
Ihre Freundinnen hatten sie ja gewarnt: ›Es wird bei dir genauso enden, wie es in 99 Prozent der Fälle endet! Er wird sich nie von seiner Frau trennen!‹ Sophie hatte dagegen geglaubt, daß sich am Ende ihre Geduld auszahlen würde. Doch sie hatte eindeutig einen Fehler gemacht. Am Ende siegte wohl immer nur der Schmerz.
»Ich bin die Leiche im Keller«, murmelte sie vor sich hin, als Felix ein Argument nach dem anderen darlegte. Und irgendwie wurde er erst still, als sie seinen Reißverschluß langsam öffnete. Es wurde die verzweifeltste gierigste Nacht dieser großen Liebe, wohl weil ihr klar war, daß es die letzte sein würde. Schweigend öffnete Sophie die Kondompackung. Sie würde diesen Mann ewig lieben, aber ihr Leben wollte sie ihm nicht opfern. Nach wenigen Jahren wäre aus der klugen und hübschen Sophie Lackmann doch eine verbitterte Alt-Geliebte geworden. Nein, dann wollte sie lieber jetzt mit vierunddreißig als mit zweiundvierzig leiden.
Sophie verabschiedete Felix erst um zwei Uhr nachts mit einem langen Kuß, lag bis fünf Uhr wach und beschloß dann, eine sündhaft teure Creme auf die verquollenen Augen aufzutragen, um für den nächsten Tag das Schlimmste zu verhindern.
Im Büro stand die monatliche Konzeptionsbesprechung an, und das hieß am Donnerstag morgen: »Frau Lackmann, bitte berichten Sie über die Aktivitäten im letzten Monat und die anstehenden Projekte.«
Eine Stunde referierte sie im Alleingang. Die, die sie gut kannten, merkten vielleicht, daß nicht alles in Ordnung war, aber ihr Chef David Parker ließ sich leicht täuschen. Er besaß nicht für fünf Pfennige Gespür für Menschen. Seinen grauen Augen entging eigentlich immer alles, was wichtig war. Dafür paßten sie hervorragend zu seinen grauen Anzügen und den leicht blau getönten Hemden, die er immer trug. Ein Mensch, verwechselbar und unspezifisch wie eine graue Maus. Er war nicht gerade unansehnlich mit seinen einundvierzig Jahren – Tante Billie würde sagen, ›den schubst man nicht von der Bettkante‹ –, aber Leidenschaft war für Parker ein Fremdwort. In jeder Beziehung. Er verströmte ein Art Fürst-Pückler-Charme, immer halb gefroren.
Nur Bodo lud sie nach der Konzeptionsbesprechung auf einen Kaffee in die Firmen-Luxuskantine ein und fragte unvermittelt: »Irgendwas schiefgelaufen?«
»Schief ist gut, Bodo, meine ganze Lebensplanung wurde in den letzten zwei Tagen über den Haufen geschmissen. Ich sollte jetzt eigentlich schwanger sein und langsam anfangen, saure Gurken zu essen.«
»Hähh, was soll das denn? Etwa von Felix? Der ist doch immer noch verheiratet!«
»Ach, vergiß es«, seufzte Sophie.
»Ich wußte nicht, daß du ein Kind willst«, hakte Bodo erstaunt nach und nahm ihre Hand. Bodo war der hauseigene Patentanwalt bei Gene Dream, neunundreißig, gepflegt, höflich und ein enger Vertrauter von Sophie. Mit ihm konnte sie über fast alles reden.
»Doch, von Felix, nur von Felix«, schluchzte Sophie.
Bodo war so ziemlich der einzige, bis auf ihre Freundinnen Annette und Sabine natürlich und Tante Billie, der etwas von ihrem Verhältnis wußte. Aber auch er konnte jetzt wahrscheinlich nur ahnen, was Felix ihr bedeutete.
»Sophie, ich habe dich vor ewigen Zeiten beschworen, es zu genießen und sonst nichts, keine Hoffnungen, keine Perspektive«, redete ihr Freund Bodo zuckersüß auf sie ein.
»Ich kann nicht anders«, war die einsilbige Antwort. Und da sie ansonsten wohl selten solch ein entwaffnendes Argument ins Feld führte, schwieg Bodo. Aber natürlich machte er sich so seine Gedanken. Er hatte die Affäre zwischen Northeim und Sophie immer für einen Fehler gehalten. Erstens redete die ganze Firma darüber, was Sophie Gott sei Dank nicht mitbekam, und zweitens war das seiner Meinung nach ein ungleiches Spiel. Der stadtbekannte Professor, eine Koryphäe auf seinem Fachgebiet, allem Anschein nach halbwegs glücklich verheiratet, mit gesellschaftlichen Verpflichtungen, hielt sich in der Stadt eine Geliebte.
Bodo mochte Sophie wirklich, und wenn er nicht schwul wäre, hätte er sich für die nette Pressesprecherin durchaus näher interessieren können, aber Sophie war einfach naiv. Sie hatte so gar keinen Hang zu Intrigen und Ränkespielen, und manchmal schätzte sie Menschen nicht richtig ein, sah immer nur das Gute. Es wurde wahrscheinlich Zeit, daß sie die rauhe Wirklichkeit akzeptierte. Sicher, Felix Northeim war ein toller Typ, aber eben eine Klasse zu groß für eine Sophie Lackmann, die trotz Studium und Auslandsaufenthalt doch immer das nette Mädchen aus Duisburg geblieben war. Der Kelch mit negativen Erfahrungen und Enttäuschungen war bisher an ihr vorübergegangen. Damit war jetzt wohl Schluß. Jetzt hatte es Sophie erwischt.
Nach drei langen Minuten meinte Bodo: »Dann mußt du dein Leben eben ohne ihn leben. Aber lebe dein Leben. Wenn du ein Kind willst, dann laß dir halt eins machen.«
»So kompromißlos können nur Schwule daherreden, die jahrelang ihre homosexuelle Veranlagung vor den Eltern, Schulkameraden, und Arbeitskollegen geheimgehalten haben«, giftete Sophie los. »Dann laß dir halt eins machen«, äffte sie ihn nach, »Mensch Bodo, bist du so naiv oder tust du nur so?« Sophie verdrehte die Augen. Bodo war für sie so ziemlich der angenehmste und vertrauenwürdigste Mann, den sie sich vorstellen konnte, was Tante Billie, nachdem sie Bodo zum erstenmal gesehen hatte, zu der Bemerkung verleitete, ›nur schwule Männer sind gute Männer‹. Aber manchmal verstand er Frauen eben doch nicht.
»Ja, sicher will ich ein Kind, aber nicht irgendein Kind, sondern ein Kind von Felix! Geht das in deinen schwulen Schädel rein?!«
Bodo drehte sich erschrocken um. Wenn Sophie weiterhin so laut schrie, hätte sie auch eine Anzeige im ›Kurier‹ aufgeben können. Sophie verlor anscheinend völlig die Nerven.
»Überleg doch mal, ob du ihn damit nicht zwingen willst, seine Frau zu verlassen und zu dir zu ziehen«, zischte Bodo, »oder willst du dir nur deine einsamen Wochenenden erträglicher machen?«
»Spinnst du, ich liebe Felix.«
»Traumprinzessin«, war Bodos einziger Kommentar, »wenn du ein Kind willst, dann mach es dir doch selbst. Kein Mann ist es wert, an ihm zu verzweifeln.«
Schweigen. Beide sagten nichts und nippten stumm an dem kalten Kaffee.
»Die Uhr tickt, Bodo. Was soll ich nur tun? Wie viele Jahre bleiben mir denn noch? Wie lange soll ich jetzt warten, ehe ich wieder einen Mann kennenlerne, mit dem ich mir ein Kind vorstellen kann und er sich eins mit mir?« Sophies Stimme klang immer verzweifelter und mutloser. Bodo hatte den wunden Punkt erwischt.
»Immer mit der Ruhe, Sophie, ich geb dir einen Rat. Überleg, was du wirklich willst, nur du!«
»Bodo, was soll ich denn wollen? Ich bin vierunddreißig, vielleicht habe ich Glück und ich lerne einen Traumvater mit fünfunddreißig kennen. Ein Jahr Zeit muß man sich ja gönnen, um den anderen kennenzulernen. Einmal alle Jahreszeiten miteinander erleben, einmal zusammen skifahren gehen, Silvester feiern, im depressiven Herbstwetter spazierengehen oder mit dem Rucksack durch Südamerika trampen.« Ihre Augen füllten sich schon wieder mit Tränen.
»Sind das deine entscheidenden Tests?« Bodo bemühte sich krampfhaft um einen sachlichen Ton. Auf solch eine Grundsatzdiskussion war er nicht vorbereitet.
»Ja, klar.« Sophie kramte verstohlen nach einem Taschentuch. Was konnte Bodo schon über die Eignungen für einen Mann fürs Leben wissen?
»Kann er meine schlechte Laune ertragen, wenn ich meine Periode bekomme? Bleibt der Sex auch nach einem Jahr noch aufregend? Das muß man doch wissen, wenn man ein Kind zusammen großziehen will. Ein Jahr ist das Minimum an Feuertaufe, um überhaupt an ein Kind zu denken, Bodo, verstehst du das nicht. Außerdem kann man wohl schlecht am ersten Abend mit der Tür ins Haus fallen. Dann wäre ich sechsunddreißig. Nehmen wir an, es dauert dann ein knappes Jahr, ehe es überhaupt klappt, dann wäre ich siebenunddreißig. Und mein süßes Baby würde ich dann erst mit bald achtunddreißig in den Armen halten. Das sind noch vier Jahre. Das ertrage ich nicht, niemals, Bodo, niemals.« Sophie stützte ihr Gesicht in die rechte Hand.
»Man erträgt viel, Sophie.«
Mit solchen Allgemeinplätzen konnte die Lackmann, wie man Sophie im Büro oft hinter ihrem Rücken nannte, normalerweise nichts anfangen, aber heute, tat es einfach nur gut, einem Menschen alles zu erzählen. Ihre Stimmung war auf dem Tiefpunkt angelangt.
»Wäre ich nur als Mann auf die Welt gekommen, Bodo. Glaub mir, du hast es gut. Mir wäre die Sehnsucht nach einem Kind erspart geblieben. Ich könnte, wenn ich sie denn doch hätte, täglich versuchen, eine andere zu schwängern. Ich würde ein paar hundert Mark im Monat zahlen und könnte sonntags mein Kind abholen und mit ihm in den Zoo gehen. Meinen Job müßte ich nicht aufgeben, schließlich lebt man als Vater munter so weiter wie bisher, nur mit der Bereicherung, daß sich irgendwo eine Frau tagein, tagaus um den Nachwuchs kümmert. Ich dagegen habe ein Scheißleben als Frau mit Mitte Dreißig.«
Bodo starrte Sophie einigermaßen verständnislos an. So hatte er die Sache noch nie gesehen.
Als Sophie an diesem Abend nach Hause kam, war ihr klar, daß wieder einmal ihr preisgünstiger Psychotherapeut würde herhalten müssen, um ein wenig Ordnung zu schaffen. Vielleicht hatte Bodo recht, sie mußte die Gedanken an Felix ausschalten und in sich, nur in sich selbst, hineinhorchen. In solchen Situationen schrieb Sophie immer in ihr Tagebuch. Leider überkam sie das Bedürfnis nur, wenn sie derangiert war, aus dem Gleichgewicht. Deshalb las sich das Tagebuch auch wie eine Ansammlung von Trauer, Wut, Zynismus und Weltschmerz, als sei ihr Leben das elendigste auf Erden.
In schwierigen Zeiten hörte Sophie immer gerne Tom Waits. Der war so wunderbar traurig und machte trotzdem nicht depressiv. Wie der das mit seiner völlig versoffenen Stimme hinbekam, war ihr zwar ein Rätsel, aber es wirkte immer. Zwar hatte sie bereits einige Trennungen hinter sich, wenn auch bislang immer selbst eingeleitete, aber das bedeutete ja nicht, daß sie diese leere Wohnung, diese plötzliche Einsamkeit nicht trotzdem beschissen fand. Es dauerte immer eine Weile, bis alle Freunde informiert waren, wieder spontan anriefen, einen ins Kino mitnahmen, oder nur ins Leo’s. Dabei ging Sophie eigentlich auch immer gerne allein aus. Es machte ihr nichts, solo am Margarita zu nippen, aber es war schlicht gewöhnungsbedürftig.
In diesen trüben Düsseldorfer Herbsttagen fing Sophie Lackmann an, ihre Post-Felix-Ära neu zu organisieren. Felix war auf der alljährlichen internationalen Jahrestagung der Biochemiker in Venezuela und ließ sich wahrscheinlich gerade die Äquatorsonne auf den Bauch scheinen. Sie war also völlig ungestört bei der Suche nach neuen Lebensperspektiven: kein Felix, kein Kind.
Zunächst unbemerkt wich die traurige Lethargie einer unendlichen Wut. ›Wieso‹ – dieser Gedanke ließ sich gar nicht mehr aus ihrem Gehirn verdrängen – ›wieso, in drei Teufels Namen, brauche ich einen Mann, um mein Leben zu leben?‹
Diverse Essays in Fachzeitschriften hatten die männerlose Gesellschaft bereits vorhergesagt. Männer zum Kinderzeugen waren eigentlich völlig unzeitgemäß. Die Spermienqualität wurde so und so immer schlechter, jedes zehnte Paar brauchte schon heute die Assistenz eines Reproduktionsmediziners, um an den ersehnten Nachwuchs zu kommen. Chemikalien, Pestizide und weibliche Hormone im Trinkwasser senkten die männliche Zeugungskraft. Wer sich als Frau heutzutage ein Kind wünschte, tat gut daran, fünfzig Mark für einen Spermien-Fitneß-Test zu opfern. Das Testset war in jeder Apotheke zu haben, und damit ließ sich zumindest ungefähr prognostizieren, ob der Geliebte, der zukünftige Ehemann, oder wer auch immer, potentiell zeugungsfähig war. Bei genügend bewegungsfähigen Samenzellen färbte sich die Lösung im Teströhrchen lila. Man benötigte dafür schlicht drei Milliliter frisches Sperma.
Und mit der Ehe als Dauer-Institution war es auch nicht mehr weit her. Nach vier Jahren, so die statistischen Berechnungen, stand unweigerlich die Trennung ins Haus. Knapp zwei Millionen Mütter erzogen ihre Kinder bereits jetzt alleine, und Sophie konnte leicht hochrechnen, wie viele es inoffiziell waren, wenn sie sich nur in ihrem Freundeskreis umschaute.
»Warum fang ich dann nicht gleich alleine an?« redete sie auf ihren Bruder Peter ein, eigentlich einen denkbar ungeeigneten Ratgeber in Liebesdingen und besonders in puncto Schwangerschaften. Er hatte immerhin schon einige Herzdamen zu einem Abbruch in Holland überreden müssen. Sie saßen nach zwei Whiskey sour im Swimmingpool, der neuen Disco am Düsseldorfer Hafen, und philosophierten angestrengt über den Sinn des Lebens. Peter hatte Sophie eingeladen – auf eine Anti-Depri-Tour, wie er es nannte. Neun Tage nach dem ersten Eklat mit Felix schien Sophie immer noch in Selbstmitleid zu versinken. Peter hatte an diesem Abend alle Termine mit seinen joggenden Millionärsgattinnen abgesagt.
»Mein Gott, datt du immer alles gleich so kategorisch sehen mußt, Schwesterherz!«
»Was schlägste denn vor? Du wirst sicher als Sechzigjähriger mit deinem Sohnemann Bauklötze stapeln!« war ihre Retourkutsche. Peter war erst neunundzwanzig, also fünf Jahre jünger als Sophie, und dachte überhaupt nicht an Nachwuchs. Ein gutaussehender, sportlicher Typ mit langen, blonden Haaren, Personal-Fitneßtrainer einiger gestreßter Manager und noch einsamerer Ehefrauen dieser ewig abgehetzten Typen. Irgendwie umwaberte Peter ein leichter Loser-Hautgout: abgebrochenes Sportstudium, abgebrochenes Informatikstudium, eben ein Verlierertyp. Er ließ sich treiben und genoß sein Leben. Jede Woche eine andere Perle im Bett. Keine einzige Sorgenfalte zierte sein markantes James-Dean-Gesicht, nur daß Peter etwa fünfzehn Kilo mehr wog, als James Dean jemals auf die Waage brachte.
»Datt is so dermaßen ungerecht«, fauchte Sophie bereits mit schwerer Zunge, »Anthony Quirin hat mit dreiundachzig nochn Kind gezeugt. Dem kannste es ja nachmachen, irgend’ne kleine Masseuse findeste sicher auch mal, mußt nur’n bißchen berühmt werden, oder etwas Kleingeld auf die hohe Kante legen!«
»Jetz mach aber mal ’en Punkt, übertreib doch nich so schamlos. Im Leben gibt ett eben nich immer nur ’ne Punktlandung. Watt glaubse denn?«
»Logisch, keene Punktlandung, du Trottel, aber, daß so’n Type wie Felix mir echt diktiert, wann ich en Kind kriege, datt is doch der Oberhammer.« Peter wußte nicht allzuviel über ihre Affäre mit Felix Northeim, nur, daß er verheiratet war und ein ziemlich angesehener Arzt. Das war auch gut so.
Die Thematik entglitt Sophie eindeutig, was schon leicht daran zu erkennen war, daß sie – ebenso wie Peter – in einen Mischmasch aus Ruhrpott-Slang und Kölsch verfiel. Logisch, Sophie und Peter waren ja auch in Duisburg großgeworden.
»Dann such dir doch nen coolen Typen, der dir en Kind macht, hock dich mit dem inne Dreizimmerbude, häng den Job an nen Nagel, züchte en paar Tauben im Hof und bring dem Alten abends sein Bier! So einen findste immer!«
Diese bemerkenswert unqualifizierte Aussage ihres Bruderherzchens machte Sophie einmal mehr klar, daß sie in zwei verschiedenen Welten lebten. Sonst hätte er wissen müssen, daß so ein Typ sie nicht mal mit der Kneifzange angefaßt hätte.
»Die suchen sich ne willige Kosmetikerin, und nicht so ein Karriereweib wie mich. Da käm es wahrscheinlich noch nicht mal im Vollrausch zur Zeugung, weil die bei mir gar keinen hochkriegen.«
»Für eine Nacht reicht’s immer«, feixte Peter.
»Du kapierst einfach nie was. Dein IQ kann nicht mal über 100 liegen!«
Sophie ging die Diskussion mit Peter gehörig auf die Nerven. Sie war kultiviertere Unterhaltungen gewohnt, und genau das schrie sie ihm auch mitten ins Gesicht. Sophies Hals war sowieso schon rauh, weil die Dezibel, die sie brauchte, um den Funk-Jazz zu übertönen, ihre Stimmbänder völlig verkrampft hatten. Sie ging also allein auf die Tanzfläche. Intellektuell war mit Peter heute sowieso nichts mehr anzufangen.
Peter gönnte sich einen weiteren Whiskey sour. Seine Schwester war ihm ein Rätsel. Sie hatte alles erreicht, Studium, einen tollen Job, einen Klasse-Lover mit Stil und Kohle, und jetzt wollte sie zu allem Überfluß auch noch ein Kind. Sophie konnte das Leben einfach nie so nehmen wie es kam, dachte er sich. Hätte er doch einen Schuß mehr Ehrgeiz von ihr und sie einen Schuß mehr Leichtigkeit des Seins von ihm. Dann hätten sie wohl beide weniger Probleme. Er machte sich ernsthaft Sorgen. Sophie hatte echt eine Krise, und dann zog sie ihr Ding meist ohne Rücksicht auf Verluste durch. Das kannte Peter schon. Sophie konnte rücksichtslos gegen sich und andere sein, wenn man sie tief verletzte und sie das Gefühl hatte, ungerecht behandelt worden zu sein. »Das muß ich verhindern, irgendwie«, schwor sich Peter an der Bar des Swimmingpool. Nur wie? Das wußte er auch nicht. Vielleicht würde Tante Billie seine wildgewordene Schwester zur Vernunft bringen können.
Sophie tanzte gerne alleine. Da konnte sie nachdenken, sich voll ihrem Körper hingeben, losgelöst vom Alltag. Wunderbar, genau das brauchte sie jetzt.
Plötzlich sah sie Achim, einen guten Freund von Peter, am Rand der Tanzfläche. Die beiden hatten drei Jahre zusammen in einer Zweizimmerwohnung gehaust, anders konnte man es wohl nicht nennen. Damals hatte Peter in Köln Sport und Achim Medizin studiert. Achim steuerte auf die Tanzfläche zu und schenkte Sophie sein süßestes Lächeln.
»Hi, Sophie, wie geht’s? Schön, dich zu sehen. Ist Peter da?«
»Steht da hinten an der Bar.«
»Kommst du mit, dann lasse ich uns einen schönen Margarita mixen?« fragte Achim und blitzte mit seinen tiefsinnigen Augen. Er war eher ein dunkler Typ, braune glatte Haare, sonnengebräunte Haut, immer ein Hauch von Latino-Bart im Gesicht, aber eben mit hellen Augen. Äußerlich der Typ, auf den Frauen total stehen, auch Sophie.
»Nein, ich kann keinen Margarita mehr sehen. Ich nehm einen Whiskey sour«, antwortete sie kühl. Spätestens da mußte Achim bemerkt haben, daß etwas nicht stimmte. Er zog sie an die Bar, nahm sie einmal fest in den Arm, und streichelte kurz ihre Wange.
Die Nummer nun wieder! Achim war latent, aber konstant in Sophie verliebt und ließ aber auch gar keine Gelegenheit aus, ihr das zu zeigen. Sie waren nie ein richtiges Paar gewesen, aber ein paarmal zumindest kurz davor. Achim war im Prinzip kein schlechter Liebhaber, beileibe nicht, eigentlich sogar ein guter ›Techniker‹, wie Tante Billie die Sorte Männer zu umschreiben pflegte, denen ein Schuß versaute Erotik fehlte. Nur irgendwie hatte es bei Sophie einfach nie richtig gefunkt. Sie mochte Achim, keine Frage, aber wenn sie ihn ein halbes Jahr nicht sah, dann krampfte sich ihr Herz nicht gerade vor Schmerz zusammen, dann steigerte sich die Sehnsucht keineswegs ins Unermeßliche. Wenn er da war, war es gut, wenn nicht, auch.
Er vergaß nie ihren Geburtstag, rief immer mal an, und wenn sie sich trafen, konnte es schon mal im Bett enden. So war das mit Achim und Sophie.
Lässig schmiß Achim seine Lederjacke über den Barhokker. Heute sah er in seiner schwarzen Jeans besonders niedlich aus. Einen süßen Knackarsch hatte der Gute, das mußte man ihm lassen. Jetzt ärgerte sich Sophie doch, daß sie nur die blaue Stretch-Hose und ein blaues T-Shirt übergeschmissen hatte, als Peter sie abends abholte. Wahrscheinlich sah sie ziemlich verschwitzt aus. Das Gröbste versuchte Sophie zwar auf der Toilette zu renovieren, aber nur mit mäßigem Erfolg. Sie hatte zuviel geheult und zu wenig geschlafen in den letzten Tagen. Kein Wunder, daß sie nicht wie das blühende Leben aussah, aber bei Achim war das eigentlich auch ziemlich egal.
»Is was mit Sophie?« fragte Achim sofort, als er sich neben Peter setzte.
»Die spinnt mal wieder!«
»Aha«, Achim orderte zwei Whiskey sour, »wieso«?
»Achim, laß mich bloß mit Sophie in Ruhe! Frag se selbs, die kindische Pute.« Peter war nicht gerade gesprächig.
»Ist es aus mit Felix?«
»Ja, wenn de datt genau wissen wills. Die willn Kind, er nich. Ende, Pustekuchen, so einfach.«
»Sie will ein Kind?« Achim starrte Peter wie ein Männchen vom Mond an. Sophie hatte mit ihm noch nie über ein Kind gesprochen, aber in den letzten zwei Jahren hatten sie ja auch nicht mehr soviel miteinander zu tun gehabt. Den Namen Felix konnte er schon nicht mehr hören. Felix hin, Felix her. Und jetzt auch noch ein Kind. Der war doch nun echt zu alt!
Peter und Achim unterhielten sich einsilbig, als Sophie – etwas aufgefrischt – wieder an die Bar zurückstolzierte. Peter drehte ihr demonstrativ den Rücken zu. Er war sauer wegen der heftigen Diskussion von vorhin, und irgendwie hatte er Sophie ihre gelegentlichen One-night stands mit seinem Freund Achim nie gegönnt. Achim war ihm eigentlich zu schade für diese Spielereien von Sophie. Aber Achim war alt genug! Peter war längst klar, daß er heute nicht mit Achim in irgendeiner Bar versumpfen würde. Achim war als Sophies Tröster schon immer ganz gut gewesen, und genau das brauchte Sophie heute sicher. So gut kannte Peter seine Schwester – auch auf die Gefahr hin, daß der Katzenjammer hinterher noch größer sein würde.
Seit sie mit Felix zusammen war, war zwischen ihr und Achim nichts mehr gelaufen. Natürlich war sie Felix immer treu gewesen. Aber unter den neuen Bedingungen würde sie sich nichts verkneifen. Das war für Peter so klar wie Kloßbrühe!
Peter verabschiedete sich mit einem Achselzucken, während Achim und Sophie wieder auf die Tanzfläche hüpften. Achim kam gerade aus den USA zurück. Während der letzten drei Monate hatte er dort sein letztes Praktikum am Massachusetts General Hospital in Boston in der Chirurgie absolviert. Da gab es viel zu erzählen. Achim war ein mindestens ebenso begeisterter Amerika-Fan wie Sophie. Komisch, daß Mediziner immer schon eine merkwürdige Anziehungskraft auf sie ausgeübt hatten. Wohl, weil sie selber gern Medizin studiert hätte und nur vor dem vielen Leid, das sie sicher nicht hätte ertragen können, zurückgeschreckt war. Ihre Jugendliebe Bernd lebte inzwischen als Unfallchirurg in Berlin, hoffentlich einigermaßen glücklich verheiratet und Vater von drei Kindern. Und Martin, mit dem sie mal ein Jahr zusammengewesen war, bohrte als Zahnarzt den Münchnern im Mund herum.
Gegen vier Uhr wankte Achim, von Sophie untergehakt, immer noch im Tanzschritt, aus dem Swimmingpool, und sie suchten ein Taxi. Ein Blick genügte, und Achim sagte, als sie sich beide auf die Rückbank quetschten, mit fester Stimme: »Agnesstraße 27.«
Zehn Minuten später stolperten beide in Achims Hinterhofwohnung, und dann ging alles ziemlich schnell, kurz und bündig wie immer mit Achim.
Als Sophie um sechs das erstemal unter der Bettdecke hervorlinste, entdeckte sie das reinste Chaos. Das kleine Apartment von Achim hatte längere Zeit keinen Putzlappen gesehen, und von einer Einrichtung konnte man sowieso kaum reden. Die Matratze lag am Boden. Der schmuddelige beige Teppichboden war kaum mehr auszumachen, weil auf den wenigen freien Flächen zwischen Schrank, Bett und Schreibtisch ihre Klamotten verstreut lagen, mittendrin ein welkes Kondom. Komisch, ein Kondom war zwischen ihr und Achim immer eine ausgemachte Sache gewesen. Achim kannte ihre Angst vor AIDS. Da war sie seit vielen Jahren extrem vorsichtig. Warum hatte er sich diesmal bloß so geziert? Vielleicht hatte er eine Latex-Allergie, dachte sich Sophie, soweit ihr Gehirn zum Denken überhaupt zu benutzen war. Das sollte bei Ärzten immer häufiger vorkommen.
Sophie suchte schnell Slip und Hose zusammen, trank einen Schluck Wasser aus der Leitung, drückte Achim noch einen Kuß auf den Dreitagebart und flüchtete, so wie sie es immer nach einer Nacht mit ihm getan hatte.
Zu Hause gönnte sie sich eine Tasse Nescafé und das Marzipanhörnchen, das sie an der Ecke beim Bäcker gekauft hatte. Der Anrufbeantworter blinkte: »Ich verzehre mich nach dir. Sehen wir uns Freitag, wenn ich lande? Ich könnte auch über Nacht bleiben. Meine Frau erwartet mich erst am Samstag. Wir können ja noch mal über ein Kind reden, vielleicht es einfach probieren«, hörte sie Felix aus dem Lautsprecher säuseln, unterbrochen von mehreren Knackslauten. Er mußte aus Venezuela angerufen haben.
Jetzt war es mit ihrer Beherrschung endgültig vorbei. »O Felix, ich liebe dich und hasse dich zugleich«, schluchzte sie in die Kissen. »Nein, ich will nicht, ich will einfach nicht mehr.«
Mit Schwung warf sie sich aufs Bett, zündete mit zittrigen Fingern eine Zigarette an und genehmigte sich einen Schluck Whisky, einen sensationell guten Glenfiddich. Wenn es so weiterginge, würde sie sich in zehn Jahren in solchen Situationen noch ein Valium einwerfen müssen. Das war klar.
Guter Trick, Herr Professor, dachte sie insgeheim, aber Sophie Lackmann kann ja rechnen. Am Freitag war der 23. Zyklustag. Da brauchte man weder über ein Kind reden, noch es machen, weil es nach Adam Riese gar nicht klappen konnte. Welche Frau hatte schon am 23. Tag ihren Eisprung? Bei einem regelmäßigen Zyklus von 28 oder mal 29 Tagen kam nur der 13. bis 16. Tag in Frage. Das wußte Felix als Gynäkologieprofessor besser als jeder andere. Also wieder einen Monat hingehalten, belogen und für dumm verkauft. Mit diesen Gedanken und dem Geruch von Achim an ihrem Körper schlief Sophie ein.
Nein, so konnte es nicht weitergehen. Das war unter ihrem Niveau, pure Verzweiflung, Chaos in Hirn und Bauch. Nein, so nicht. Sie würde Felix erst mal nicht wiedersehen!
Ihr ganzes Leben und ihren Beruf hatte sie bislang minutiös geplant, nur das Wichtigste in ihrem Leben, ein Kind, sollte sie einem schnöden Zufall überlassen? Nicht Sophie Lackmann!