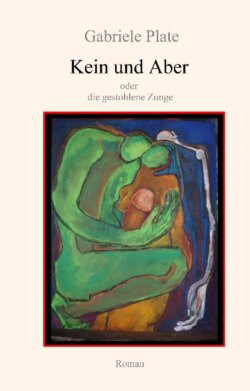Читать книгу Kein und Aber oder die gestohlene Zunge - Gabriele Plate - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Rachepläne
ОглавлениеPauls Vater war ein einflussreicher Mann gewesen, mit der Selbstverständlichkeit vertraut, seine Order beachtet und widerspruchslos ausgeführt zu wissen. Beruflich, wie privat. Falls Paul jemals Gegenargumente hatte verlauten lassen, waren sie sehr selten und bedeutungslos gewesen, auf absolute Nebensächlichkeiten beschränkt.
Während dieses letzten Gesprächs, als Pauls Sanftheit in eine offene Antihaltung umgeschlagen war, als wolle er ein nie gelebtes Pubertätsverhalten nachholen, hatte er sich ungewohnt befreit gefühlt. Ein Gefühl, das ihm nicht bewusst war, er fühlte es nur, ohne es zu analysieren. Ihm war wenig Zeit dafür geblieben, genau siebenundzwanzigeinhalb Minuten. Dann war dieser Vater unangreifbar geworden. Kein Vorwurf konnte ihn mehr treffen, kein Widerspruch empören.
Dieser Mann hatte sich für unverwundbar gehalten. Gelegentliche Schwächezustände, die ihn neuerdings heimgesucht hatten, waren nicht von ihm beachtet worden, als kleine Belästigung seines akuten Schlafmangels gedeutet. Sein Herz sei unverwüstlich, hatte er immer behauptet. Nun hatte diese Unverwüstlichkeit versagt. Er war nicht leichtfüßig in die Arme des Hades gestolpert, sondern mit Furcht und Zweifel und wütendem Unverständnis über die verratene Loyalität seines Sohnes.
Pauls Vater war auf seine Weise vernarrt in seinen Sohn gewesen, niemandem sonst hatte er sogar kleine Unaufmerksamkeiten in der Klinik verziehen. Man hatte den Eindruck gehabt, als wollte er durch seinen Sohn eine doppelte Identifikation seines Selbst züchten. Sich daran weiden, wie an einem noch besseren Selbst. Dieser Streich wäre ihm beinahe gelungen. Beinahe, denn Paul war aus der Bevormundung, die angeblich aus Liebe und Sorge um ihn geschah, erwacht. Plötzlich wollte er frei von väterlichen Anordnungen sein, wollte sein Leben nicht im Kielwasser seines Vaters gestalten. Er wollte mit Aisha leben und war bereit gewesen mit ihr bis an das Ende der Welt zu ziehen, sogar in das Land ihrer Väter, um dort als Arzt tätig zu sein. Diesen Meinungsumschwung und seine neue Berufsabsicht, einer seiner Meinung nach würdigeren Arbeit, hatte er seinem Vater nicht mehr mitteilen können. Mit dieser Idee hätte er bei ihm noch größeres Entsetzen ausgelöst und möglicherweise seine Enterbung.
Paul hatte Aisha in seine Überlegungen eingeweiht und war auf wenig Begeisterung gestoßen. Sie hatte ihn lieblich angelächelt und gemeint, sie bliebe immer bei ihm, doch vorzugsweise hier im Land seiner Väter! Er solle diese Klinik ruhig eines Tages übernehmen und sich ansonsten den Themen seiner eigenen Interessen und ihren künftigen Kindern widmen. Das alles und vieles mehr, könne er in ihrem Ursprungsland nicht in Frieden ausführen, oder auch nur annähernd erreichen.
Die Beerdigung dieses, mit Hilfe eines beachtlichen Privatvermögens einflussreichen Mannes, Koryphäe seines Berufes, Ehrenbürger seiner Stadt, eisern bis zur Halskrause mit Prinzipien bewaffnet, diese Beerdigung war allen erdenklichen Ritualen gerecht geworden.
Er war Haupteigner einer Privatklinik gewesen und hatte zusätzlich in einem Seitenflügel des Klinikgebäudes eine Praxis für Schönheitschirurgie übernommen und erweitert. Sein Vermögen war außerdem, durch den fachmännisch geleiteten Erwerb und Verkauf von Aktien aus der Pharmaindustrie, ohne Risiko vermehrt worden. Er hatte sich öffentlich, jahrelang für die Krebsforschung im Bereich der Leukämie eingesetzt, horrende Gelder gespendet, die ihm inoffiziell für kleine Dienste und Bereitschaften von genau jener Industrie zugeschoben worden waren.
Europaweit galt Pauls Vater, nicht nur unter Kollegen, als ausgezeichneter Chirurg und Retter unzähliger Unfall- Kriegs- oder Krebsbeschädigten, die durch seinen geschickten chirurgischen Einsatz und spezielle Methoden zu neuem Selbstbewusstsein gefunden hatten. Es waren nicht nur notwendige Nasen-, Kinn- oder Brustoperationen, die er erfolgreich durchgeführt hatte, es waren auch unzählig eitle Menschen unter seinem Messer wie neu auferstanden. Viele dieser ehemaligen Patienten kondolierten Paul, er kannte die wenigsten.
Sein Vater hatte einen Namen, man hatte diesem vertraut und ihn verehrt. Konnte man diesem Sohn, mit seinem terrorverdächtigen Gerede, nun eine würdige Nachfolge zutrauen? Paul las diesen Zweifel in allen Gesichtern. Ein Skandal wegen seines Interviews wäre nicht aufzuhalten gewesen, wenn nicht der Tod des Vaters davon abgelenkt hätte. Man hatte sich erst einmal auf eine würdige Beisetzung konzentriert, um Pauls Widerspruch, mit glaubhafter Entschuldigung, wollte und müsste man sich später kümmern. Der ganze Stadtrat, die Bruderschaft, eine erhebliche Anzahl von Berechtigten und weniger Berechtigten unterstützten diese Beisetzung mit Annoncen, Nekrologen und aufwendigen Beileidskundgebungen. Würdig sollte es zugehen und von niemandem übersehen werden. Nein, man übersah den langen Leichenzug nicht.
Paul war traurig, der Tod seines Vaters hatte ihn nicht unberührt gelassen, er bescherte ihm zwar ein Quäntchen mehr Schuld, doch er hatte auch sofort erkannt, dass eine Eheschließung mit Aisha, zumindest auf dieser Seite, nun mit weniger Auseinandersetzung zu regeln wäre. Er konnte sich außerdem des Gedankens einer lächerlichen Parallelaktion, zu all dem Treiben um das Geschehen in Paris, nicht erwehren. Als sei man auf einen fahrenden Zug aufgesprungen. Sein Vater war mit hineingerutscht, in die Trauerkundgebungen um die Journalisten, als wäre er einer von ihnen gewesen. Das hätte ihm gefallen!
Einige Tage vor dem Tod des Vaters hatte sich ein kleiner Zwischenfall ereignet.
Paul war kein Fernsehfan. Er mochte keine Krimis, hasste Quizsendungen und Unterhaltungskram mit viel Spektakel. Amerikanische Action Filme beurteilte er als völlig überflüssig auf dieser Welt, und er interessierte sich nicht im geringsten für Satire, für Politik auch nicht. Da blieb nicht viel für ihn übrig, außer einigen Reportagen oder Dokumentarfilmen, die sich allerdings für seinen Geschmack zu häufig wiederholten. Den Rest erfuhr er wie nebenbei in der Klinik oder aus der Zeitung. Doch manchmal, wenn er in der Kantine seinen Kaffee trank, ließ es sich nicht umgehen den Blick auf einen ständig eingeschalteten Fernsehapparat zu werfen. Bei einem dieser geistesabwesenden Zufallsblicke erschrak er und verschluckte sich heftig. Das Gesicht eines Mannes auf dem Bildschirm hatte diesen Schreck ausgelöst. Paul stellte hastig seine Tasse ab und starrte auf diese Person.
Die Einstellung wechselte, er glaubte sich getäuscht zu haben. Doch dann tauchte dieser Mann wieder auf, er sah Paul zum Verwechseln ähnlich, obwohl er eine Melone trug und einen offensichtlich mit Absicht falsch herum angeklebten Charlie Chaplin Schnauzbart. Dazu trug er eine grellgelbe, übergroße Brille mit auffälligem Tigermuster. Trotz dieser Aufmachung, die Paul idiotisch lächerlich fand, konnte er sich in diesem Mann erkennen. Er war etwa in seinem Alter. Was Paul nicht bemerkte war, dass dieser Mensch ihm nicht nur physisch glich, sondern dass er auch mit seiner Stimme parodierte, obwohl ein englischer Akzent herausrollte. Eine besonders raue, Pauls aufgeraute tiefe Stimme! Eine Krankenschwester, die sich interessiert, Käsebrötchen kauend neben ihn gestellt hatte, machte ihn darauf aufmerksam.
„Verehrter Herr Doktor von Schwanstein, haben Sie ein Doppelleben und ziehen gelegentlich als Kabarettist durch die Häuser?“ Sie lächelte frech. „Dieser Mann hier, das könnten doch zweifellos Sie sein.“
„Könnte“, sagte Paul, „aber ich bin es nicht. Ich finde es nicht besonders originell, sich als verwirrter Charlie Chaplin zu präsentieren und Hetzsprüche von sich zu geben.“
Ein Kollege gesellte sich zu ihnen. „Dieser Kabarettist ist in England sehr beliebt, er tritt niemals ohne diese Verkleidung auf, sein Markenzeichen sozusagen. Er hat einige Auftritte in unserer Stadt, in dem kleinen Theater in der Schumannstraße, das sollten Sie sich unbedingt ansehen. Ich habe gestern eine Übertragung im Fernsehen gesehen. Eine Koryphäe, dieser Kai Bitterstone, ziemlich gewagt zwar, aber ich habe mich köstlich amüsiert, meine Frau weniger. Dies hier, scheint die Wiederholung von gestern zu sein.“
Diesem Kollegen war die Ähnlichkeit mit Paul nicht aufgefallen. Er war ein Jemand, der sich von Hut und Brille blenden ließ.
„Danke für die Information, aber ich interessiere mich nicht für Kabarett.“
„Das hätte ich mir denken können, genauso humorlos wie der Herr Papa? Na ja, der Apfel und sein Stamm, und so weiter.“
Paul lächelte mitleidig und drehte sich auf dem Absatz um. Dieser Zwischenfall hatte ihn nur kurz beschäftigt. Er hatte also einen Doppelgänger, es wäre doch interessant diesen kennenzulernen. Vielleicht war der Mann ein naher Verwandter, von dem er nichts wusste? Hatte er vielleicht sogar einen Bruder? War das seinem Vater zuzutrauen, eine heimliche Affäre mit Folgen? Paul hatte unbestreitbar äußere Ähnlichkeit mit seinem Vater, somit hatte sie dieser Fernsehclown auch. Er wollte unbedingt seinen Vater darauf ansprechen, doch dann wurde er von seiner Arbeit abgelenkt, es hatte Probleme bei der letzten Operation gegeben, er hatte danach ganz andere Dinge im Kopf. Direkt nach Dienstschluss hatte er eine Verabredung mit seiner Aisha gehabt, das war wichtiger gewesen als an einen Doppelgänger zu denken oder sich bei seinem Vater nach einen möglichen Bruder zu erkundigen. So vergaß er den Fernsehauftritt, zumindest für einige Zeit.
Dann kam die unglückliche Unterredung mit seinem Vater dazwischen, die Frage nach einem möglichen Bruder hätte dort keinen Platz gefunden. Auch der Tod des Vaters, der Beerdigungskram und die ihn fordernde Organisation der Hinterlassenschaft besetzten Pauls Gedanken und seinen Tagesablauf erheblich. Wollte er wirklich die Klinik übernehmen? Oder sollte er den ganzen Ramsch verkaufen und mit Aisha ein völlig neues Leben beginnen? Pauls Gedanken taumelten durch die ungewohnte Verantwortung.
Diese Fragen brauchte er sich sehr bald nicht mehr zu stellen, denn kurze Zeit nach der Beerdigung seines Vaters, hatte er auch Aisha verloren. Die Welt war eingestürzt.
Paul war vorerst nicht ansprechbar gewesen, er hatte um die Verschiebung der Testamentseröffnung gebeten. Als es dann zu diesem Termin kam, war er immer noch wie betäubt über den Verlust seiner Geliebten. Nun stand er ganz alleine da, er fand keine Richtung.
Pauls Mutter war vor mehr als fünfundzwanzig Jahren, unter ihn immer noch belastenden, tragischen Umständen ums Leben gekommen. Paul hatte keine Erinnerung an diesen Unfall. Er hatte keine Geschwister und dachte Alleinerbe zu sein. Ein Drittel dieses Erbes wäre immer noch mehr als genug gewesen, um im gehobenen Luxus, ohne finanzielle Einschränkung, bis ans Ende eines langen Lebens zu gelangen. Aber Luxus lag gar nicht in Pauls Sinn, zumindest kein übermäßiger. Natürliche Bescheidenheit, verbunden mit unauffälliger Exklusivität, hatten ihn ebenfalls von seinem Vater unterschieden.
So war es ihm also nicht wichtig, mit was oder mit wie viel sein Vater ihn bedacht hatte. Was der Verstorbene der Haushälterin, eventuellen Freunden oder Vereinen zugedacht hatte, war Paul gleichgültig, es würde für ihn immer genug übrigbleiben. Er hörte kaum auf die Worte des Notars, seine Gedanken waren bei der toten Aisha und nur bei ihr. Doch als der Notar seinen Namen verließ und angab, dass Paul die Hälfte aller Wertpapiere, des Barvermögens und der zahlreichen Immobilien zu erben hatte, wurde er wach. Er bat um Wiederholung des letzten Absatzes. Darin erfuhr er weiterhin, dass er zwar alleiniger Erbe des Elternhauses und der Besitzanteile der Klinik sei, ihm jedoch die zu erwartenden künftigen Schwanstein Gewinnanteile daraus, nur zur Hälfte zugesprochen wurden. Das war erstaunlich, wer sollte die andere Hälfte bekommen?
Paul vernahm, dass die verlorene Hälfte, nicht etwa einer heimlichen Liebsten seines Vaters zugesprochen wurde, sondern dessen Sohn, Kai Hauke von Schwanstein, seinem Bruder.
Paul war zunächst einmal sprachlos, er rührte sich nicht. Er hatte einen Bruder? Bei diesem Gedanken überfiel ihn ein leichtes Rieseln der Freude. Dieses Rieseln kroch langsam über ihn und versuchte sich einen Platz in dem großen Trümmerfeld der Trauer freizuschaufeln.
„Kai Hauke von Schwanstein, mein Bruder? Können Sie mir sein Alter nennen?“
Ein Missverständnis schien unwahrscheinlich. Kai war der Vorname seines Vaters, Hauke der des Vaters seiner Mutter, und Paul hatte den Namen seines Großvaters väterlicherseits.
„Ja, natürlich, das Alter“, sagte der Notar peinlich berührt, er hüstelte verlegen.
„Er ist Ihr Zwillingsbruder. Ihr Herr Vater hatte mich schon vor Jahren darüber aufgeklärt und um absolute Diskretion gebeten. Er hat auch ausdrücklich darauf bestanden, dass Sie zur Testamentseröffnung zuerst und allein anwesend sein sollten, das ist nicht üblich und hat erhebliche Schwierigkeiten gekostet. Aber er bestand darauf, damit Sie nicht, eventuell unerwünscht oder unangenehm unvorbereitet, mit diesem Bruder konfrontiert werden. Aus Rücksicht, um sich frei entscheiden zu können ob Sie ihn kennenlernen wollen oder nicht.“
Paul war gerührt, so taktvoll kannte er seinen Vater nicht. Gleich nach diesem kurzen Gerührt-Sein machte sich der Ärger breit. Ärger über diese Heimlichtuerei. Ein Bruder, okay, seinetwegen auch zwei oder drei, das hätte er ja noch verstanden und einordnen können in die Möglichkeiten, Früchte eines heimlichen Liebeslebens seines Erzeugers. Aber wieso ein Zwillingsbruder?
Seine Mutter hatte ihm von frühester Kindheit an das Gefühl vermittelt, ihr lästig, sogar unerwünscht zu sein. Aber sie würde doch niemals ihr Zwillingskind abgegeben haben. Oder hatte sie nicht davon gewusst? Ist so etwas möglich? Wieso hatte sein Vater davon gewusst, hatte er ihr und ihm dieses Kind heimlich weggenommen? Aber warum?
Paul erinnerte sich an den Doppelgänger aus der Fernsehsendung und es bestätigte sich tatsächlich, dieser Mann vom Kabarett war sein Bruder, der unter einem Künstlernamen auftrat. „Bitterstone“ erinnerte sich Paul. Das passte zu dem Wenigen was Paul über das Fernsehen von ihm vernommen hatte. Bitter und schwer wie ein Stein. Oder Steinschlag? So, wie seine Worte auf viele Gemüter wirken mussten. Der Name schien von Schwanstein abgeleitet zu sein. War er einen bitteren Weg gegangen?
Paul wollte unbedingt über dieses Schicksal informiert werden, doch der Notar konnte ihm keine nähere Auskunft geben. Er überreichte ihm lediglich eine Handy Nummer und eine Londoner Adresse. Paul plante noch am selben Tag diesen Bruder zu sehen und mit ihm zu sprechen. Doch das Schicksal machte ihm einen blutigen Strich durch diesen Wunsch.
Unter dieser Nummer konnte man nur eine Frau erreichen, angeblich seine Managerin. Paul bekam zu hören, dass er sich gefälligst selbst zum Theater begeben müsste, wenn er den Künstler sehen wolle. Dieser hätte weder Zeit noch Interesse an außerplanmäßigen Treffs mit Unbekannten. Im Moment sei Mister Bitterstone sowieso noch nicht zu erreichen. Es gäbe für seine Fans vor der Abendvorstellung eine Möglichkeit ihn zu sprechen, aber man müsse sich anmelden. Zu späterer Stunde wünsche der Künstler keine Besuche mehr, auf Wiederhören.
Paul kam nicht zu seiner Erklärung, man ließ ihn nicht zu Worte kommen. Er rief erregt ins Telefon. „Moment mal, hören Sie Verehrteste, es ist sehr wichtig, ich bin kein Fan dieses Clowns, ich bin sein Bruder.“
Die Dame hatte die Verbindung schon abgebrochen und sich wahrscheinlich mit denselben Worten an den nächsten und übernächsten Anrufer gewandt, denn als Paul noch etwa ein Dutzend Mal die Wiederholungstaste betätigt hatte, war die Leitung permanent besetzt gewesen. Wie Paul in Erfahrung gebracht hatte, war es einer der letzten Abende der Gastvorstellung seines Bruders in dieser Stadt, aber er hatte nicht das geringste Bedürfnis diesem eingebildeten Mann hinterher zu reisen.
Wieso eingebildet? Das konnte er doch gar nicht wissen. Seine Managerin war eine Ziege, das hieß noch gar nichts. Dann kamen Paul die dummen Sprüche aus dem Fernsehen in Erinnerung. War es nicht ratsamer, sich noch ein paar Tage zu gedulden, zu warten bis der Notar den Mann informiert und in sein Büro bestellt hatte? So gesehen könnte er auch warten, bis dieser Bruder den Kontakt zu ihm anstrebte.
Am frühen Abend jedoch, gewann seine Neugier. Paul entschied zum Theater zu fahren. Er war mit einem Taxi vorgefahren, hatte die Tür zum Haupteingang noch verschlossen vorgefunden und sich durch den Nebeneingang hineinschleichen wollen, dem Künstlereingang, als sei er ein Mitglied einer Theatertruppe. Vielleicht konnte er ja dieser Zicke am Telefon ein Schnippchen schlagen und ohne Anmeldung seinem unerwarteten Geschenk gegenübertreten. Er nannte dieses Geschenk sein Fleisch- und Bluterbe.
Doch bevor Paul den seitlich des Hauptgebäudes liegenden, von einer dichten Hainbuchenhecke gesäumten, schmalen Asphaltweg bis zu Ende beschritten hatte, stellten sich ihm vier vermummte Gestalten in den Weg. Das hatte ihn eher erstaunt als ängstlich gestimmt. Die Personen waren nicht groß und sie bewegten sich nicht gerade wie Muskelmänner. Wenige Sekunden später hielten sie ihn zu Viert gleichzeitig fest, und eine fünfte Person beugte sich über ihn. Er lag mit dem Kopf in die Buchenhecke gepresst. An andere Details konnte er sich nicht erinnern, nur an den Einstich einer Betäubungsspritze. Dass es vier Personen waren, hatte Paul noch verwundert, denn er war kein körperlich durchtrainierter Mann mehr, das war leicht zu erkennen, kein starker Mann. Er hatte sich gehenlassen, nicht mehr trainiert seit Aishas Tod. Trotzdem hatte man geglaubt vier Personen zu benötigen um ihn festzuhalten? Er war viele Stunden später in der Intensivstation des Städtischen Krankenhauses aufgewacht. Ohne seine Zunge.
Als sein Verstand wieder bereit war zu funktionieren, als sein Entsetzen den Schmerz des nächsten Verlustes vertrieben, und seine Fassungslosigkeit, über die Zügellosigkeit der Selbstjustiz dieser Aisha Familie, sich in wilde Rachepläne verwandelt hatte, glaubte er durch die Hölle zu gehen. Doch Paul kannte die wahre Hölle noch nicht. Relativ gesehen, zu dem was noch kommen sollte, balancierte er erst am Eingangsbereich des Höllentores entlang. Sein Bruder war der Priorität, kennengelernt zu werden, erneut enthoben. Diese Mörderbande hatte sich dazwischen gedrängt und einen neuen, absoluten Vorrang in seine Gedankengänge geschlitzt.
Sie hatten ihn offensichtlich auf Schritt und Tritt überwacht, um ihn in einem geeigneten Moment überfallen zu können. Aber warum hatten sie dieses Attentat auf ihn nicht begangen, als er vor Aishas Elternhaus gestanden und stundenlang gegen die Tür getreten hatte. Man hatte ihn nur mit einem Eimer voll kalten Wassers bedacht, es von oben aus dem Fenster über ihn geschüttet, als sei er ein räudiger Köter. Kein Wort, keine Information. Er hatte geschrien und getobt, bis die Nachbarn die Polizei gerufen hatten. Er wollte doch nur wissen, wo sie begraben war. Keiner hörte ihm zu. Und er hätte beinahe noch einen Polizisten verprügelt.
Das alles hatte Paul durchdacht, wieder und immer wieder. Zwischenzeitlich hatte er sich dem mittlerweile völlig verschlissenen Abschiedsbrief gewidmet und erneut losgeheult. Oder er fingerte an dem wunden Rest seiner Zunge herum. Dann hatte das Lippenknabbern begonnen. Später, als er schon längst aus der Klinik entlassen worden war, hatte er erkannt, wie vielfach diese ihm auferlegte Rache ausgefallen war.
Seine Liebste war tot, man ließ ihn nicht an ihr Grab, er hatte keine Zunge mehr, konnte seinen Beruf demnach nicht mehr ausüben, und zusätzlich hatte man ihm die Möglichkeit geraubt, sich in einem Gespräch mit seinem Bruder bekanntzumachen. Es hätte ihm viel bedeutet das mit eigenen Worten zu tun. Wie auch immer diese Begegnung nun ausfallen würde, niemals mehr könnte sie von einem Gespräch getragen werden.
Ein weiterer Tropfen, der dafür gesorgt hatte, dass sein bis zum Bersten gefülltes Trauerfass kurz vor dem Überlaufen war. Der Pegel zitterte bedenklich einer Explosion entgegen, seine Rachepläne rieben sich die Hände heiß. Die gewichtigen Schatten seiner Betrübnis wurden von einer ungeheuren Wut abgelöst. Diese gestaute Energie der Wut kochte in seinem Inneren, doch sie war noch nicht bis in die direkte Handlungsbereitschaft gelangt. Er hatte Skrupel.
Zu diesem Zeitpunkt hatte Paul immer noch Bedenken zurückzuschlagen, um sich an Aishas Familie ebenfalls zu rächen. Moralische Bedenken. Seine Erziehung war lückenlos traditionell konservativ und katholisch geprägt, sie hatte nicht genügend Freiraum genossen, um sich individuelle Verurteilung und daraus folgend kriminelle Tat als legal zurechtbasteln zu können. Er wurde zusätzlich von dem dreifachen Menschen-Retter-Syndrom abgebremst, dem des braven Chirurgen in sich selbst, dem seines Vaters und seines Großvaters. Eine geeinte Kraft, die gegen das Rachebedürfnis antrat, ungeachtet dessen, was ihm widerfahren war,
Noch stand er auf des Messers Schneide. Eine Seite in ihm schrie und stampfte der Rache entgegen, während die domestizierte Seite, die den Gesetzten seiner eigenen Gesellschaft gehorchende, sogenannte gute Seite, ihn zurückzerrte. Das Schwungrad seiner Überlegungen hatte sich heiß gelaufen. Erlaubtes und Verbotenes, Machbares und Unmögliches, das Gute und das Böse, diese Begriffe steckten im Drehkreuz seiner Gedanken fest, zu gleichen Gewichten. Dann brach er mit einer frischen Idee dieses Gleichgewicht, riss sich aus seinen eingefleischten Skrupeln, indem er gedanklich, vorsichtshalber nur gedanklich, in die Rolle eines Mitglieds jener moslemischen Gesellschaft schlüpfte, welche die Selbstjustiz als entschuldbares Vergehen zur Rettung der Ehre behandelte und vollzog. Jene Ehre, die es nun für Paul ebenfalls zu retten galt?
So könnte er es von außen betrachtet haben, einfach nur als seine persönliche Rechtfertigung. Denn drinnen, in diesem verwirrten Paul, war die Ehre ein stummes Etwas, das schon seit Jahrzehnten in einer hintersten Ecke kauerte und an Nachlässigkeit gewöhnt war. Es verlangte ihn eher nach greifbarer Rache, nach einer Süße, die er nach ihrer berühmten Versprechung schmecken wollte.
Nach diesem internen Ehre- und Rachegesetz, welches Aishas Familie, seiner Vermutung nach, an ihm erfüllt hatte, hoffte Paul ebenfalls handeln zu können, ohne sich schuldig fühlen zu müssen. Das war der zweite Angelpunkt. Er würde sich, wenn er seine Rachepläne in die Tat umsetzte, schuldig fühlen, aber sein Schuldmaß war, seiner Empfindung nach, längst überfüllt. Er wollte nicht einen Gramm mehr Schuld tragen als er ohnehin schon mit sich schleppte. Egal, ob er im Gefängnis landen oder allein in irgendeiner Höhle sein Leben fristen würde, er wäre der Schuld immer und überall ausgeliefert. Er allein, mit sich und der Schuld. Er ekelte sich vor Schuld, weit mehr als vor dem Schmerz.
Paul war erpressbar durch Schuldgefühle, sie hatten ihn seit seiner Kindheit begleitet. Er trug die Schuld am Tod seiner Mutter in sich. Diese Last hatte ihn aber nicht generell kleinlaut, ängstlich oder gemein werden lassen, im Gegenteil, sie hatte ihm möglicherweise seine zurückhaltend freundliche Art zugespielt. Er hatte die Eigenschaft entwickelt, sich seinen Mitmenschen zu nähern, um deren Schuldgefühle und eventuelle Schuldigkeit zu erforschen und um diese Ergebnisse für sich zu verwerten. Er wollte wissen, wie der Rest der Menschheit mit Schuld umging.
So hatte Paul sich stets geduldig den Klagen seiner Patienten gewidmet. Patienten, die abseits von ihren körperlichen Beschwerden meist auf eine Schuld zutrieben. Es handelte fast ausschließlich von Schuld.
Paul hatte sich immer intensiv mit seinen Patienten ausgetauscht und dabei auf seine Weise, instinktiv, nach einer verlässlichen Medizin gegen seine Schuldgefühle geforscht. Wie kamen andere Menschen mit ihrer Schuld zurecht?
Diese Gespräche rutschten oft in eine Beichte an ihn ab. Paul hatte dabei Fakten gesammelt und manches Geheimnis, das jede Moral verhöhnte, erfahren. So hatte er recht bald erkannt, dass nach seinem Verständnis, der große Unterschied zwischen Mensch und Mensch nicht durch das Geschlecht geformt wird, sondern dadurch, dass es Jene gab, die sich schuldig fühlten oder sich schuldig fühlend gemacht wurden, und Jene, die diese Schuldgefühle in anderen erzeugten, selbst wenn es eine kollektive Schuld betraf, die durch das allgemeine Verständnis von Gut und Böse reguliert wurde. Ein Verständnis, das natürlich schwanken musste. Je nach Zeitalter und Gesetzgebung konnte ein Mensch daran zerbrechen. Der Einzelne konnte nicht durch das Kollektiv erlöst werden. Keine Schuld konnte geteilt werden, wogegen sie sich mit jeder Beteiligung eines Nächsten sogar multiplizierte. Mögliche, im Kollektiv empfundene Schuld, egal wodurch sie ausgelöst worden war, richtete sich schmerzgradmäßig immer nach dem individuell Empfundenen. Es spielte keine Rolle durch was die Schuld in Bewegung gekommen war. Selbst wenn es ungerechtfertigt war, das Bewusstsein der Schuldigkeit war dasselbe, wie ein durch Glück oder Unglück verursachtes. Dass ein Glücksgefühl von seidenen Fäden gehalten wurde, wogegen die Schuld mit schweren Ankerketten hantierte, war kein Geheimnis, auch nicht für Paul.
Ihm war unbegreiflich, dass ein Glaube so stark wirken konnte, um Jemanden durch eine Beichte vor priesterlichen Ohren von seiner Schuld zu befreien. Dass dadurch eine Riesenschweinerei, die man angestellt hatte, vergeben werden konnte. Sogar und besonders vor sich selbst vergeben. War es der unbedingte Glaube, der so etwas fertigbrachte? Oder war es eine mindere Schwere der Schuld, welche diesen Gläubigen zu erstrebter Leichtigkeit verhalf?
Auch das hatte Paul bei seinen Patienten erkannt, obwohl ihm kein weiterer Fall von Muttermord zu Ohren gekommen war. Er schien ein Einzelfall zu sein.
Aus den Zusammenkünften mit seinen Patienten, die eigentlich, wie sein Vater betont hatte, ausschließlich seiner chirurgischen Versorgung unterliegen sollten, der Rest sei Sache der Psychotherapie, war ein tägliches Sammeln von Lebensfakten geworden. Fakten, die Paul sich sogar heimlich notiert hatte. Jeden einzelnen Schuldfall hatte er separat aufgelistet, und genau dieses scheinbare Interesse für den Nächsten hatte ihn so beliebt gemacht. Das hatte ihn zwar aufmerksam und geduldig für die Probleme anderer werden lassen, hatte ihm zusätzlich zu seinen Fähigkeiten auch den guten Ruf als Arzt eingebracht, den er trotz seiner Jugend schon genoss, aber es hatte sein Schuldgefühl nicht vermindert. Niemand ahnte etwas von seinem eingefleischten Schuldbewusstsein, das hartnäckig in ihm lagerte und bisher jeder Erschöpfung widerstanden hatte. Außer seinem Vater! Dieser hatte nicht nur geahnt, er hatte gewusst. Denn er hatte seinen Sohn, von frühester Kindheit an, für den Tod der Mutter verantwortlich gemacht und ihn nie wieder dieser Schuld enthoben. So war Paul regierbar gewesen, bis Aisha und die Liebe in seinem Leben aufgetaucht waren. Es war ihm wenig Zeit mit dieser heilenden Kombination geblieben, schon hatte sich die nächste große Schuld in die Startlöcher gestemmt. Der Tod Aishas.