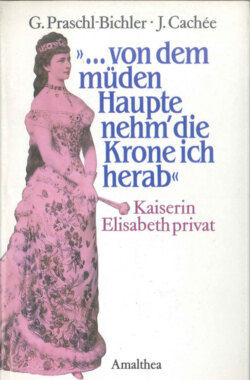Читать книгу "...von dem müden Haupte nehm' die Krone ich herab" - Gabriele Praschl-Bichler - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2 »… im Sommer zog sie die Schuhe über die nackten Füße und trug das Kleid unmittelbar auf dem nackten Körper.« (Gräfin Larisch-Wallersee über ihre Tante, die Kaiserin) Die Garderobe der Kaiserin
ОглавлениеAls Herzogin Elisabeth in Bayern kurz vor ihrer Vermählung stand, erhielt sie wie jede andere Prinzessin oder hohe Bürgertochter von den Eltern eine entsprechende Aussteuer (im Wert von 50 000 Gulden, das entspricht einem heutigen Wert von knapp über sechs Millionen Schilling), die aber zu spät und deshalb sehr hastig zusammengestellt werden mußte, da man zunächst darauf vorbereitet gewesen war, die ältere Tochter Helene (Néné) mit Kaiser Franz Joseph zu verheiraten. Auf ihre Ausstattung hatte man viel Zeit und Mühe aufgewendet, da sie seit langem als kaiserliche Braut ausersehen war. Deshalb stellte die Garderobe Elisabeths zum Zeitpunkt ihrer Hochzeit noch kein vollständiges, dem höfischen Zeremoniell am Habsburgerhof entsprechendes Ensemble dar. Es mußte erst in den Monaten nach der Hochzeit und unter Mithilfe des Wiener Hofstaates ergänzt und vervollkommnet werden.
Zunächst wurden vierzehn Dutzend Paar (168 Stück) Strümpfe, zwanzig Paar verschiedener Handschuhe, sechs Paar Lederstiefel sowie 113 Paar Schuhe (im Gesamtwert von 700 Gulden, mehr als 85 000 Schilling, was bedeutet, daß ein Paar Schuhe um die S 760 kosteten) aus Samt, Atlas, Seide oder »Zeug« (Leinen) angeschafft, da die Kaiserin von Österreich ein Paar Schuhe oder ein Paar Handschuhe nur wenige Male tragen durfte. Bei feierlichen Anlässen mußten sie sogar mehrmals täglich gewechselt werden. »Elisabeth mußte lernen, daß eine Kaiserin zu jeder Stunde des Tages tadellos gekleidet zu sein hatte, auch wenn sie sich auf dem Lande aufhielt (das bezieht sich vor allem auf die erste Zeit nach der Hochzeit, als das kaiserliche Paar in Schloß Laxenburg wohnte) und niemand außer ihren Hofdamen sah; sie mußte lernen, daß eine Kaiserin nie ohne Handschuhe erscheinen und ein Paar Schuhe höchstens sechsmal anziehen durfte; danach standen sie ihren Zofen zu.« (Haslip, S. 87) In späteren Jahren hat sich die Kaiserin von allen Vorschriften freigemacht, die ihr nicht nur lästig gefallen waren, sondern die auch – was das Tragen immer neuer Schuhe betraf – dem Zustand ihrer ohnehin problematischen Beine und Füße nicht förderlich waren.
Der Kaiser zeigte sich von Beginn der Ehe an als großzügiger Gemahl. Laut eines Vertrags vom 4. März 1854 hatte Elisabeth von ihrem Vater 50 000 Gulden (rund 6 Millionen Schilling) Mitgift erhalten, die Kaiser Franz Joseph mit 100 000 Gulden (rund 12 Millionen Schilling) »kompensierte«. Außerdem erhielt die junge Kaiserin am Tag nach der Hochzeitsnacht zwölftausend Dukaten Morgengabe (Dukaten waren kein Zahlungsmittel, weshalb der Wert schwer umzurechnen ist), die der Kaiser der Gemahlin kraft eines alten Brauches für die eingebüßte Jungfernschaft »schuldete«. An »Spenadelgeld« (Budget für Kleider und wohltätige Spenden) waren 100 000 Gulden (rund 12 Millionen Schilling) vorgesehen, die »während der Ehe zu Ihrem eigenen Gebrauche und freien Verwendung alljährlich … in monatlichen Raten bar« auszubezahlen waren. Diese Summe sollte »lediglich für Putz, Kleider, Almosen und kleinere Ausgaben dienen, indem alle übrigen Kosten und Auslagen für Tafel, Wäsche und Pferde, Unterhalt und Besoldung der Dienerschaft und sämmtliche (sic) Hauseinrichtung von Seiner Majestät dem Kaiser bestritten« wurden. Außerdem kam Kaiser Franz Joseph für die Kosten der Reisen auf, die die Kaiserin ab dem Jahr 1860 unternahm und die sich – wegen des zahlreich mitfahrenden Personals und der hohen Mietkosten für ganze Schlösser und Wirtschaftsgebäude – immer zwischen sechzig- und achtzigtausend Gulden (rund 4,8 bis 9,6 Millionen Schilling) – beliefen. An sonstigen großzügigen Geschenken erhielt Elisabeth zahlreiche Reitpferde zu ihrer privaten Verfügung und die Kosten, die sich aus dem Bau und der Einrichtung des Achilleons (der schloßartigen Villa der Kaiserin in Korfu) ergaben, erstattet, wenn man davon absieht, daß ihr zu Ehren die Villa in Ischl umgebaut und die Villa Hermes in Lainz als Privatwohnsitz errichtet worden waren.
Wesentlich weniger Geld benötigte die Kaiserin für ihre Garderobe, die entgegen der Moden der Zeit, schlicht, praktisch und elegant zu sein hatte. Allfällige Galaroben wurden nur für bestimmte Zwecke angeschafft, und auch der Handschuh- und Schuhluxus entsprang nicht dem persönlichen Wunsch Elisabeths, sondern war – wie die Wartung der Stücke – Bestandteil der Hofetikette. Die Glacéhandschuhe (aus feinem, glänzenden Zickel- oder Lammleder) wurden von den Putzerinnen der Hofburg ständig gereinigt und in weiße Kartons verpackt. Ein bestimmter Koffer enthielt 120 Paar Handschuhe, die farblich aufeinander abgestimmt waren (weiße, schwarze und graue Stücke befanden sich zum Beispiel in einem Behälter). Zum Reiten waren stärkere, lederne Handschuhe in Verwendung, mitunter trug die Kaiserin drei Paare übereinander, um die Hände vor etwaigen Einschnitten durch die Zügel zu schützen.
Elisabeth trug auffallend schmale, handgesteppte, meist schwarze Atlasschuhe mit niederen Absätzen, die an der Seite mit Schnürbändern versehen und am oberen Rand mit schwarzer Spitze verziert waren. Bei kalter Witterung stülpte sie gamaschenartige, mit lila Seide gefütterte Lederstutzen über Schuhe oder Stiefletten. Um das Jahr 1861 bevorzugte die Kaiserin weiße Atlasschuhe mit Spitzenrosetten und Gummibändern, die die Schuhe fest zusammenhielten, oder Schnürstiefletten, die in Genf, München oder Wien maßangefertigt wurden und mit sechs Knöpfen versehen sein mußten. Ihre Seidenstrümpfe bezog Elisabeth bei der englischen Firma Swears & Wells in London.
Wahrscheinlich ab den sechziger Jahren des 19. Jahrhunderts verzichtete die Kaiserin auf einen Unterrock (und hielt es weiter so bis an ihr Lebensende), wie ihre Lieblingsnichte, die Tochter des ältesten Bruders der Kaiserin, Herzog Ludwig Wilhelm in Bayern, Gräfin Larisch-Wallersee, in ihren Erinnerungen festhält: »Tantes Wäsche war wundervoll und außerordentlich fein. Ihre Nachthemden waren ganz einfach, aber immer mit mauve Seidenbändern durchzogen und gebunden. Unterröcke trug sie nie, und bei ihren frühen Spaziergängen im Sommer zog sie die Schuhe über die nackten Füße und trug das Kleid unmittelbar auf dem nackten Körper.« (Wallersee, S. 54)
Die Sommerunterwäsche der Kaiserin bestand aus leichten Hemdchen und Beinkleidern aus Seidentrikot. Ähnliche Unterwäsche, die aus feinem Waschleder hergestellt wurde und in die sich Elisabeth einnähen ließ, verwendete sie im Winter. Das Einnähen geriet zu einem Tick und wurde auch auf die Reitkleidung übertragen, die sie – am Pferd sitzend – anpassen ließ. »(Das Reitkleid der Kaiserin) saß wie angegossen; sie wurde jedesmal, wenn sie ausritt, hineingenäht. Hiermit meine ich, daß der Schneider, nachdem sie die Taille (den oberen Teil des Kleides) angezogen hatte, den Rock darannähte. Den Grund dieser seltsamen Marotte habe ich nie einsehen können. Sie trug hohe Schnürstiefel mit winzigen Sporen und zog drei Paar Handschuhe übereinander; der unvermeidliche Fächer wurde stets in den Sattel gesteckt.« (Wallersee, S. 43) Die Schneiderin hatte große Mühe, das Einnähen zur Zufriedenheit des Hofes auszuführen, da ihr die Etikette verbat, während der Arbeit den Körper der Kaiserin zu berühren.
Was die persönliche, private Garderobe betraf, so legte Elisabeth den größten Wert auf die Reitkleidung. Sie verbrachte etliche Stunden bei ihrem Schneider »mit dem Anprobieren … denn sie war sehr schwer zufriedenzustellen und studierte den Schnitt und Wurf (der Reitkleidung) im Sattel eines Holzpferdes, das vor einem großen Spiegel stand … Tante betrachtete die Hauptaufgabe, sich gut zu kleiden, als die Pflicht einer Kaiserin. ›Die Leute erwarten, daß ich immer schön und elegant aussehe‹, sagte sie oft zu mir. ›Ich bedaure es oft, daß sie ihre Herrscher nicht in dem Gepränge vergangener Tage sehen können, wie die Könige und Königinnen der Sage. Manche Fürsten kleiden sich wie Spießbürger und bilden sich ein, ihre Würde verleihe ihnen hinreichend äußeren Glanz. Doch da irren sie sich, ihre Untertanen bedauern schmerzlich ihre geschmacklose Erscheinung …«‹ (Wallersee, S. 55)
Die Wienerin Herta Maretschek versorgte Kaiserin Elisabeth mit maßgeschneiderten Negligés und fertigte auch das Taufkissen für den Kronprinzen Rudolf an. Die Schneiderin verfügte über eine sehr erlesene Klientel, zu der auch der Bayreuther Komponist und Günstling König Ludwigs II., Richard Wagner, zählte. Er entwarf seine Haus- und Nachtkleidung selbst und übermittelte die Zeichnungen Herta Maretschek auf dem Postweg, nach denen sie zum Beispiel einen mit Eiderdaunen gefütterten Schlafrock aus rosa Atlas, Atlasstiefel oder Spitzenhemden fertigte.
Kaiserin Elisabeth trug wenig und vor allem wenig wertvollen Schmuck (Galaempfänge ausgenommen). Der Ehering steckte nicht am Finger, sondern war an einer goldenen Halskette befestigt und blieb unter den Kleidern verborgen. Auf der Lieblingstaschenuhr aus Chinasilber war der Name »Achilleus«, der Name ihres Lieblingshelden aus der griechischen Geschichte, eingraviert.
Die Uhr hing an einem Lederbändchen, an dem auch ein Miniatursteigbügel befestigt war. Am Handgelenk trug sie, da sie sehr abergläubisch war, ein Armband mit unzähligen Glücksbringern: Daran hingen ein Totenkopf, das Sonnenzeichen mit drei Füßen, eine goldene Hand mit ausgestrecktem Zeigefinger, Marienmedaillen, byzantinische Goldmünzen und zwei Medaillons (eines mit einer Locke des Kronprinzen Rudolf und eines mit dem 21. Psalm der Bibel »Dank für den Sieg des Königs David«). Diese Stücke sollten Unheil abwenden helfen. Als Brosche trug die Kaiserin sehr gerne eine in Silber ausgeführte Nachbildung eines Pferdefußes, die einer schottischen Werkstätte entstammte.
Ab dem Tod ihres Sohnes Rudolf trug Kaiserin Elisabeth nur noch Schwarz: an ihrem eigenen Todestag ein schwarzes Kleid, einen schwarzen Roßhaarhut, schwarze mit Glasperlen bestickte Schuhe und eine Reisetasche aus schwarzem Leder (mit einem metallenen, gekrönten Initial-»E« versehen), in der sie ihre persönlichen Schriften verwahrte, die sie immer mit sich führte. Ein schwarzer Fächer durfte bei keinem Ausgang fehlen. Hinter ihm verbarg sich die Kaiserin vor neugierigen Blicken. Als der Italiener Luccheni am 10. September 1898 eine zugeschliffene Dreikantfeile gegen die Kaiserin führte, hinterließ die Mörderwaffe einen dreieckigen Einstich in jenem Kleid, das sie an diesem Tag getragen hatte. Gräfin Irma Sztáray, die Hofdame und letzte Begleiterin der Kaiserin, erhielt es zum Andenken nach dem Tod ihrer Herrin; sie vermachte es dem Königin Elisabeth-Gedenkmuseum in Budapest. Heute befindet sich das Kleid im Ungarischen Nationalmuseum.