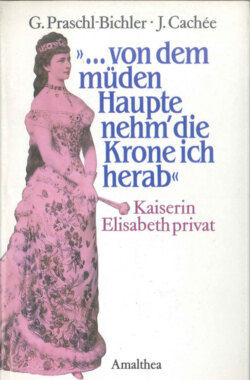Читать книгу "...von dem müden Haupte nehm' die Krone ich herab" - Gabriele Praschl-Bichler - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3 »Ich bin die Sklavin meiner Haare!« (Kaiserin Elisabeth über sich selbst) Über die Haarpflegerituale der Kaiserin
ОглавлениеEinen besonders breiten Raum in der täglichen Körperpflege der Kaiserin nahm das Frisieren ein, das meist zwei Stunden des Vormittags beanspruchte. Besser verständlich wird die – nicht anders denn als Ritual zu bezeichnende – Haarpflege, wenn man die Liebe Elisabeths zur ihrem Haar erkennt.
In der Korrespondenz zwischen ihr und dem Kaiser finden sich laufend Erwähnungen darüber. Im poetischen Tagebuch wurde dem Kopfschmuck sogar ein eigenes Gedicht gewidmet, der darin, so scheint es, die Formen eines lebenden Gebildes annimmt:
»An meinen Haaren möcht’ ich sterben,
Des Lebens ganze, volle Kraft,
Des Blutes reinsten, besten Saft,
Den Flechten möcht ich dies vererben.
O ginge doch mein Dasein über
In lockig seidnes Wellengold,
Das immer reicher, tieferrollt,
Bis ich entkräftet schlaf hinüber!«
(Wunsch, aus der Gedichtreihe »Spätherbst«)
Kaiserin Elisabeth galt nicht nur wegen der überreichen Haarfülle als eine der schönsten Frauen ihrer Zeit. Aber sie war sich ihrer Erscheinung und ihrer Schönheit völlig bewußt, und sie unterstrich sie gerne mit der für sie eigens kreierten geflochtenen Haarkrone, die sie als »Steckbrieffrisur« bezeichnete. Bereitwillig opferte sie für die Pflege und Erhaltung des kostbaren Gutes viel Mühe und Zeit, da sie es liebte, von Männern wegen ihres Aussehens angebetet zu werden, – wenn sie ihnen auch meist nicht viel mehr als das Anbeten gestattete.
Die glühendsten unter ihren Verehrern zeichnete sie mit kleinen Gunstbezeigungen aus, indem sie ihnen zum Beispiel Gehör und Aufmerksamkeit schenkte. Zu den eifrigsten Anbetern der Kaiserin zählte der persische Schah Nasr-ed-din, der in den siebziger Jahren des 19. Jahrhunderts Europa bereiste. In seinen regelmäßigen Tagebucheintragungen finden sich wenige positive Bemerkungen über die europäische Damenwelt, die er zwar großteils als hübsch, aber auch als zu geschwätzig empfand.
Eine Ausnahme bildete Kaiserin Elisabeth, die der persische Herrscher anläßlich eines Soupers in Wien kennengelernt hatte: »Laxenburg (dort war der Schah während der Dauer seines ersten Aufenthaltes einquartiert), 5. August 1873. Nun habe ich auch die Frau des Kaisers von Österreich zu Gesicht bekommen. Sie ist auf jeden Fall die schönste Herrscherin von all den Frauen an den europäischen Höfen, denen ich bisher begegnet bin. Sie hat eine wunderschöne, weiße Haut und die Gestalt einer Zypresse, eine Majestät vom Scheitel einer prächtigen Haarfülle bis zur Sohle.« Zwei Tage später traf er noch einmal auf sie und wiederholte den positiven Eindruck der früheren Begegnung: »Laxenburg, 7. August 1873 … Am Galasouper nahm auch die Frau des Herrschers teil. Sie ist, es muß bei der schon einmal getroffenen Behauptung bleiben, mit ihren vielfältigen Reizen ein Genuß für das Auge. An diesem mit Frauenschönheit nicht sonderlich gesegnetem Hof ist ihre Erscheinung ein Labsal … Ich drückte dies auch dem neben mir an der Tafel sitzenden Kaiser aus. Ich glaube, daß er sich über diese meine Feststellung gefreut hat.«
Elisabeths Dank an den persischen Potentaten bestand darin, auch ihm Sympathie entgegenzubringen und sich in seiner Gegenwart sogar zu amüsieren. »Wirkliches Vergnügen bereitete der Kaiserin (im Sommer 1873, als man unzählige Herrscher und Gesandte anläßlich der Weltausstellung empfing) jedoch nur der Schah von Persien. Seine ungezwungene Überschwenglichkeit und sein eigenartiges Benehmen gaben (der Kaiserin) in einem ansonsten recht trüben Sommer Leben und Farbe … Kaiser Franz Joseph wußte nicht, ob er (über die rüden Sitten Nasr-ed-dins) lachen oder sich ärgern sollte, aber Elisabeth war begeistert von dem Schah, dessen Auffassung vom Herrschertum dem Pflichtbewußtsein ihres Gatten so entgegengesetzt war. Der orientalische Despot tat und sagte, was ihm paßte … Der einzige Mensch, für den der Schah wirklich Interesse zeigte, war die Kaiserin …«, die sich für die Begegnungen mit ihm besonders zurechtmachte und ihm zu Ehren, der kostbare Steine liebte und sammelte, reichen Schmuck anlegte. »(Sie) trug (an einem der beiden Abende) ein weiß-silbernes Kleid mit einer purpurnen Schärpe und eine mit Amethysten und Diamanten besetzte Krone im Haar, das ihr offen in Locken über den Rücken fiel …« (Haslip, 275 f.) Eine ähnliche Beschreibung befindet sich auch im Tagebuch Schah Nasr-ed-dins, dem die Robe besonderen Eindruck gemacht hatte.
Wenn man von der Schönheit der Kaiserin spricht, meint man nicht nur ihre Gesichtszüge, sondern auch die hochgewachsene, zarte Figur, die sie mit Diäten, Sport und Gymnastik schlank erhielt, und vor allem ihr dichtes, lockiges Haar, das bis zu den Knieen reichte und auf dessen Pflege sie alle erdenkliche Sorgfalt und Raffinesse aufwendete. Eine kongeniale Dienerin fand sie in der Person der jungen Theaterfriseuse Franziska Angerer (oder Roesler – die Quellen klaffen auseinander, feststeht, daß sie nach der Verheiratung Feifalik hieß). Sie war die Tochter einer Hebamme und arbeitete schon bald nach Beendigung der Berufsausbildung an Wiener Theatern, wo sie Schauspielerinnen wie Marie Geistinger, Pauline Lucca und Katharina Schratt betreute.
Ihr Ruf als einfallsreiche Haarkünstlerin drang bis in die kaiserlichen Schlösser und erweckte eines Tages die Neugierde der Kaiserin. Sie bat Franziska Angerer/Roesler zu einem vertraulichen Gespräch, in dem sie ihr vorschlug, künftighin ausschließlich als ihre Leibfriseuse tätig zu sein, wobei sie nicht vergaß, ihr alle Vor- und Nachteile, die sich daraus ergeben sollten, aufzuzählen.
Die junge Frau willigte ein und wurde mit einem Jahresgehalt von zweitausend Gulden (rund 240 000 Schilling) eingestellt. Als sich die Friseuse in den Handlungsreisenden Hugo Feifalik verliebte und ihn heiratete, ernannte ihn Kaiserin Elisabeth spontan zu ihrem Privatsekretär, um sich von der Haarkünstlerin nie mehr trennen zu müssen. Feifalik wurde später in den Stand eines Regierungsrats erhoben, er wurde Schatzmeister des hochadeligen Sternkreuzordens (eines hohen Damenordens, dem Kaiserin Elisabeth als Schirmherrin vorstand), zum Hofrat und letztendlich sogar zum Freiherren ernannt. Dreißig Jahre lang stand das Ehepaar in den Diensten der Kaiserin. Nach dem Tod Elisabeths ging Franziska Feifalik mit dem Ruhegehalt eines Hofrats in Pension. Sie verstarb am 14. Juli 1911 in Wien.
Die Friseuse zählte während der Zeit ihrer Tätigkeit zu den besonderen Vertrauten der Kaiserin, und sie war sich ihrer bevorzugten Stellung mehr als bewußt. Sie beanspruchte eine Menge von Vorrechten und durfte sogar darauf bestehen, von der Vorleserin der Kaiserin, Ida von Ferenczy, und der Hofdame Gräfin Festetics zuerst gegrüßt zu werden, was die beiden Damen wenig erfreute.
Während des Frisierens saß die Kaiserin in einen weißen, mit Spitzen besetzten Mantel gehüllt auf einem für diesen Zweck vorbehaltenen Stuhl, während Franziska Feifalik im schwarzen Hofkleid mit langer Schleppe und mit einer weißen Schürze zunächst das Haar entwirrte und kämmte.
Einer der wenigen, die dieser Zeremonie teilhaben durften, war einer der von der Kaiserin eingesetzten Griechischlehrer, Constantin Christomanos, in dessen Erinnerungen die Frisiersitzungen einen breiten Raum einnehmen: »Die Kaiserin saß an einem Tisch, der in die Mitte des Raumes gerückt und mit einem weißen Tuch bedeckt war … mit aufgelösten Haaren, die bis zum Boden reichten und ihre Gestalt vollkommen einwickelten … Hinter dem Sessel der Kaiserin stand die Friseuse in schwarzem Kleide mit langer Schleppe, eine weiße spinnewebene Schürze sich vorgebunden … (Sie wühlte) in den Wellen der Haare, hob sie dann in die Höhe und tastete darüber wie über Samt und Seide, wickelte sie um die Arme wie Bäche, die sie auffangen möchte, weil sie nicht rinnen wollten, sondern fortfliegen, teilte die einzelne Welle mit einem Kamm aus goldgelbem Bernstein in mehrere Strähnen und trennte dann jede von diesen in unzählige Fäden, die im Sonnenlicht wie golden wurden und die sie behutsam auseinanderzog und über die Schultern hinlegte, um ein anderes Gewirr von Strähnen wieder in Goldfäden aufzulösen. Dann wob sie aus all diesen Strahlen, die aus erloschenem Gold zu Blitzen dunklen Granatrots aufflammten, neue ruhige Wellen, flocht diese Wellen zu kunstvollen Geflechten, die in zwei schwere Zauberschlangen sich wandelten, hob die Schlangen empor und ringelte sie um das Haupt und band daraus, mit Seidenfäden dieselben durchwirkend, eine herrliche Krone. Dann ergriff sie einen anderen spitzig auslaufenden Kamm aus durchsichtigem Schildkrot mit Silber beschlagen und wellte den Polster von Haaren, der am Hinterhaupt die Krone zu tragen bestimmt war, in jene Linien zurück, welche dem atmenden Meer zueigen. Dann zog sie die verwaist irrenden Strähnen über die Stirne hinab in die Nähe der Augen, so daß sie wie goldene Fransen vom Kranz der Krone herabhingen und die lichte Stirn wie ein Schleier verhüllten, entfernte mit einer silbernen Schere, was bei diesen Fäden Harmonie und Gleichheit verstörte und den ruhigen Lauf der geschwungenen Brauen nur hemmte, neigte dann andere Fäden wie schäumiges Wellengekräusel über die Ohren, damit die Roheit der Laute an ihnen sich breche, und setzte davon ein wachendes Gitter vor die Tür der Seele. Dann brachte sie auf einer silbernen Schüssel die toten Haare der Herrin zum Anblick, und die Blicke der Herrin und jene der Dienerin kreuzten sich eine Sekunde – leisen Vorwurf bei der Herrin enthaltend, Schuld und Reue der Dienerin kündend. Dann wurde der weiße Mantel aus Spitzen von den fallenden Schultern gehoben, und die schwarze Kaiserin entstieg gleich einer göttlichen Statue der bergenden Hülle.« (ebenda, S. 46 ff.)
Wenn die Beschreibung der Frisiersitzung auch sehr poetisch gefärbt ist, so scheint sie das Entstehen der Haarkrone sehr genau wiederzugeben und vor allem die Anschauung der Kaiserin von der lebenden Fülle des Haares zu treffen. Die Haarpflegegeschichten wurden wie viele andere Alltäglichkeiten von Christomanos auf eine eigene literarische Ebene gehoben, und die Kaiserin würde sich über die poetischen Worte sehr gefreut haben, hätte sie erfahren, welchen Stellenwert das Frisierritual auch im Leben des Griechischlehrers einnahm. Bei Christomanos tauchen immer wieder Erinnerungen an die mit Vortrag und Lektüre verbundenen Frisierstunden auf, mehrmals läßt er die Kaiserin selbst über ihr Haar philosophieren: »›Ich fühle mein Haar‹, sagte sie mir, und dabei ließ sie einen Finger unter seine Wellen gleiten, wie um ihren Kopf von der Last zu erleichtern. ›Es ist wie ein fremder Körper auf meinem Kopfe.‹ – ›Majestät tragen das Haar wie eine Krone anstatt der Krone.‹ – ›Nur daß man sich jener anderen leichter entledigen kann‹, erwiderte sie mit bekümmertem Lächeln.« (ders., S. 49)
Zum Kämmen benutzte die Friseuse einen Kamm aus Bernstein und einen mit Silber beschlagenen, sogenannten »Wunderkamm«, der nach Überzeugung der Kaiserin jeden Haarausfall verhinderte. Mit einer silbernen Schere wurden ein- bis zweimal pro Monat die Stirnfransen egalisiert. Am Ende des Frisierrituals mußten die ausgekämmten, »toten« Haare auf einer silbernen Schüssel zum Anblick dargereicht werden, wofür die Friseuse je nach Menge mehr oder weniger vorwurfsvolle Blicke empfing. Um die Laune der Kaiserin nicht unnötig zu strapazieren, hatte Franziska Feifalik einen Trick ersonnen, der ihr den Abgang wesentlich erleichterte: sie befestigte unterhalb ihrer Schürze einen mit Klebemittel versehenen Streifen, der die ausgegangenen Haare festhielt, die sie während des Kämmens geschickt verschwinden hatte lassen.
Kaiserin Elisabeth war von Kindheit an gewohnt, mit dem Hauspersonal rüde umgehen zu können, und es geschah nicht selten, daß die Friseuse, bevor sie sich den Trick mit dem Klebeband zueigen gemacht hatte, für das eine oder andere verlorengegangene Haar eine Ohrfeige empfing. Für ungerechte Behandlung rächte sich Franziska Feifalik, indem sie auf ein anderes bewährtes Mittel zurückgriff und das Elisabeth erstaunlicherweise – wie viele Launen ihrer Günstlinge – duldete: »Heute sagte sie (die Kaiserin zum Griechischlehrer) beim Frisieren: ›Sie müssen mich entschuldigen, heute bin ich zerstreut. Ich muß meinen ganzen Geist auf die Haare verwenden: denn sie (die Friseuse) hat sich krank gemeldet, und die junge Dame hier (das Kammerfräulein) ist noch nicht so eingeweiht in alle Mysterien. Nach einigen solchen Frisiertagen bin ich wieder ganz mürbe. Das weiß Jene und wartet auf eine Kapitulation.« (Christomanos, S. 63)
Sogar Kaiser Franz Joseph durchschaute die Tricks der Friseuse, die er als pflichtergebener Mensch nicht guthieß, und in der Korrespondenz zwischen ihm und Katharina Schratt tauchen immer wieder Bemerkungen auf, wo er sich über das Betragen der Friseuse kritisch äußert: »Frau v. Feifalik ist bei der Abreise von Corfu wieder krank geworden und wurde hier vom Bahnhofe ins Schloß in einem Wagen der Rettungsgesellschaft transportirt, es geht ihr aber schon so weit besser, daß sie Morgen die Frisur der Kaiserin mit dem Diadem wird machen können. Es ist ein Elend, wenn man so vom Befinden, manchmal auch von den Launen einer Person abhängt!« (Ofen, 2. Mai 1896)
In einem leicht spöttelnden Ton nahm Kaiser Franz Joseph schon zwei Jahre früher auf die labile Gesundheit der Friseuse Bezug, die mit ihrem Kränkeln sicherlich Elisabeth nachahmte: »Sehr glücklich war ich, durch ein Telegramm Berzeviczys Deine (der Kaiserin) Ankunft in Corfu zu erfahren, nach ruhiger Seereise, daher wird auch die schöne Franzi (Feifalik) noch keine Seekrankheit gelitten haben.« (Brief Kaiser Franz Josephs an seine Gemahlin aus Landskron vom 6. September 1894)
Nach dem Durchkämmen der Haare flocht Franziska Feifalik unter den kritischen Blicken der Herrscherin die kunstvollen Kronenfrisuren, die bei festlichen Anlässen und Hofbällen mit Diamantsternen, einer Kamelienblüte oder Agraffen geschmückt wurden und die zu ihrer Zeit von den Damen der Gesellschaft – vor allem aber von den Schwestern Elisabeths, die in Italien, Frankreich und Deutschland lebten – kopiert wurden. Wenn sich die Kaiserin nach vollendetem Werk von ihrem Stuhl erhob, sank die Friseuse unter einem feierlich gehauchten »Zu Füßen Eurer Majestät ich mich lege!« in einen tiefen Kniefall, um in dem ewigen Ränkespiel zwischen ihr und Kaiserin Elisabeth die untergebene Rolle zumindest anzudeuten.
Während des Frisierens trug Franziska Feifalik weiße Handschuhe, die Nägel mußten kurz geschnitten und die Finger unberingt sein. Diese Idee hatte Kaiserin Elisabeth vom Hoffriseur der französischen Kaiserin Eugénie, der Gemahlin Napoleons III., übernommen. Der französische Haarkünstler hieß Leroi und zählte zu den Meistern seines Fachs. Seine Kundinnen entstammten der Aristokratie und dem gehobenen Bürgertum, von denen eine einmal im Vorraum seines Ladens ihrer Zofe klagte, daß sie es als sehr unangenehm empfände, wenn der Friseur mit seinen Händen nacheinander in die Haare der verschiedensten Kundinnen griff, um danach auch an ihr Haar zu fassen.
Leroi, der zufällig Ohrenzeuge des Gesprächs geworden war, nahm sich den Vorwurf zu Herzen und erstand einige Dutzend Paar Glacéhandschuhe für sich und die Angestellten seines Frisiersalons, ließ jedes Paar mit dem Namen einer Kundin versehen und seine Klientel fortan nur noch behandschuht betreuen. Kaiserin Eugénie, die von den Künsten Lerois gehört hatte und die auch die neue Idee, mit den Handschuhen frisiert zu werden, begeistert aufnahm, ernannte Leroi zu ihrem Leibfriseur, der sie in Hinkunft überallhin begleitete.
Kaiserin Elisabeth, die mit Kaiserin Eugénie ausschließlich in modischen Belangen Kontakt hielt, übernahm sofort die neue Methode mit den Handschuhen, die künftighin jeder, der an ihr Haar faßte, zu tragen hatte. Auch die drei Kammerfrauen, die allabendlich die kaiserliche Zopfkrone entflochten, kämmten Elisabeth behandschuht. Das offene Haar wurde der zu Bett gehenden Kaiserin einer Schleppe gleich nachgetragen und anschließend am oberen Ende des Bettes vorsichtig ausgebreitet. Mit einer Kopfrolle im Nacken verbrachte die Kaiserin – einer Statue gleich unbeweglich liegend – die Nacht. Das sollte verhindern, daß die Haarsträhnen sich verwirrten oder daß sich ein Haar aus der Fülle löste und »starb«.
Ein- oder zweimal im Monat – gemäß den Aufzeichnungen der Nichte der Kaiserin, Marie Larisch-Wallersee, einmal, gemäß den Tagebucheintragungen des Griechischlehrers, Constantin Christomanos, zweimal – jeweils an einem Freitag, fand die Haarwäsche statt. An diesem Tag hatte das gesamte Kammerpersonal zur Verfügung zu stehen, und niemand, selbst Franz Joseph nicht, durfte die Kaiserin sprechen. Elisabeth, die die Haarwaschrituale kokett mit der Bemerkung »Ich bin die Sklavin meiner Haare!« einzuleiten pflegte, trug während der Zeremonie einen eigens dafür gefertigten, wasserdichten, bodenlangen Mantel. Franziska Feifalik bereitete eine Waschmischung aus etwa dreißig rohen Eidottern und Franzbranntwein. Dieses Shampoon wurde mit einem Pinsel auf die über einen Tisch ausgebreiteten Haarsträhnen aufgetragen und mußte eine Stunde lang einwirken. Danach wurde das Haar mit warmem Wasser gewaschen und mit dem Sud von ausgekochten Walnußschalen nachgespült. Eine letzte Spülung mit Rosenwasser beendete das Waschprogramm. Etliche Stubenmädchen nahmen die Kaiserin mit vorgewärmten Mousseline-Tüchern in Empfang, um das Haar zu frottieren oder warme Luft zuzufächern.
Bemerkungen über die Haarwaschtage ziehen sich durch die »Familienliteratur« (Tagebücher und Korrespondenzen) wie ein roter Faden: »Einmal im Monat wurden Elisabeths schwere kastanienbraune Zöpfe mit rohem Ei und Branntwein gewaschen und nachher mit einem ›Desinfektionsmittel‹, wie sie es nannte, abgespült. Nach der Waschung ging die Kaiserin in einem langen, wasserdichten Seidenmantel auf und nieder, bis ihr Haar getrocknet war. Die Frau, die das Amt der Friseurin übte, sah man nie ohne Handschuhe … Die Ärmel ihres weißen Kleides trug sie ganz kurz. Es ist durchaus keine Sage, daß die Haare auf Tante Sissis Kopf numeriert waren.« (Wallersee, S. 53 f.) Auch im Briefwechsel zwischen Kaiser Franz Joseph und seiner Gemahlin finden sich Bemerkungen über die Haarwaschtage, mitunter durchkreuzten sie sogar die Pläne des Kaisers, wie aus einem Brief an Katharina Schratt hervorgeht, der man wegen eines unaufschiebbaren Haarpflegetermins ein nur an einem bestimmten Tag mögliches, gemeinsames Essen zu dritt absagen mußte.
Auch bei Christomanos finden sich diesbezügliche Eintragungen: »Heute hat mich die Kaiserin erst um 4 Uhr nachmittags zu sich rufen lassen, anstatt um 11 Uhr mit mir nach Schönbrunn auszufahren. Der ganze Vormittag war der Waschung des Haares gewidmet worden. Dies geschieht alle 14 Tage. Deswegen trug sie das Haar jetzt offen über den Rücken, damit es trocken würde. Ihr Anblick in solcher Gestalt, wenn sie die Krone aufgelöst hat und nicht mehr die Stirn unter ihrem Gewicht neigen muß, ist womöglich noch anmutiger und dabei majestätischer, ihrem wahren Wesen angemessener.« (ders., S. 53)
Das Waschprogramm mußte mit dem seelischen Zustand der Kaiserin harmonieren. Abweichungen wurden wie viele dieser kleinen Rituale des Alltags vom Kaiser sorgfältig festgehalten: »Der deutlichste Beweis, wie krank Du warst, ist für mich, daß Du dir erst jetzt zum ersten Male seit Wien den Kopf waschen ließest, aber daß Du es bereits thun konntest, ein erfreuliches Zeichen, daß es Dir wirklich besser geht.« (aus einem Brief des Kaisers an seine Gemahlin – Wien, 11. Februar 1898)
Im Mai 1898 weilte Kaiserin Elisabeth für die Dauer einer Kur in Bad Brückenau, weshalb an die Kurverwaltung der Auftrag erging, bei den Bauern der Umgebung einhundert frische Eier zu ordern, die die Kaiserin damals für den angesetzten Haarwaschtag benötigte. Außerdem mußte ein Eimer reinsten Wassers, das der Apotheker von Bad Brückenau in einem mehrstündigen Vorgang zu destillieren hatte, um die gewünschte Qualität anbieten zu können, bereitgestellt werden. Der letzte große Haarwaschtag fand am 7. September 1898 (drei Tage vor dem Tod der Kaiserin) im Hotel Caux bei Montreux statt.
Als Kaiserin Elisabeth sich anläßlich der Trauung (in Stellvertretung) ihrer Schwester Marie Sophie, der späteren Königin von Neapel und nachmaligen Heldin von Gaeta, im Jahr 1858 in Triest aufhielt, bezog sie im alten Regierungsgebäude einige für sie vorbereitete Räume. Der damalige Statthalter Baron Mertens und seine Gemahlin überboten sich im Diensteifer für die Kaiserin. Als eines Tages die mitgeführte Friseuse Franziska Feifalik unwohl war, so daß sie ihre künstlerische Tätigkeit nicht ausüben konnte, ereiferte sich das Ehepaar Mertens in der Suche nach einer würdigen Ersatzfriseuse. Ein einheimisches, geschicktes Mädchen wurde gefunden, das das Haar der Kaiserin mit angstvoller Sorgfalt kämmte, da sie gehört hatte, daß jedem ausgegangenen Haar viel Bedeutung beigemessen wurde. Mit zitternden Händen strich sie mit dem Kamm durch das dichte Haar der Kaiserin und hegte plötzlich den innigen Wunsch, ein, zwei Haare zur Erinnerung an den Tag behalten zu wollen. Nach Beendigung der Arbeit wollte sie sich von keinem der am Kamm haftenden Haare trennen, die sie auf der Silbertasse des Toilettetischs ablegen sollte, sondern steckte sie alle mit einem kühnen Griff in den Mund. Die Kaiserin, die das Manöver in einem Spiegel mitverfolgt hatte, verwunderte sich darüber und fragte das Mädchen nach dem Zweck dieser Tat. Die ertappte Friseuse warf sich daraufhin, um Verzeihung bittend, auf die Kniee und gestand ihr unwiderstehliches Verlangen, zur Erinnerung an den Tag kaiserliches Haar behalten zu wollen. Elisabeth, die darüber gerührt war, antwortete mit einer für sie einzigartigen Geste: sie nahm die Silberschere vom Toilettetisch, schnitt aus der Haarfülle eine Locke heraus und überreichte sie dem in Tränen aufgelösten Mädchen zum Geschenk.