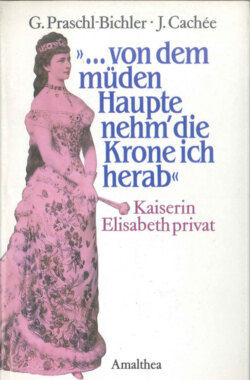Читать книгу "...von dem müden Haupte nehm' die Krone ich herab" - Gabriele Praschl-Bichler - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4 »(Vor dem Spiegel) standen die zwei Kaiserinnen und nahmen an ihren Waden Maß …« (Graf Hanns Wilczek über die »Wadenkonkurrenz« zwischen Kaiserin Eugénie von Frankreich und Elisabeth) Über den Körperkult Elisabeths
ОглавлениеZu den äußerst delikaten Aufgaben Franziska Feifaliks gehörte auch der sogenannte »Vermessungsdienst«. Als die Kaiserin immer besorgter auf Körpergewicht und Figur zu achten begann, mußte die Vertraute jeden Morgen und jeden Abend Taille-, Waden- und Schenkelumfang der Kaiserin messen und die Werte in ein eigenes Buch eintragen. Anläßlich des Treffens von Kaiser Napoleon III. und Kaiser Franz Joseph im August 1867 in Salzburg fand sogar eine »Vermessungskonkurrenz« zwischen den beiden Kaisergemahlinnen, Eugénie und Elisabeth, statt, an der – unbeobachtet – ein geheimer Zeuge teilnehmen durfte. Graf Hanns Wilczek, der Kaiserin Eugénie als Dienstkämmerer zugeteilt worden war, erzählt in seinen Erinnerungen von der delikaten Begebenheit, die in einer sich betont puritanisch gebenden Zeit ihresgleichen sucht: »Als ich eines Tages im Vorzimmer der Kaiserin Eugénie Dienst hatte und auf ihre Anweisungen wartete, kam sie plötzlich auf mich zu und sagte: ›Die Kaiserin (von Österreich) kommt mich gegen Mittag besuchen. Ab diesem Zeitpunkt hat die Türe zu meinem Zimmer für alle Leute verschlossen zu bleiben. Ich bitte Sie ausdrücklich, niemanden durchzulassen, wer immer auch kommt.‹ Eine Dame aus Frankreich, die die Kaiserin begleitete, verabschiedete sich, und einige Minuten später betrat die (österreichische) Kaiserin in voller Pracht ihrer Schönheit das Vorzimmer. Sie befahl mir, sie bei der (französischen) Kaiserin zu melden. Das tat ich auch, und nachdem die (österreichische) Kaiserin eingetreten war, verharrte ich ergeben auf meinem Posten. Ich mußte niemanden abweisen, da niemand kam. Ungefähr eine Viertelstunde später erschien Kaiser Napoleon. ›Ist Ihre Majestät die Kaiserin in Ihren Zimmern? Wenn ja, so bitte, melden Sie mich sofort bei ihr, da ich mit ihr eine sehr wichtige Unterredung zu führen habe.‹ – ›Es tut mir sehr leid, Sire, aber die Kaiserin empfängt im Moment niemanden. Sie hat mir Befehl gegeben, die Türe zu Ihrem Zimmer strengstens zu bewachen.‹ – ›Mein lieber Graf, wenn ich sie zu sprechen wünsche, wird sie mich sicherlich empfangen.‹ Er unterstrich diese Anweisung mit einer Geste seiner Hand, und es blieb mir also keine andere Wahl, als hineinzugehen und sein Kommen zu melden. Sehr leise öffnete ich die Türe und mußte durch zwei leere Zimmer und sogar durch das Schlafzimmer in das Umkleidezimmer gehen, zu dem die Türe halb geöffnet war. Der Türe gegenüber war ein großer Spiegel, und mit dem Rücken zu meinem Aussichtspunkt standen die zwei Kaiserinnen und nahmen an ihren Waden Maß – wahrscheinlich an den wohlgeformtesten, die Europa zu dieser Zeit kannte! Die Szene war unbeschreiblich, und ich werde sie mein ganzes Leben lang nicht vergessen. Aber ich hatte sie zu Ende zu bringen, weshalb ich die Türe leicht bewegte. Die beiden Kaiserinnen drehten sich um und lachten sehr gnädig, als sie mich erblickten. Kaiserin Eugénie sagte: ›Oh, natürlich, Kaiser Napoleon möchte mich sprechen. Sagen Sie ihm bitte, daß er fünf Minuten warten soll.‹ Und er mußte tatsächlich fünf Minuten warten, bis er vorgelassen wurde.« (Wilczek, S. 71 f.)
Ebenso wie die tägliche Vermessung der Taille, der Schenkel und der Waden gehörte das dreimal tägliche Wägen zum fixen Bestandteil des Schönheitsprogramms. Die Kaiserin ließ alle Ergebnisse in Listen festhalten und reagierte bei der geringsten Gewichtszunahme mit strengen Maßnahmen: Sofort wurden die Essensmengen herabgesetzt, was bewirkte, daß Elisabeth bei einer Körpergröße von 172 Zentimetern ihr Leben lang zwischen fünfundvierzig und fünfzig Kilogramm wog.
Wie jede Zeit der Geschichte brachte auch das 19. Jahrhundert zahlreiche Methoden der Schlankerhaltung hervor, die die Kaiserin dankbar annahm und eifrig anwandte. So schlief sie zum Beispiel oftmals »mit feuchten Tüchern oberhalb der Hüften, um ihre Schlankheit zu bewahren …« (Wallersee, S. 53), oder sie trank eine Mixtur, die aus mit Salz gewürztem, rohem Eiweiß von fünf bis sechs Eiern bestand. Ein anderes bevorzugtes Diätmittel stellte süße und saure Kuhmilch dar. Der Kaiser erstand dafür besonders qualitätvolle Kühe, die jeweils im Schönbrunner Tirolergarten untergebracht wurden. Als Ende September des Jahres 1895 neu angekaufte Tiere geliefert wurden, überzeugte sich Kaiser Franz Joseph an Ort und Stelle vom Zustand und der Qualität der Kühe, was er der Gemahlin in einem Brief vom 29. September mitteilte: »Gestern waren wir (der Kaiser und Katharina Schratt) im Tiroler Garten, wo wir die beiden neuen Kühe, Deinem Befehle gemäß, ansahen, die mir sehr gut gefielen. Auch kosteten wir kuhwarme Milch von der Kuh aus Aix-les-Bains, die ich besonders gut fand. Es war keine Zeit, auch noch die andere Kuh melken zu lassen, da ich in die Stadt mußte, aber Heute nach der 7 Uhr Messe kommt von jeder der beiden Kühe eine kleine Flasche Milch zur Freundin, um daß wir kosten können.«
Fortan produzierten die beiden Tiere Milch ausschließlich für die Kaiserin, die ihr kuhwarm in einem dafür eigens geschaffenen Deckelglas serviert werden mußte. Die Kühe begleiteten die Kaiserin auf den meisten Schiffsreisen, ebenso wie anfänglich auch Ziegen (wegen der begehrten Milch) mit im Schiffsgepäck waren. Da die Tiere das Reisen auf hoher See aber nicht gewohnt waren, wurden sie bald seekrank und gaben in der Folge keine Milch mehr.
Wenn sich die Kaiserin auf Reisen befand, wohin die Kühe nicht mitgenommen werden konnten, wurden die Tiere in Lipizza, dem Gestüt der Spanischen Hofreitschule, untergebracht, wo man sie täglich auf ihren Gesundheitszustand überprüfte.
Außerdem hatte es sich die Kaiserin zur Gewohnheit gemacht, in Bad Ischl oder in ihrer Heimat rund um den Starnberger See in Bauernhäusern oder Almwirtschaften einzukehren, die sie während ihrer Spaziergänge streifte, und sich nach dem Gesundheitszustand der Kühe zu erkundigen. Wenn sich die Tiere wohl befanden, ließ sie sich gerne ein Glas Milch kredenzen.
Einen fixen Bestandteil des täglichen Pflegeprogramms nahm die Behandlung des Teints ein, den die Kaiserin – der Jahreszeit und dem Aufenthaltsort entsprechend – mit den verschiedensten Mitteln behandelte. Üblicherweise wurde das Gesicht morgens mit Cold-Cream (Hautpflegemittel, halbfette Creme mit hohem Wassergehalt, durch dessen Verdunstung sie kühlend wirkt), Kampfer (alkoholische Lösung für Einreibungen) und Borax (Desinfektionsmittel) leicht massiert, bei stärkerer Sonnenbelastung legte Elisabeth Gesichtsmasken aus gereinigtem Honig oder aus Topfen auf, die zwei Stunden lang einwirkten. Die Sonnenstrahlen selbst wurden mit allen möglichen Mitteln bekämpft, wie die Nichte der Kaiserin in ihren Erinnerungen beschreibt: »Obwohl das Sonnenlicht Elisabeths Schönheit verklärte, fürchtete sie es und trug stets einen wunderlichen blauen Schirm an ihrem Hute zur Abwehr gegen Sonnenbrand und Sommersprossen; auch am Abend hatte sie immer einen Fächer zur Hand, zum Schutze ihres Gesichts.« (Wallersee, S. 5 f.) Trotzdem scheint die Kaiserin durch die vielen Seereisen mitunter sehr braun gebrannt gewesen zu sein und litt mit zunehmendem Alter an starken Falten und trockener Haut.
Während der Erdbeerzeit bestrich die Kaiserin Gesicht und Hals mit zerdrückten Erdbeeren oder mit einer extra für sie hergestellten Erdbeersalbe, einer Mischung aus mit – antibakteriell wirkender – Salizylsäure eingekochten wilden Erdbeeren und Vaseline (ölartige Salbengrundlage). Um Körper und Haut geschmeidig zu halten, nahm die Kaiserin warme Olivenölbäder. Vor dem Zubettgehen wurden mitunter frische, dünngeschnittene Kalbsschnitzel auf Wangen, Stirn und Dekolleté aufgelegt, die neben den aufgelösten, sorgfältig drapierten Haaren und den feuchten Wickeln um die Hüften mit ein Grund waren, daß Elisabeth etliche Nächte unbeweglich auf dem Rücken liegend verbrachte.
Mitesser bekämpfte die Kaiserin nach einer Methode des Leibarztes der Königin Marie Leszczynska, der Gemahlin König Ludwigs XV. von Frankreich: Dugrain empfahl zunächst ein Wasserbad mit Seife, wonach man die Haut mit einer Salbe eincremte, die aus einem Eßlöffel Honig, zwei Löffeln Bierhefe und zwei Löffeln Weizenmehl bereitet worden war. Diese Paste mußte einige Zeit einwirken gelassen werden und wurde danach wieder abgewaschen. Außerdem neigte Elisabeth zu Leberflecken, die sie – einer Empfehlung der Ärzte folgend – behandelte, indem sie wochenlang nur vegetarische Kost zu sich nahm.
Alle Schönheitsmittel, Salben und Tinkturen führte die Kaiserin auf ihren Reisen in einem eigenen Holzkoffer mit, der auch noch Phiolen mit Majoran, Lavendel, Quendel (Thymianart) und Rosmarin enthielt. Parfum verwendete sie nie, da sie starke Düfte nicht ertragen konnte. Die einzige Ausnahme bildete pulverisiertes Irisparfum, das man, in kleine Leinenbeutel gefüllt, zwischen die Wäschestücke legte.
Während der zahlreichen Kuren erweiterte Elisabeth auch das tägliche Pflegeprogramm, das am frühen Morgen mit einer Trockenbürstemassage bei offenem Fenster eingeleitet wurde. Danach ließ sich die Kaiserin mit einem Präparat aus Rindergalle, Alkohol und Glyzerin (Bestandteil aller natürlichen Fette) einreiben (Elisabeth wurde aber auch, wenn sie sich nicht auf Kuren befand, bis zu zweimal täglich mit den verschiedensten Essenzen massiert). Danach folgte ein laues Bad in ausschließlich destilliertem Wasser und – während der Kuraufenthalte – eine weitere Massage, wobei der Körper diesmal mit Puder eingerieben wurde. Ein leichtes Frühstück mit Zwieback und Kräutertee (die Kaiserin trank niemals schwarzen Tee oder Kaffee) und ein etwa zweistündiger Spaziergang beendeten das morgendliche Pflegeprogramm. Anschließend ruhte die Kaiserin auf einem Sofa, für die Füße standen warme Ziegelsteine bereit.
Während der Kuraufenthalte wurden abends Fichtennadelvollbäder und Wechselfußbäder genommen. Viermal wöchentlich ließ die Kaiserin einen Leibwickel bereiten, den sie in der Nacht während drei Stunden anbehielt.
Eigener Pflegeprogramme und Vorbereitungen bedurfte es auch vor den Ausritten, die mit einer besonderen Mahlzeit eingeleitet wurden: »Ehe es zur Jagd ging, genoß Elisabeth eine seltsame Suppe. Sie bestand aus einer Mischung von Rindfleisch, Huhn, Reh und Rebhuhn, alles durcheinander gekocht. Dieser Extrakt war stärker als die stärkste Kraftbrühe. Zu der Suppe trank sie zwei Glas Wein …« (Wallersee, S. 43) Was den Speiseplan der Kaiserin betrifft, so hielt sie sich dabei an das Menuprogramm der englischen Jockeys, die als Hauptnahrungsmittel beinahe rohes Beefsteak zu sich nahmen und denen Mehlspeisen verboten und Brot nur in geringen Mengen erlaubt waren. Im Reitzeug führte die Kaiserin stets eine mit Fleisch gefüllte Silberbüchse mit, die in einem ledernen Futteral steckte.
Vor der Reitermahlzeit nahm Elisabeth gewöhnlich ein Bad, das mit einem aus Korfu stammenden Extrakt versetzt wurde. Die Schwester der Kaiserin (Marie Sophie, Königin von Neapel) bezeichnete es gern als »Gladiatorenbad«, da dieses Spezialöl die beste Wirkung in extrem heißem Badewasser entfaltete, das der Badende gerade noch imstande war zu ertragen. Dem Bad folgte eine Massage mit sogenanntem Muskelwasser, das etwaige Spannungen lösen sollte. Captain Middleton, der bevorzugte englische Jagdbegleiter der Kaiserin, versorgte ihren Haushalt mit etlichen Fässern dieses Wassers.
Entgegen allen Erwartungen schlug Kaiserin Elisabeth das sportliche Leben nicht gut an, das sie bis zum Exzeß betrieb: Der Reitsport, bei dem sie sich dem Trainingsprogramm der Jockeys unterwarf, die Schwitzkuren, die zahlreichen Diäten, das Fechten, das Mehr-Laufen als Spazierengehen schädigten allmählich den Körper und das Nervensystem der Kaiserin, was schwere Schweißausbrüche an Händen und Füßen zur Folge hatte. Während man dieses Übel mit einer Mischung aus Lärchenschwamm- und Ysoptee (Ysop ist ein im Mittelmeerraum vorkommender Strauch, der früher als Heil- oder Gewürzpflanze kultiviert wurde) bekämpfen konnte, gab es wenige Heilungsmethoden für die körperlichen Schäden (Ischias, Rheuma, starke Gliederschmerzen), weshalb Elisabeth mit zunehmenden Jahren vor allem auf den regelmäßig betriebenen Reitsport verzichten mußte.