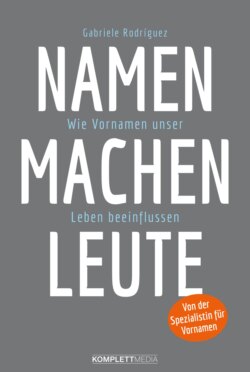Читать книгу Namen machen Leute - Gabriele Rodríguez - Страница 6
ОглавлениеEINFÜHRUNG
Ich begann meine Arbeit im Jahr 1994 in einem riesigen Büro in der neunten Etage des ehemaligen Universitätshochhauses. Mit einer Schreibmaschine, einem Telefon, einigen Namenbüchern, Akten mit Gutachten und einer Datenbank, die aus losen Karteikarten mit Vornamen bestand. Im ersten Jahr bekam ich rund 100 Anfragen zu Vornamen und etwa 50 Anfragen zu Familiennamen.
Die Namenforschung oder auch »Onomastik« hat eine lange Tradition an der Universität Leipzig. Seit etwa 100 Jahren wird auf diesem Gebiet geforscht, und seit 1991 ist es möglich, das Fach an der Universität Leipzig zu studieren. Im Jahr 1990 wurde darüber hinaus die »Deutsche Gesellschaft für Namenforschung e.V.« gegründet.
Aber schon seit den 1960er-Jahren existiert eine Namenberatungsstelle, die Auskunft zu allen Fragen rund um das Thema »Namen« gibt. Lediglich zwischen 1990 und 1994 musste sich unsere Universität neu sortieren und orientieren.
Da sich jedoch ein großer Bedarf an Beratung vor allem zu Personennamen zeigte, wurde die Stelle im Jahr 1994 neu eingerichtet – anfänglich als ABM-Maßnahme. Mehr oder weniger zufällig bekam ich diesen Posten, nachdem mein Universitätsvertrag ausgelaufen war und ich zwei Jahre in einem Projekt der Zentralstelle für Genealogie gearbeitet hatte. Zuvor hatte ich nie etwas von Namenberatung gehört.
Im Jahr 1995 berichtete eine Journalistin der Deutschen Presse- Agentur (dpa) über meine Arbeit und über die ersten kuriosen Namenwünsche wie Crazy Horse und Borussia, die ich bearbeitete. Danach wurden die Anfragen immer mehr. Sie kamen aus ganz Deutschland und dem Ausland (vor allem aus Österreich und aus der Schweiz).
Um die Stelle langfristig zu finanzieren, haben wir im Jahr 1999 Gebühren für schriftliche Auskünfte und Gutachten eingeführt. 2001 kam ein gebührenpflichtiges Telefon dazu. Und das kam so: Am 26. Oktober 2001 stand mein Telefon nicht still. Alle wollten Auskünfte zu den männlichen Vornamen Jaden und Gil haben. Reporter von Fernsehen und Radio standen Schlange für ein Interview. Ich dachte damals, wir müssten einen dieser Automaten haben, an dem sich jeder eine Nummer ziehen kann. Grund war die Geburt des Sohnes von Steffi Graf und Andre Agassi – und seine Vornamen, eben Jaden und Gil, denn die kannte hierzulande niemand.
Dabei gab es den alten friesischen Namen Jaden, sowie die Kurzform Gil von Gilbert oder Gilian schon viel früher. An diesem Tag im Oktober habe ich kein einziges Gutachten schreiben können. Ich gab nur mündliche Auskünfte. Kostenfrei. Am Abend sagte ich, schon leicht ermattet, zu meinem damaligen Chef, Professor Jürgen Udolph: »Wenn wir jetzt Geld für jede Auskunft bekommen hätten, dann hätte sich das gelohnt.« Er kam dann auf die Idee, ein kostenpflichtiges Beratungstelefon für mündliche Auskünfte einrichten zu lassen, um unsere Arbeit zu finanzieren.
Der Alltag einer »Namenberaterin«
Auch nach über 20 Jahren, die ich nun mit dem Thema »Namen« verbringe, wird es mir nicht langweilig. Ich lerne immer neue Namen und Aspekte der Namengebung kennen. In der ersten Zeit meiner Tätigkeit musste ich noch viel über fremde Namensysteme dazulernen. Zwar wurde ich in meinem Studium der Sprachwissenschaft mit vielen Sprachen konfrontiert, aber mit Namen eher weniger. Zugutekamen mir mein Studium der Slawischen Philologie (mit Spezialfächern wie etwa »Tatarisch«) in der damaligen Sowjetunion und ein Erweiterungsstudium der Romanistik.
Es ist schon ziemlich hilfreich, mehrere Sprachen zu sprechen.
In den ersten Jahren konnte ich mir noch nicht vorstellen, dass Eltern ihren Kindern einmal Namen aus den entlegendsten Gegenden der Welt geben würden. Ich bekam viele Anfragen zu Vornamenlisten. Die einen wollten französische Vornamen, die anderen japanische Vornamen, wieder andere hawaiische Vornamen. Manche suchten Vornamen aus der schöngeistigen Literatur. In den 1990er-Jahren gab es noch nicht so viele Vornamenbücher wie heute. Die Eltern waren auf der Suche nach einem besonderen Namen, den sie aber in diesen Büchern nicht fanden. Auch war damals die Suche im Internet noch nicht möglich oder unüblich.
Man findet ja heute im Internet Namen aus der ganzen Welt. Es gibt zahlreiche Vornamenseiten und Foren. In den 90er-Jahren hatte ich noch mehr Zeit und habe vielen Eltern mit ganz speziellen Namenlisten geholfen. Die Wartezeit beim Arzt habe ich zum Beispiel genutzt, um Namenbücher nach bestimmten Vornamen bzw. nach verschiedenen Aspekten zu durchsuchen. In unserer Beratungsstelle haben wir unter anderem Listen mit Vornamen aus der schöngeistigen Literatur, romanische und griechische Vornamen, asiatische Vornamen, friesische Vornamen, »intelligente« Namen, Namen von Göttern, indianische Namen, englische und angloamerikanische Vornamen, Namen, die mit Y- und J- beginnen, männliche Vornamen, die mit D- beginnen sowie Vornamen in der Bedeutung »Gottesgeschenk« oder mit den Bedeutungselementen »Bär« und »Stärke«. Ich war schon oft sehr gefordert, da die Wünsche teilweise äußerst speziell waren. Zum Beispiel der hawaiische Name Keanu, der in den 1990er- Jahren durch Keanu Reeves, den kanadischen Schauspieler mit hawaiischen Wurzeln, nach Deutschland gekommen war. Ungewöhnlich für das Deutsche war die Endung des Namens. Ich bekam 1995 die Anfrage – und hatte keine Ahnung.
Zuerst dachte ich an die englisch-irischen Namen Kean oder Keane. Allerdings werden die ganz anders ausgesprochen. Internet hatte ich damals noch nicht, also ging ich in die Universitätsbibliothek und wälzte Bücher. In der Zwischenzeit hatte sich die Mutter eine Bestätigung des Namens aus Honolulu besorgt und legte sie mir vor. Damit war klar: Es handelt sich um einen hawaiischen Namen. Ich arbeitete mich in die Sprache und das dortige Namensystem ein, auch nachdem die Anfrage bearbeitet war. Dies hilft mir heute noch. Wenn Eltern mir erzählen, dass Tane ein hawaiischer Name sei, kann ich dies verneinen, da die hawaiische Sprache kein T kennt. Die entsprechende hawaiische Form lautet Kane. Allerdings kommt Tane im polynesischen Raum vor, nur eben nicht auf Hawaii.
Einmal suchte ein Vater für seine Tochter einen biblischen Namen mit einer besonderen Bedeutung. Ich musste passen. Solche Listen hatte ich nicht. Er erzählte mir, dass sich er und seine Frau bis zur Geburt keinen Namen für das Kind ausgesucht hätten. Sie wollten sich das Kind anschauen und dann erst nach einem Vornamen mit den Eigenschaften des Kindes suchen. Zudem sollte es ein Name aus der Bibel sein. Was tun? Ich gab ihm das Büchlein »Die Namen der Bibel« und schlug ihm vor, dieses durchzuarbeiten. Er verbrachte einen ganzen Tag in der Beratungsstelle, schrieb sich einige Namen heraus und wollte sie dann seiner Frau präsentieren. Leider habe ich nie erfahren, welchen Vornamen die Tochter bekommen hat.
Seit dieser Zeit schaue ich mir die Babys, mit denen Eltern zu mir kommen, genau an und finde, dass die meisten Eltern doch den riehtigen Namen gewählt haben – er passt. Einmal kam ein deutsch-russisches Elternpaar zu mir, die ihren Sohn Dimir nennen wollten. Die Mutter hatte einen tatarischen Migrationshintergrund und wählte diesen Namen, der übrigens auch in den Schreibformen Demir, Temur, Timur und Timor vorkommt und auf das turksprachige »temir« in der Bedeutung »Eisen, der Eiserne« bzw. auch »stark, standhaft« zurückgeht. Der kleine Junge hatte ein schönes Gesicht mit großen Pausbacken. Er war groß und kräftig. Die Bedeutung des Namens passt, dachte ich mir. Ähnlich war es bei den Eltern, die ihre Tochter Naima nennen wollten. Naima ist eine weibliche Bildung zum arabischen männlichen Namen Naim in der Bedeutung »weich, zart, zärtlich, fein; sorglos; Glück, Annehmlichkeit, glücklich im Leben«. Naima kann dann mit »die Zarte, Feine, Glückliche« übertragen werden. Im Kinderwagen lag ein kleines, sehr zartes Mädchen.
Ab und zu erhalte ich auch Anfragen von Autoren, die ein Buch schreiben. Sie suchen nach Vornamen für ihre Figuren. So spielte eine Geschichte zum Beispiel nach dem Zweiten Weltkrieg, und die Autorin fragte nach den häufigsten Vornamen 1947 und 1948 in Berlin. Auch bei solchen Anfragen versuche ich zu helfen.
Heute erkundigen sich viele Eltern bei mir, viel öfter als noch vor zehn Jahren, ob der gewählte Vorname zum Familiennamen passt, ob er vielleicht zu den sogenannten »Unterschichten-Namen« gehört oder einfach, wie ich die gewählte Namenkombination finde.
Eine Mutter rief mich beispielsweise aus dem Raum München an und erkundigte sich nach dem männlichen Vornamen Gustav. Auch dieser Name erlebt heute eine Renaissance. Das Problem der Mutter lag darin, dass die Verwandtschaft meinte, Gustav hätte in Bayern keine Tradition. Sie brauchte Gegenargumente. Gustav wurde sehr wohl auch in Bayern häufig vergeben. Belege gibt es schon seit dem 18. Jahrhundert für Süddeutschland. In München gehörte Gustav um 1900 sogar zu den zwanzig häufigsten männlichen Vornamen. Eine bekannte bayrische Koseform dieses Namens lautet Gustl, bekannt auch durch den bayrischen Schauspieler Adolf Gustav Rupprecht Maximilian Bayrhammer, genannt Gustl Bayrhammer (geboren 1922). Und mein Lieblingsmaler Gustav Klimt (geboren 1862 in Wien) trägt auch diesen Namen.
Die Eltern sind immer wieder erstaunt, was in Namen steckt bzw. wie viele Informationen ein Name enthalten kann. Ein Zeichen dafür, dass Eltern in Deutschland die Namen in der Regel nicht nach ihrer Bedeutung wählen. In den meisten Fällen sind es der Wohlklang und die positiven Assoziationen zum Namen. In bestimmten Zeiten werden ähnliche Klangmuster bevorzugt. Man nehme nur die heute beliebten männlichen Vornamen Christian, Sebastian, Florian, Julian, Fabian und Maximilian, die alle auf »-ian« enden. Mädchen werden oft auch mit dem Namen »geschmückt«. Man denke nur an die vielen weiblichen Vornamen, die auf Blumenbezeichnungen oder Edelsteinnamen zurückgehen.
DA KOMMT WAS ZUSAMMEN
Eine halbe Million Vornamen haben wir mittlerweile in unserer Datenbank. Und jedes Jahr kommen gut 1000 dazu. Heute verfügt das »Namenkundliche Zentrum« der Universität Leipzig über eine moderne Ausstattung, eine eigene Bibliothek sowie über eine digitale Datenbank, ohne die die bis zu 3000 Anfragen im Jahr nicht zu bewältigen wären. Ich habe mich mittlerweile vor allem auf Vornamen spezialisiert, gebe aber auch telefonische Auskünfte zu Familiennamen und anderen Namenarten.
Seit über zehn Jahren ist die Namenberatung der Universität nun auch auf Messen wie »Baby & Kids« sowie auf Genelogentagen präsent. Neben dieser Arbeit halte ich Vorträge und Workshops auf Messen, in Schulen, in der Universität, in Bildungseinrichtungen, bei Vereinen, Behörden und Standesämtern. Die wissenschaftliche Arbeit darf dabei nicht zu kurz kommen. Es werden Statistiken erstellt und die gesammelten Daten zur Verwendung in der Namenberatung ausgewertet. Am interessantesten sind die Tagungen, Konferenzen und Kongresse, an denen ich teilnehme und bei denen ich Vorträge halte. Man tauscht sich mit Kollegen aus der ganzen Welt aus. Mittlerweile habe ich zahlreiche Kollegen nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus Österreich, Russland, aus der Ukraine, aus Spanien, Frankreich, Mexiko oder Kuba, mit denen mich eine enge Freundschaft verbindet. Die Teilnahme an Tagungen und Kongressen dient der Weiterbildung, dem Austausch und der Präsentation der Arbeit der Namenberatungsstelle.
Auf Reisen bin ich immer auch auf der Suche nach neuen Namen sowie nach neuen Namenbüchern. Ein Namenforscher kann wohl nie abschalten, was Namen angeht. Jedes Namensschild, jeder gehörte oder gelesene Name wird sofort analysiert. Jedenfalls geht es mir so, und ich habe mein privates Umfeld schon angesteckt. Da kommen schon mal Fragen: Was ist denn »Tipporn« für eine Name, oder ist das überhaupt ein Name? Hast du schon den weiblichen Vornamen »Rahaf« in deiner Datenbank? Ich war letztens in »Geilenkirchen«, merkwürdiger Ortsname, oder? Wie kommen denn solche Doppelfamiliennamen wie »Peter-Silie« oder »Lange-Poppen« zustande? Und, und, und … Das Thema betrifft ja auch jeden persönlich. Ich erzähle gern über Namen. In mehr als zwanzig Jahren hat sich eine Menge Wissen zu diesem Thema angesammelt. Einmal sagte man mir, ich wäre diesbezüglich ein wandelndes Lexikon. Aber es kommt schon vor, dass ich doch mal vom Thema Namen abschalten möchte und keine Lust auf das Erklären derselben habe. Dann antworte ich, auf die Frage, was ich beruflich mache, einfach nur mit: »Ich arbeite an der Uni!«
Meine Arbeit ist interessant, abwechslungsreich und voller Überraschungen. Wenn ich früh zur Arbeit gehe, weiß ich nie, was mich an diesem Tag erwartet. Welche E-Mail-Anfragen kommen, wer anruft und warum, welche Eltern mit ihren Babys vorbeischauen.
Viele Leute finden meine Arbeit toll. Es gibt aber auch traurige Momente: wenn ich zum Beispiel einen Vornamen für ein tot geborenes Kind bestätigen soll. Da bin ich immer froh, wenn die Standesbeamten mich anrufen und nicht die betroffenen Eltern. Aber einmal meldete sich auch ein Vater und wollte den Namen für sein Kind bestätigen lassen. Am Ende sagte er: Es ist leider bei der Geburt gestorben. Für mich ist das immer ein Schock. Wenn ich ihm mein Beileid ausdrücke, hilft ihm das wohl wenig. Wenigstens dürfen diese Sternenkinder auch ihren eigenen Vornamen bekommen.
Es gab auch einen Fall, da wurde ich um geschlechtsneutrale Vornamen gebeten, die man gleichermaßen Jungen und Mädchen geben kann. Der Standesbeamte wollte sogar auf einen eindeutigen Zweitnamen verzichten.
Der Vater erzählte mir, dass sein Kind mit beiden Geschlechtsmerkmalen auf die Welt gekommen sei. Man könne noch nicht sagen, in welche Richtung sich das Kind entwickeln würde. Die Ärzte legten den Eltern nahe, sie sollen sich schon einmal in eine Richtung orientieren. Für die Eltern eine schlimme Situation. Der Vater konnte sein Herz bei mir ausschütten. Und ich erstellte ihm eine Liste geschlechtsneutraler Namen. Leider bekomme ich nie eine Rückmeldung. Die Lebensgeschichten bleiben für mich ohne Ausgang.
Manchmal jedoch werde ich auf Baby-Messen, auf denen ich oft die Namenberatung präsentiere und Vorträge zur Vornamengebung gehalten habe, auch überrascht. Eltern präsentieren mir ihre Kleinoder Schulkinder, denen ich vor Jahren den Vornamen bestätigt habe. Einmal bekam ich auch einen Brief von Jonael, der sich dafür bedankte, dass ich 2001 den Vornamen Jonael bestätigt habe.
Als Namenberaterin muss man eigentlich immer im Dienst sein. Ich bekomme oft Anfragen von Journalisten, die ganz schnell Informationen zu einem aktuellen Thema brauchen. Letztes Jahr kamen Leute vom Fernsehen sogar am Wochenende zu mir in den Garten, um ein Interview aufzunehmen, das noch am gleichen Tag gesendet werden sollte. Und auch im Urlaub hat man nicht immer Ruhe vor den Radio- und Fernsehleuten. 2008 rief mich ein Radiosender an, ich machte gerade einen Spaziergang durch Madrid. Oder im Juni 2015, als die Namen Sturmhart Siegbald Torsten, zuvor fälschlicherweise Sturmhorst, durch die Medien gingen, musste ich einige Anfragen zu diesen Namen beantworten. Es war der letzte Arbeitstag vor meinem Urlaub. Am nächsten Tag auf der Fahrt zum 200. Jubiläum der Schlacht von Waterloo in Belgien wollte ein privater Fernsehsender unbedingt noch eine Stellungnahme zu diesen Namen vor der Kamera. Ich sagte, dass dies leider nicht möglich ist, da ich mich auf dem Weg nach Belgien befinde. Sofort kam die Rückfrage: Wo sind Sie gerade? Ich antwortete: Auf der Autobahn kurz vor Kassel. Zu meinem Erstaunen kam sofort die Antwort: Da haben wir auch ein Studio und können ihnen ein Team schicken. Also gab ich ein Interview auf einem Rastplatz Nähe Autobahn bei Kassel. Was tut man nicht alles für die Journalisten, die nie Zeit haben und immer aktuell sein müssen. Zum Glück sind das aber Ausnahmen.
Entscheidungskriterien zur Namenswahl
Interessant ist, dass sich Kinder und Eltern bei der Auswahl des Vornamens schon von Geburt an in einem Konflikt befinden. Die Eltern, das ist die Tendenz der letzten Jahre, wollen etwas Einzigartiges und Außergewöhnliches finden. Sie möchten, dass sich ihr Kind von anderen abhebt – mit einem besonderen, symbolischen, individuellen Vornamen.
Die Kinder aber, und das bedenken leider viele Eltern nicht, empfinden anders. Sie wollen sowohl im Kindergarten als auch in der Schule eigentlich so sein wie die anderen. Eben gerade nichts Besonderes. Für Kinder und Heranwachsende ist es wichtig, dazuzugehören und sich nicht von den Altersgenossen abzuheben. Und viele der ach so originellen und einzigartigen Vornamen stellen diese Verbindung zu anderen nicht her und sorgen im schlimmsten Fall sogar dafür, dass das Kind gehänselt oder ausgeschlossen wird. Auch daran sollten Eltern denken, bevor sie mit Vorschlägen kommen, wie sie beispielsweise im Anhang dieses Buches (siehe Seite 206 ff.) aufgelistet sind.
Ich mache meinen Beruf mittlerweile so lange, dass mich viele Standesämter kennen und sagen: »Wenn Leipzig das genehmigt, dann tragen wir das ein.« Entsprechend groß ist auch die Verantwortung, die ich habe. Letztendlich aber kann auch ich immer nur eine Einschätzung abgeben – und eine Empfehlung an das Standesamt. Entscheiden wird jedoch immer das Amt selbst. Oder wenn die Eltern so weit gehen wollen: das Gericht.
Wie sieht nun die Praxis bei den Standesämtern aus, wonach richten sie sich? Grundsätzlich gibt es in Deutschland eine freie Vornamenwahl. Diese wird von den Standesämtern kontrolliert, die allerdings angehalten sind, die gewünschten Vornamen nach drei Kriterien zu überprüfen:
1. Vornamencharakter: Der Name muss ein Vorname sein oder als solcher erkennbar sein. Dabei sind Neubildungen allerdings möglich.
2. Geschlechtseindeutigkeit: Bei nicht eindeutigen Vornamen muss ein weiterer eindeutiger Vorname dazugegeben werden. In den letzten Jahren weicht dieses Kriterium aber mehr und mehr auf. Geschlechtsneutrale Vornamen werden mittlerweile auch ohne Zweitnamen eingetragen.
3. Wohl des Kindes: Der Vorname darf das Kind nicht lächerlich machen. Weder jetzt noch in dessen weiterem Leben. Auch auf die Kombinationen muss dabei geachtet werden. Es können Vornamen abgelehnt werden, wenn diese im Zusammenspiel mit dem Familiennamen nicht passen. Zum Beispiel »Rosa Schlipfer/ Schlüpfer« (und diesen Fall hatte ich tatsächlich schon), »Claire Grube« oder »Axel Schweiss«. Auch bei der Kombination zweier Vornamen weisen wir zumindest darauf hin, dass es problematisch werden könnte: Marie-Johanna klingt eben schnell gesprochen wie »Marihuana«.
Das Klingelschild sollte niemand an seiner Tür haben müssen.
Das wichtigste Kriterium bei der Genehmigung von Vornamen ist mit Sicherheit das Kindeswohl. Denn das kann nachhaltig verletzt sein, wenn die gewählte Bezeichnung als Vorname sprachlich untauglich ist oder inhaltlich als Personenname ungeeignet erscheint. Dass als Vornamen benutzte Wörter über die Bezeichnung eines bestimmten Individuums hinaus einen allgemeinen Aussagegehalt haben, ist nicht nur üblich, sondern seit jeher geradezu Zweck der Namengebung (zum Beispiel bei Assoziationen zu Heiligen oder geschichtlichen Vorbildfiguren).
Die Ausstrahlungswirkung des Namens auf die Person kann sich je nach inhaltlicher Bedeutung und Durchschaubarkeit jedoch auch in ihr Gegenteil verkehren. Der Schutz des Kindes, das sich gegen belastende Namen nicht wehren kann, muss deshalb ein besonderes Anliegen des Rechts sein.
Es gibt aber kein festes Gesetz, sondern nur die oben genannten Regelungen, die allerdings auch interpretierbar und auslegbar sind. Und solche Auslegungen ändern sich im Laufe der Zeit. Früher einmal wurden Namen wie zum Beispiel Summer, Sunshine, Sky, Moon, Sonne, Brooklyn, Madison, Mackenzie, Tiger, Alaska, Woodstock, Junior, King, Prinz, Chelsea oder Emily-Extra abgelehnt. Mittlerweile werden sie aber als Vornamen eingetragen, dank entsprechender Gerichtsurteile. Oder dank unserer Gutachten.
Ebenfalls von Eltern schon gewünschte Vornamen wie Crazy Horse, Porsche, Rumpelstilzchen, Schnuckel, Kirsche, Schröder, Pfefferminze, Joghurt, Whisky, Borussia, Kaiserschmarrn, Superman, Keks oder Flauschi wurden aber abgelehnt.
Und das ist auch gut so.