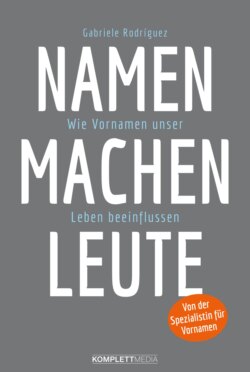Читать книгу Namen machen Leute - Gabriele Rodríguez - Страница 7
ОглавлениеEIN PHÄNOMEN – DER »KEVINISMUS«
Am 17. Januar 1991 lief der Film »Kevin allein zu Haus« in Deutschland an. Darin spielt ein zugegeben außerordentlich hübscher, niedlicher, smarter und extrem gewitzter Junge namens Kevin (dargestellt von Macaulay Culkin) die Hauptrolle. Vier Wochen später kam dann noch »Der mit dem Wolf tanzt« nach Deutschland – Regie und Hauptrolle: Kevin Costner. Ein Zufall, aber einer mit Folgen. Denn diese beiden Filme setzten etwas in Gang, das bis heute anhält. Und dessen Auswirkungen und Nachwehen gigantisch sind in der Welt der Vornamen.
Es begann ganz harmlos und langsam. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs gelangten immer mehr Namen aus dem englischen Sprachraum zu uns: anfangs durch die britischen und amerikanischen Besatzer, dann auch durch die Medien sowie durch die Verbreitung des Fernsehens und der Ausstrahlung vieler Spielfilme (und den darin auftretenden Schauspielern) – und natürlich durch populäre Musiker. Kevin ist im Ursprung ein irischer Name, der so viel bedeutet wie »schön von Geburt, hübsches Kind«. Die Schreibweise »Caoimhín« lautete in der anglisierten Fassung dann Kevin.
In Deutschland wurde der Vorname Kevin wohl zum ersten Mal im Jahr 1969 in Bökingharde in Schleswig-Holstein vergeben. In der DDR gab es 1966 die erste Anfrage zum Namen Kevin. In den folgenden Jahren blieb er zunächst noch extrem selten und war eher ein Name, den sehr gebildete Eltern ihren Kindern gaben. Menschen, die Freunde der keltischen Kultur waren oder im Urlaub nach Irland fuhren – was damals ein außergewöhnliches Reiseziel war –, brachten diesen damals noch sehr exotischen Namen mit. Meistens Akademiker. Vor 1975 wurde der Name in Berlin zum Beispiel nur neunmal vergeben, in den drei Jahren danach zehnmal.
Erst als der damals extrem bekannte und populäre englische Fußballer Kevin Keegan 1977 in die Bundesliga zum Hamburger SV wechselte, wurde Kevin in Deutschland geläufig, und immer mehr Eltern wählten diesen Vornamen. Ende der 1980er-Jahre wurde dann der Schauspieler Kevin Costner auch in Deutschland immer bekannter und beliebter. Er brachte den »Kevin« 1989 erstmals unter die Top 20 der beliebtesten Vornamen in Deutschland. Und dann noch weiter nach oben, als im Herbst 1990 sein Blockbuster »Der mit dem Wolf tanzt« in den USA ins Kino kam. Schon hier wurde der Name Kevin immer häufiger in den Medien genannt: ein wichtiger Grund für die Entstehung von Modenamen.
Aber so richtig verrückt wurde es dann mit »Kevin allein zu Haus«. Quasi aus dem Nichts wurde Kevin 1991 (und auch nur in diesem Jahr) mit Abstand zum beliebtesten Vornamen in Deutschland (vor den Dauersiegern Jan, Patrick, Philipp und Marcel).
Der Erfolg erklärt sich leicht. Neben der sympathischen Filmfigur, weshalb viele Eltern mit dem Namen Kevin ein Kind assoziierten, das man selbst gern hätte, hat Kevin alles, was ein schöner männlicher Vorname braucht. Da ist der Klang, der in Deutschland extrem wichtig ist. Die Deutschen vergeben Vornamen ja schon lange nicht mehr nach der Bedeutung oder der Tradition, sondern vor allem wegen der Lautstruktur. Ein Name muss angenehm klingen, griffig und stimmig sein. Es werden heute in Deutschland vor allem Vornamen mit den Anlauten M-, L- und J- gewählt. Die häufigsten männlichen Endungen sind -n (-ian, -in, -an, -on), -s (-ias, -as, -us, -ius, -es, -is) und -(e) 1, -(e)r. Die weiblichen Vornamen sind vor allem durch die Endungen -a, -ia, -e und -i, -ie, -y gekennzeichnet. Kevin hat zwar mit dem »K« einen harten Anlaut, wird aber durch die Vokale »e« und »i« sowie durch die Endung weicher und wohlklingender. Zudem besteht Kevin aus zwei Silben. Kürzere Vornamen liegen seit einigen Jahren voll im Trend. Dabei ist Kevin im Irischen sowohl ein männlicher wie auch ein weiblicher Vorname. Es erfolgten in Deutschland auch schon Eintragungen als weiblicher Vorname, so zum Beispiel 1978. Mit dem Erfolg des Namens als männlicher Vorname ist die weibliche Form zurückgegangen.
Bei Kevin kommt beispielsweise auch noch das Unterbewusstsein ins Spiel. Es ist nicht so, dass man aus dem Kino kommt und sagt: »So, und jetzt nennen wir unseren Sohn Kevin.« Es ist eher so, dass man den Namen erst einmal positiv besetzt, dann klingt er schön, dann hört man ihn immer öfter, in den Medien, in Gesprächen mit Freuden, und vielleicht nennen auch in der Nachbarschaft einige ihr Kind so. Und schon ist ein Name im Unterbewusstsein verankert. So geht das allen Modenamen: Ein kleiner Schneeball wird zu einer Lawine. Es war damals allerdings noch kein Ausschlusskriterium, wenn man den Namen öfters bei Freunden oder Nachbarn oder im weiteren Umfeld hörte. Heute will ja jeder extrem individuell sein, damals war es eher eine Bestätigung für eine gute Wahl, wenn auch andere diesen Namen an ihr Kind vergaben. Und so nannten in den 1990er-Jahren viele junge Eltern ihr Kind Kevin, völlig unabhängig von Schicht oder Bildungsgrad. Kevin war ein Name wie jeder andere auch, mit einem Hauch Exotik und Extravaganz. Aber irgendwann kippte es.
ZOOTIERE FERN DES »KEVINISMUS«
Zootiere scheinen eher altmodische Namen zu bekommen. Vielleicht fürchten die Namensgeber um den Ruf der Tiere?
Antje, das Walross, wurde 1976 geboren und lebte im Hamburger Zoo Hagenbeck.
Cornelius I., ein stattliches Nashorn, lebte im Granby Zoo in Québec.
Heidi, ein Virginia-Opossum aus dem Leipziger Zoo, wurde durch ihr starkes Schielen bekannt.
Karl Wilhelm, das Flusspferd, kam am 17. Juni 2015 im Karlsruher Zoo zur Welt.
Knut, der Eisbär, wurde am 5. Dezember 2006 in Berlin geboren.
Martha, die Wandertaube, war die letzte ihrer Art, die im Zoo lebte. Sie starb 2014.
Von supergut zu grottenschlecht!
Der Prozess der Veränderung in der Bewertung eines Namens ist nichts Neues. Schon in früheren Jahrhunderten war es so, dass ein Name zuerst im Adel oder im gehobenen Bürgertum neu auftrat oder wiederkam. Manch einer, wenn er geeignet war, wurde zum Modenamen. Dann zogen langsam die unteren Schichten nach, die diesen Modenamen der »Oberen« mitbekamen. So begann der Name langsam »abzurutschen«, bis quasi ganz nach unten zu den einfachen Bauern. Für »oben« war er da längst abgegriffen und uninteressant, diese Herrschaften suchten sich wieder neue Namen. So ist der Name im wahrsten Wortsinn »nach unten« durchgereicht worden.
Und auch heute sind die Mechanismen ähnlich. Nur dass der Name nicht vom Adel und dem Bürgertum bis zum Stand der Bauern durchrutscht, sondern von den Akademikern zu den sogenannten bildungsfernen Schichten. Was neu ist: Er wird nicht mehr nur als unoriginell empfunden, nein, seit etwa 20 Jahren bekommen solche Namen – und da sind wir wieder beim »Kevinismus« und dessen Anfängen – auch schnell etwas ganz Negatives mit. Wenn ein Name unten angekommen ist, dann ist er nicht mehr nur langweilig, sondern auch gleich ein Ausdruck für Dummheit oder Faulheit. Warum das erst seit etwa 20 Jahren so ist, ist schwer erklärbar. Eine Rolle spielen sicher Boulevardmedien (Privatfernsehen) und der Comedyboom, der solch griffige Opfer braucht, um Witze zu transportieren. Der Komiker Michael Mittermaier sagte in einem Programm: »Nur Drogenkinder und Ossis heißen Kevin.« Dabei kommt der Vorname Kevin im Westen Deutschlands viel häufiger vor.
Das Internet ist ein weiterer wichtiger Grund, warum Namen heute schnell stigmatisiert werden. Via Facebook oder anderen sozialen Netzwerken geht das heute ganz schnell. So wurde der Name Kevin schließlich zum Synonym des »prolligen Hartz-IV-Kindes«. Bei den Mädchen machte derweil Chantal eine ähnliche »Karriere«. Und mich rufen besorgte Eltern aus gehobenen Schichten an, ob der Name, den sie sich für ihr Kind ausgesucht haben, denn auch schon gefährdet sei.
Erstaunlich ist, dass Kevin in der Unterschicht trotzdem lange ein beliebter Vorname blieb. Dafür ist ein weiteres Phänomen verantwortlich: Während die einen sich längst lustig machen über den Kevin und die Chantal, kommt das in den bildungsferneren Schichten zunächst gar nicht an. Sie haben wenig Kontakt mit denen, die sich über sie lustig machen, sie lesen nicht diese Zeitungen und sehen auch nicht deren Fernsehprogramm. Auch das Verständnis für Ironie und Sarkasmus ist eben nicht so ausgeprägt. Sie bewegen sich vielmehr in Gruppen von Menschen, die (oder deren Kinder) ebenfalls außergewöhnliche oder gar »verrufene« Vornamen haben, und es fällt ihnen nicht weiter auf, dass ihr Name als bildungsfern gilt.
Eine weitere Pointe erhielt das Thema 2009 durch eine Masterarbeit einer Lehramtsabsolventin. Darin befragte sie Grundschullehrer über ihre Namenvorlieben und ihre Assoziationen diesbezüglich. Auch vorgegebene Namen ließ die Absolventin die Lehrer bewerten. Das Ergebnis: Viele Lehrer haben tatsächlich Vorurteile, und sie bewerten Kinder, die Unterschicht-Namen tragen als eher weniger leistungsstark und verhaltensauffälliger. Angeblich hinterfragten 94 Prozent der Lehrer diese Vorurteile kaum. Besonders freundlich und leistungsstark seien dagegen Jungs mit den Namen Alexander, Maximilian, Simon, Lukas oder Jakob; wie auch Mädchen mit Namen wie Charlotte, Nele, Marie, Emma oder Katharina. Eher schlecht bewertet werden hier Chantal, Justin, Dennis, Marvin oder Jacqueline. Absoluter Negativsieger aber ist Kevin. Eine Lehrerin notierte in der Befragung: »Kevin ist kein Name, sondern eine Diagnose.«1
Diese Studie und ihr Resultat samt der plakativen Kommentare wurden kritiklos und nur in Teilen von den Medien aufgenommen und verbreitet. Betrachtet man die Studie genauer, muss man aus wissenschaftlicher Sicht dazu feststellen: Exakt 1864 Personen haben teilgenommen. Reduziert auf die Grundschullehrerinnen und -lehrer wurden nur 500 Datensätze berücksichtigt. Davon stammten mehr als die Hälfte der Befragten aus Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. Aus den ostdeutschen Bundesländern beteiligten sich gerade mal sechs Prozent aller Befragten. Dies ist für eine bundesweite Befragung doch sehr unausgeglichen. Der Aspekt der regionalen Unterschiede bei der Vornamengebung sowie Wahrnehmung konnte damit nicht berücksichtigt werden. Die Wahrscheinlichkeit von Verhaltensauffälligkeit und Leistungsschwäche wird Kindern mit den Vornamen Kevin (54 Prozent), Justin (21 Prozent) sowie mit zehn Prozent und weniger Dennis, Marvin, Jacqueline, Chantal, Marcel, Pascal, Maurice, Cedric, Patrick, Michelle, Steven, Jennifer und Mandy zugeschrieben. Die positiv assoziierten Vornamen Alexander, Maximilian, Charlotte, Marie und Maria haben dagegen eine jahrhundertelange Tradition in Deutschland und werden meist als zeitlose, schöne Vornamen empfunden.
Ein weiteres Problem: Der Begriff »Kevinismus« wurde von den Medien seit etwa 2007 stark thematisiert, war also in der berühmtberüchtigten Befragung im Jahr 2009 bekannt und spielte im Unterbewusstsein der Befragten eine Rolle. Entsprechend schlecht schnitt der Vorname ab. Die Namen Mandy, Sandy und Jacqueline waren und sind vor allem im ostdeutschen Raum verbreitet. Dies gilt auch für Marcel, Pascal, Patrick, Michelle und Cedric, wobei diese Namen auch im südwestdeutschen Raum verstärkt vorkommen, in der Nähe zum französischen Sprachraum. In Niedersachsen zum Beispiel gehören sie zu den weniger häufigen Vornamen. Das erklärt auch, dass sich nach Bekanntwerden dieser Studie eine besorgte Mutter aus Niedersachsen an mich wandte, deren Tochter Mandy heißt. Sie befürchtete eine Benachteiligung in der Schule wegen des Vornamens. Mandy wirkt in Niedersachsen fremd, wird oft als typisch ostdeutsch und die Trägerin des Namens damit unbegründet als weniger intelligent eingeschätzt. Der Änderungsantrag der Mutter wurde übrigens abgelehnt. Die Tochter muss auch weiterhin Mandy heißen. Wenn besagte Mandy irgendwann mal nach Leipzig kommen sollte, wird sie feststellen können, dass sie hier mit ihrem Namen gar nicht auffällt. Er ist im Osten Deutschlands ein wertneutraler Vorname. In meinem Bekanntenkreis habe ich einige »Mandys«, die unter anderem als Lehrerin und Künstlerin tätig sind. Mein eigener Sohn heißt übrigens Dennis (Jahrgang 1984) – heute ein sogenannter »Unterschichtenname«. In den 1980er-Jahren war es in der DDR noch ein Name des Bildungsbürgertums. Meine Nichte heißt Jacqueline (Jahrgang 1985), und sie ist weder verhaltensauffällig noch leistungsschwach.
Von wegen bildungsfern: Dle Namen aller Studenten, die in Leipzig 2016 im Wahlbereich »Onomastik« (Namenforschung) ihr Studium begannen.
Von den Befragten in der Studie werden kurioserweise auch die Vornamen Maximilian, Leon, Lucas, Niklas, Philipp, Luca, Alexander, Celina, Robin, Tim und Mark teilweise als negativ angegeben. Diese Vornamen sind in den letzten Jahren regelmäßig in den Listen der am häufigsten vergebenen Vornamen enthalten. Und bei so häufigen Vornamen kommt es schon mal vor, dass auch verhaltensauffällige und leistungsschwache Kinder dabei sind. Zugegeben: Es ist schon etwas dran, dass englischsprachige Vornamen heute eher von bildungsärmeren Schichten bevorzugt werden. Befreundete Lehrerinnen haben mir das bestätigt. Allerdings ist es längst nicht mehr der Kevin, der im Unterricht negativ auffällt, sondern heute vor allem auch Jeremy, Justin, Jason, Lennox oder Maddox. Dass hier nur Jungennamen aufgelistet sind, liegt sicher auch daran, dass Jungen doch eher etwas lebhafter sind.
»Kevinismus« mit Fragezeichen
Das Phänomen des »Kevinismus« findet man aber auch in anderen Ländern, zum Beispiel in Frankreich und Österreich. In einem Artikel über die französische Namengebung wird »Kevin« ebenso der bildungsfernen Schicht zugeschrieben2. Er hat in Frankreich eine ähnliche unerfreuliche Entwicklung erfahren wie in Deutschland. Auch in Österreich findet man bei der gebildeten Schicht eine traditionelle Namengebung. Da fallen die Vornamen Kevin, Marvin, Justin und Jennifer sofort als Unterschichtennamen auf.
Im Jahr 2006 schickte mir eine österreichische Freundin und Kollegin einen Artikel über das Unterschichtenproblem in Österreich. Ein Abschnitt war den sogenannten Unterschichtennamen gewidmet. Da tauchte für mich zum ersten Mal der Begriff »Kevinismus« auf, da Kevin hier ein beliebter Vorname war. Ich fand dies sehr amüsant. Einige Zeit später gab ich mal wieder ein Interview zu Vornamen für eine deutsche Zeitung und merkte nebenbei an, dass die österreichische Presse den Begriff »Kevinismus« geprägt hat. Der Journalist war verblüfft, denn er kannte diesen Begriff nicht. Und kurze Zeit später, im Jahr 2007, wurde der Begriff dann auch in Deutschland von den Medien verwendet. Womöglich bin ich also mitschuldig daran, dass er nach Deutschland kam. Für die Mädchen kam analog dazu der »Chantalismus« auf. Ich persönlich finde diese Bezeichnungen nicht sehr schön. Übrigens sagte mir letztens ein österreichischer Journalist, dass die Gegenbewegung zum »Kevinismus« in Österreich nun der »Emilismus« ist. So, wie sich gebildete Leute über englischsprachige Namen lustig machen, findet man auch weniger gebildete Menschen, die die Vornamen der Akademiker als sehr hochtrabend sowie die wiederkommenden altdeutschen Vornamen als altmodisch bezeichnen.
Und so griffig der »Kevinismus« auch mittlerweile ist, so falsch ist der Begriff letztlich auch. In einer Untersuchung von 2012 habe ich mir die Statistiken der Universität Leipzig vorgenommen und sie ausgewertet. Da ist der Zusammenhang zwischen Vornamen und Bildungsgrad nicht so ausgeprägt. Oder anders gesagt: Ich habe auch promovierte Akademiker mit Vornamen Kevin gefunden.
2013 habe ich einen Artikel veröffentlicht, als Reaktion auf die Oldenburger Studie von 2009 sowie die »Kevinismus«-Debatte im Internet. Untersucht habe ich dabei unter anderem die als leistungsschwach dargestellten Vornamen Kevin, Mandy, Chantal, Angelina, Jacqueline, Justin und Maurice auf Grundlage der Universitätsmatrikel der Universität Leipzig (Namen aller Studenten und Mitarbeiter bis 2000) und Vornamenstatistiken der DDR bis 1990. Es betrifft hier vor allem die Vornamen in der DDR. Die Vornamen Mandy, Nancy, Cindy, Sindy, Sandy und Peggy werden als sogenannte »DDR-Namen« bezeichnet. Sie sind alle in den Universitätsmatrikeln enthalten. Und tatsächlich waren diese Vornamen in der DDR insbesondere bei der Mittelschicht in den 1970er- bis 1990er-Jahren recht beliebt. Mandy gehörte zu dieser Zeit zu den beliebten weiblichen Vornamen in der DDR, vor allem aber in Ostmitteldeutschland. Mandy ist ein typischer Mittelschichtenname. Ein ähnliches Bild ergibt sich für Nancy, Cindy, Peggy und Sandy. Es sind Vornamen, die vom Bildungsbürgertum vergeben wurden.
Die als negativ eingeschätzten Vornamen Justin, Maurice, Chantal und Angelina erscheinen in den Universitätsmatrikeln noch recht wenig. Diese Namen sind erst in den 1990er-Jahren stärker aufgekommen – und wohl in den eher bildungsärmeren Schichten. Der Vorname Kevin erscheint auch nur 18-mal zwischen 1972 und 1985. Darunter befanden sich zwei Studenten aus den USA, einer aus Aschaffenburg und die übrigen aus Sachsen und Sachsen-Anhalt, die an der Universität Leipzig vor allem Betriebswirtschaft und naturwissenschaftliche Bereiche studierten. In der DDR gab es für den Namen Kevin Mitte der 1980er-Jahre einen Anstieg. In den 1990er-Jahren zählte Kevin zu den zehn beliebtesten männlichen Vornamen in den neuen Bundesländern. Damit wurde er für das Bildungsbürgertum eher uninteressant.
SANDY TRIFFT MANDY UND RANDY – VORNAMEN IN DER EHEMALIGEN DDR
Es ist ja ein sehr populärer Fun-Fact, dass man sagt, die Eltern in der DDR hätten ihren Kindern Namen gegeben, die englisch klingen, als Ausdruck von Fernweh und Sehnsucht nach diesen Ländern, in die sie nie reisen durften. Das klingt nachvollziehbar, ist aber falsch. Zumindest ist es nicht der Hauptgrund. Vielmehr ist es so, dass in der DDR natürlich Russisch erste Fremdsprache war, aber – was viele nicht mehr wissen –, Englisch war die zweite. Und so wurde es in den 1980er-Jahren unter den Bildungsbürgern in der DDR populär, sein Kind Sandy, Mandy oder Peggy zu nennen. Denn es war ein Privileg, Englisch zu können. Und wer es konnte, der hat es auch gezeigt. Zum Beispiel im Vornamen seines Kindes. Natürlich tauchten diese Namen auch in den Schulbüchern sowie im Bildungsfernsehen auf – vor allem Peggy und Tom. Und so wurden die beiden sehr beliebte Vornamen. Mit Fernweh oder gar Protest gegen das Eingesperrtsein hatte das wenig zu tun.
Andere englische Namen standen nicht in den Büchern, die kannte man oft nur vom Hören, zum Beispiel aus dem West-Fernsehen. So entstand wahrscheinlich die bekannteste ostdeutsche Abwandlung: Maik satt Mike. Zwar hat der Name Maik auch friesische Wurzeln, als Koseform von Meinhard, die man heute noch in der sehr beliebten Mädchenvariante Maike (oder Meike) findet. Aber man kann davon ausgehen, dass diese Form im Gebiet der DDR nicht geläufig war. Es ist eine klassische Eindeutschung eines Namens (siehe Kapitel S. 185ff.), den man eben nur gehört, aber nie aufgeschrieben gesehen hat.
Auch Madeleine wurde so in der DDR zu Madlen oder Yvonne zu Ivonne – oder Vivian zu Vivien. Sei es nun, weil die Eltern die wirkliche Schreibweise nicht kannten, oder auch, weil sie sie ganz bewusst »eindeutschten«, um damit größere Chancen zu haben, dass der Name genehmigt wird. Heute klingen manche Namen zwar ganz gängig, aber den Verdacht, dass ihre Eltern etwas einfältig waren und kein Englisch oder Französisch konnten, tragen die Kinder immer mit sich.
Auch den »Kevin« hatte man in der DDR sehr früh für sich entdeckt, hier wurde er sogar noch früher als im Westen eingetragen. Hier kannte man den Namen ebenfalls nur vom Hören, schließlich hat die Regierung dafür gesorgt, dass man nicht sieht, wie der Name geschrieben wird. Es gab deshalb also nur einige Anfragen für Kewin, Kevyn, Keven, Kewen oder auch Cevin, die dann abgelehnt wurden. Auch Kevin wurde zunächst abgelehnt, aber dann gewährte man auch hier den Bürgern diese kleine Extravaganz.
Ebenfalls eine Rolle spielt der regionale Einfluss. Im norddeutschen Raum, dessen Bewohner eher als mundfaul und kühl gelten, sind auch die Namen eher kurz und kantig: Ole, Jan, Finn, Lasse, Merle, Nele. Da spürt man schon beim Namen eine steife Nordseebrise. Im tiefsten Bayern, wo man den Menschen eher einen weichen, barocken und redseligen Charakter nachsagt, findet man ausladende, lange und warme, gemütliche Namen: Katharina, Veronika, Korbinian, Maximilian. In Sachsen wiederum kommt der Melodie des Dialektes die Endung auf »-i«, »-ie« oder »-y« entgegen. Also Ronny, Peggy, Mandy in den 1980er-Jahren. Und heute finden wir hier oft: Lilly, Leni, Emily, Hailey, Fibie, Tommy oder Harley.
Die Auswirkungen – nomen est omen
Die negativen Assoziationen, die allein der Name bei anderen auslöst, können frappierend sein. Ich kenne eine Untersuchung, für die einem Arbeitgeber zwei identische Bewerbungsmappen vorgelegt wurden. Die eine eingesandt von einem Kevin, die andere von einem Alexander. Das Ergebnis überrascht kaum: Der »Alexander« war durchweg der bevorzugte Kandidat.
In den USA gibt es dieses Phänomen schon länger, da werden oft krasse Unterschiede zwischen »schwarzen«, »weißen« oder »Latino- Namen« gemacht, aber auch schon zwischen »intelligenten« und »weniger intelligenten«. Sei es in der Schule, bei Bewerbungen, aber auch in der Behandlung durch Behörden – eine so eingefahrene wie üble Tradition, die nun ebenso immer mehr zu uns herüberschwappt. Leider.
Ich bekam vor einiger Zeit eine Anfrage zum afroamerikanischen männlichen Vornamen Latrell. Die Mutter ist Deutsche, ihr Mann Afroamerikaner. Das Kind bekam den Vornamen Latrell, einen typisch »schwarzen« Namen. Die Mutter wollte ihrem Sohn noch den Zweitvornamen Justin geben. Da legte der Vater ein Veto ein. Er sagte: »Ich gebe meinem Kind doch keinen weißen Namen!«
Das war meine erste Konfrontation mit den Begriffen »weiße« und »schwarze« Vornamen. In meiner Bibliothek habe ich inzwischen aber ein amerikanisches Buch mit dem Titel »Black Names«. So ganz akut wird es wohl in Deutschland nicht werden. Allerdings höre ich dann schon mal von deutsch-afrikanischen oder deutsch-afroamerikanischen Eltern: »Ich kann meinem Kind, das schon durch sein Äußeres auffallen wird, nicht einen normalen deutschen Vornamen geben. Bei ›Keshia‹ für ein Mädchen passt der ursprünglich afroamerikanische Name auch für ein afrodeutsches Mädchen.«
Ich wurde schon einige Male von der Kriminalpolizei gebeten, ein Gutachten zu schreiben, um über den Vornamen Aufschluss zum Täter zu bekommen. So gab es eine Anfrage zum Vornamen Justin. Bekannt war der Vorname nur vom Hören. Vermutet wurde ein ausländischer Hintergrund (Russlanddeutsche). Ich helfe natürlich immer gern, aber dass ein Name Aufschluss geben soll, wie kriminell jemand ist, das erscheint mir doch als sehr gewagt.
Auch bei der Partnersuche haben es Männer mit dem »falschen« Vornamen schwerer. Befragungen bei Dating-Portalen zeigen, dass Männer mit positiv assoziierten Vornamen, wie zum Beispiel Alexander, eher beachtet werden als solche mit negativ assoziierten, wie zum Beispiel Kevin.
In einer Studie der Humboldt-Universität Berlin wurden im Jahr 2011 die Daten von 900 Mitgliedern des Datingportals »eDarling« ausgewertet. Mit dem Ergebnis, dass Profile mit »attraktiven« Namen häufiger angeklickt werden als solche mit »unattraktiven«. Einziger Trost für die »Kevins«: Den Frauen geht es nicht besser. Die fünf Namen mit den besten Chancen beim anderen Geschlecht waren: Felix, Paul, Lukas, Jens und Tim sowie Hannah, Lena, Katharina, Claudia und Sophie.
Deutlich weniger gut sieht es, das Glück in der Liebe betreffend, aus für Kevin, Uwe, Peter, Mike und Heiko sowie für Chantal, Johanna, Sylvia, Laura und Petra.3
Kevin (unattraktiv)
Tim (attraktiv)
Informationen darüber, wie Sie Onogramme lesen und wie sie enstehen sowie die Onogramme der häufigsten deutschen Namen finden Sie ab Seite 228.4
Die Assoziationen, die ein Vorname bei der Partnerwahl auslösen kann, nahm schon 1895 der irische Schriftsteller Oscar Wilde in seiner Komödie »Bunbury« aufs Korn. Sie trägt im Original den eindeutigeren Titel »The Importance of Being Earnest« – in etwa: »Von der Wichtigkeit, Ernst zu sein«. Der Doppelsinn des Vornamens Ernst und des Adjektivs »ernst« ist auch ins Deutsche übertragbar.
Lesen Sie hier eine der entscheidenden Stellen des Stücks:
JACK: Aber du willst doch nicht behaupten, dass du mich nicht lieben könntest, wenn ich nicht Ernst hieße?
GWENDOLEN: Aber du heißt doch Ernst.
JACK: Ja, das weiß ich. Aber nehmen wir mal an, ich hieße nicht so? Willst du behaupten, du könntest mich dann nicht lieben?
GWENDOLEN: (schlagfertig) Ah! Das ist offenkundig reine metaphysische Spekulation, und wie die meisten Spekulationen dieser Art hat sie sehr wenig mit den Tatsachen des Lebens, so wie wir sie kennen, zu tun.
JACK: Offen gestanden, mein Engel, hänge ich nicht besonders an dem Namen Ernst – ich finde, der Name steht mir überhaupt nicht.
GWENDOLEN: Er steht dir ausgezeichnet. Das ist ein göttlicher Name. Er hat seine ganz eigene Musik. Er schwingt.
JACK: Nein, wirklich, Gwendolen, ich finde schon, es gibt eine Menge anderer, viel hübscherer Namen. Ich finde Jack zum Beispiel sehr charmant.
GWENDOLEN: Jack? – Nein, in dem Namen Jack steckt nur sehr wenig Musik, wenn überhaupt. Er packt einen nicht. Er löst keinerlei Schwingungen aus – ich habe mehrere Jacks gekannt, und alle waren sie ausnahmslos fade. Außerdem ist Jack nur der abgeschmackte Hausname für John. Und ich bedaure jede Frau, die mit einem Mann namens John verheiratet ist. Wahrscheinlich wird sie nie Gelegenheit haben, das hinreißende Vergnügen zu genießen, auch nur einen winzigen Augenblick allein zu sein. Der einzig wirklich sichere Name ist Ernst.
(…)
GWENDOLEN: Die Geschichte deiner romantischen Herkunft, so wie Mama sie mir, mit einigen unangenehmen Bemerkungen versehen, mitgeteilt hat, hat natürlich die innersten Fasern meiner Seele angerührt. Dein Vorname übt eine unwiderstehliche Faszination auf mich aus. (…)
1 Vgl. »Kevin ist kein Name, sondern eine Diagnose«, von Oliver Trenkamp, Spiegel Online, 16. September 2009
2 Vgl. »Why it’s hard to be a Kevin in France«, www.bbc.com vom 19. März 2017
3 Vgl. »Die Top-Vornamen mit Flirt-Garantie«, Bild, 14. September 2011
4 Quelle: Thomas Liebecke, www.onomastik.com