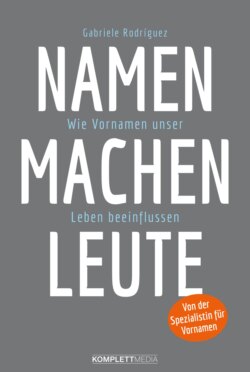Читать книгу Namen machen Leute - Gabriele Rodríguez - Страница 8
ОглавлениеDIE ALTEN GERMANEN – WARUM WIR NAMEN HABEN
Der Vorname ist noch wichtiger als der Nachname. Während man den Nachnamen (das gilt natürlich vor allem für Frauen) im Laufe seines Lebens schon mal wechselt, bleibt der Vorname ein lebenslanger Begleiter. Er liegt quasi »direkt auf der Haut« und ist immer da. Wenig im Leben ist dem Menschen so treu, so dauerhaft und nachhaltig wie der eigene Vorname. So eine Beziehung prägt natürlich.
Wie entwickelten sich nun die Vornamen? Im Prinzip gibt es Namen, seit es Menschen gibt und seit sie miteinander sprechen. Selbst Tiere pflegen eine gewisse Ansprache, wobei es zu weit führt, da von Namen zu sprechen. Aber auch sie können sich über Laute verständigen und der »angesprochene« Artgenosse weiß dann, dass er gemeint ist.
Geht man also davon aus, dass mit der Entstehung von Sprachen auch Namen entstanden, so haben wohl auch schon die Höhlenbewohner Namen gehabt. Davon ist in der Forschung aber wenig bekannt. Die Ersten, die über Namen in unserem heutigen Sinne verfügten, waren wohl die Chinesen. Sie waren auch die Ersten, die Familiennamen trugen. Zumindest kommt der älteste bezeugte Name der Welt aus China, es ist der des Urkaisers »Fu Xi«, der laut dem britischen Sinologen James Legge im Jahr 3322 v. Chr. geboren wurde. So verwundert es nicht, dass es auch die Chinesen waren, die als Erste ein veritables Namensystem erschufen.
In der Shang-Dynastie (16. – 11. Jahrhundert v. Chr.) führten sie eine Art Nachnamen ein, indem die Angehörigen des Kaiserhauses den Namen ihres Herrschers als Beinamen annahmen. So ist etwa der Beiname »Yin« als einer der ältesten schon in der Shang-Dynastie (16. Jahrhundert – 11. Jahrhundert v. Chr.) bezeugt. Die Herrscher der Zhou-Dynastie (1122/1045 – 770 v. Chr.) werden mit ihrem persönlichen Namen, einem geläufigen und einem postumen Namen genannt. Dabei wird deutlich, was Namen auch immer waren: ein wichtiger Ausdruck personaler Identität einerseits, aber auch ein Ausdruck von Verwandtschaftsbeziehungen. Generell galt die Vergabe des Namens immer schon als erster Schritt zur Aufnahme eines Neugeborenen in die jeweilige Gemeinschaft.
In dieser Zeit entstanden zahlreiche Familien- oder auch Klannamen. Es war üblich, dass die chinesischen Herrscher ihre Familiennamen an ihre Untertanen weitergaben, um sie an sich zu binden. Dies hatte zur Folge, dass es zahlreiche Menschen mit ein und demselben Familiennamen gab, die allerdings nicht miteinander verwandt waren.
Das Chinesische kennt keinen Begriff für »Name«. »Mingzi« oder »ming« steht für den persönlichen (gegebenen) Namen und »xingshi« für den Familiennamen. Ursprünglich bezeichneten »xing« den Stamm oder die Sippe der Mutter und »shi« eine Untergruppe des Stammes (nach dem Vater, nach einem Ort, einer Region etc.). In der westlichen Zhou-Dynastie gab es nicht mehr als dreißig Bei- oder Familiennamen, von denen die meisten das weibliche Schriftzeichen für »Mutter« beinhalteten.
Eine der ältesten Listen von Familiennamen stammt aus der nördlichen Song-Dynastie (960–1127) und nennt 472 Familiennamen. Das »Buch der Hundert Familiennamen« (»Bai Jia Xing«) war bis in die 1950er-Jahre ein wichtiges Lehr- und Sachbuch. Es enthält nicht nur Personennamen, sondern auch historische und sprachwissenschaftliche Informationen.
Aus dem Lebensalltag
Im deutschen Sprachraum waren es die Germanen, die Namen einführten. Wobei man hier eher von Rufnamen sprechen muss, da die Nachnamen erst viel später dazukamen. Der indogermanische Sprachraum ist ziemlich weitläufig. Altindisch zählt sogar dazu, Altslawisch, Altgriechisch und auch Keltisch und Althochdeutsch. Allen indogermanischen Namen ist eines gemein: Die meisten sind zweigliedrig und leiteten sich aus dem allgemeinen und alltäglichen Wortschatz her. Das waren also keine Fantasiegebilde, wie oft heute, oder gar aus einer anderen Sprache oder Kultur übernommen, sondern ganz normale Wörter für Eigenschaften, Ereignisse, Tiere, Gegenstände aus der Sprache der Menschen, die auch oft gebraucht wurden. »Selten und ungewöhnlich« ist bei der Namensgebung ein Produkt unserer Zeit.
So kombinierten die alten Inder die Wörter für »gut« (»vásu«) und »gegeben« (»dattah«) zum Namen »Vásudattah«. Die Griechen die Wörter für »Volk« (»demo«) und »mächtig« (»sthenes«) zum Namen »Demosthenes«; die Kelten die Worte für »Kampf« (»cato«) und »Herrscher« (»rix«) zum Namen Catorix; die Slawen die Wörter für »herrschen« (»vladi«) und »Frieden« (»mir«) zum Vladimir.
Auch die alten Germanen verfuhren auf diese Weise, vermutlich schon lange vor Christi Geburt. Von germanischen Namen hört man erstmals aus den Aufzeichnungen griechischer und römischer Autoren, wie zum Beispiel Tacitus, der um 100 nach Christus die germanischen Namen Catumer, Catvald und Segimund erwähnte.
Jede Namengebung bei den Germanen war eine Neuschöpfung. Ausdrücke aus dem religiösen und kriegerischen Leben wurden dem Neugeborenen im Namen als Wunsch mit auf den Weg gegeben. Die Namen bestanden in der Regel aus zwei Elementen vor allem aus den Bereichen »Volk« (Volkmar), »Heimat« (Landfried, Roland), »Verwandte«, »Freunde« (Winfried, Hariman), »Besitz« (Udalrich), »Adel«, »Herrscher« (Adelheid, Adalwolf, Waldfried, Walthari), »Krieg«, »Kampf«, »Streit« (Gundhari, Gundhild, Hadumar, Badumar), »Waffen« (Gerhard), »Heidentum«, »Götter« (Albwin, Ingomar, Wandalmar, Swabwald, Gottfried, Thorwin) oder »Eigenschaften« (Baldowin, Hartfried, Fromut, Wignand).
Erstaunlicherweise gibt es heute gar nicht mehr so viele Namen germanischen Ursprungs. Einer der bekanntesten ist von seiner Herkunft sehr transparent: Siegfried, ein zweigliedriger Name, der sich zusammensetzt aus den Elementen »Sieg« und »Frieden«. Wobei die Worte sowohl als erstes wie auch als zweites Glied auftauchen konnten. Richard (der sich aus »reich« und »hart« zusammensetzt) ist heute ebenfalls noch populär und geläufig.
NAMENZITATE
Nomen est omen. Plautus
Ein hohes Kleinod ist der gute Name. Friedrich Schiller
Ein Leben dauert eine Generation lang; ein guter Name dauert fort. Aus Japan
Der einzige Name, der den Menschen wirklich charakterisiert, ist der Spitzname. Unbekannt
Ein guter Name ist mehr wert als Geld. Peter Sirius
Es fehlt in deinem Wortregister – mein werter Name? Nun, da ist er! Wilhelm Busch
Weil er sich einen schlechten Namen gemacht hatte, legte er sich ein gutes Pseudonym zu. Gerd W. Heyse
Zeichen von Kampf und Krieg
Was man dabei erkennt: Viele germanische Namen haben kriegerische Wurzeln und Bestandteile, sie waren ja ein kriegerisches Volk. Und ihren Kindern gaben sie im Namen den Wunsch mit, dass sie tapfere Krieger sein mögen. Die alten Germanen hatten sechs Wörter für Krieg, Kampf oder Streit, die allesamt zu Namensteilen wurden: hild, gund, had, bad, bag und wig. Man fand sie in Namen wie Badumar, Wigbald, Wigand, Hildebrand, Gundmar, Hadubrand oder Baghild. All das sind natürlich längst vergessene Namen, aber auch viele heute noch bekannte germanische Namen tragen das Kriegerische in sich. Zum Beispiel die Hildegard, die sich zusammensetzt aus den althochdeutschen Worten für Kampf (»hilta«) und Schutz (»gard«). Ebenso Hildegund, was frei übersetzt bedeutet »die in der Schlacht Kämpfende«. Oder Gerhard, der den Wurfspeer »Ger« im Namen trägt. Wobei auch der hintere Namensteil heute noch leicht identifizierbar ist, bedeutet doch »hard« nichts anders als »hart«, »stark« oder »fest«. Gerhard ist also der »feste Speer«. Während Namen wie Rüdiger (vor allem dessen Urform Rutger) zeigen, dass der Speer natürlich auch im hinteren Teil des zweigliedrigen Namens vorkommen kann. Rüdiger/ Rutger bedeutet so viel wie »ruhmreicher Speer(werfer)«, denn »rut» leitet sich ab vom germanischen Wort »hroth» bzw. »hruoth« und heißt »Ruhm« oder »Ehre«.
Es war also ein wildes Kombinieren der verschiedenen Worte. Sehr beliebt, und in diesem Namensystem auch leicht möglich, war es, Bestandteile der Namen von Vater und Mutter (oder auch aus den Namen von Großvater, Großmutter, Onkel, Freund, Herrscher) im Namen des Kindes zu kombinieren. Und so hieß die Tochter von Gundharde und Hildebrand dann eben Gundhilde. Nicht ganz klar ist, ob man den Namen schon bei Geburt bekam oder erst später, und ob die Germanen bei der Vergabe des Namens schon darauf achteten, dass er auch passte. Dass der Bernhard eben wirklich »stark wie ein Bär« war, wie sein Name aussagt – und kein mickriger Hänfling. Es gab aber sicher eine Namenweihe, so wie bei vielen Naturvölkern. Ein großes Fest, bei dem das Kind rituell in die Gemeinschaft aufgenommen wurde und seinen Namen verliehen bekam.
Natürlich gab es bei so einem Kriegervolk auch die »Burg« (bedeutet so viel wie »Schutz«), die man heute leicht in Burghard/Burkhard findet. Ein weiteres Wort, das sich oft in Namen findet, ist »trud« was so viel bedeutet wie »Stärke/Kraft« und uns in Gertrud oder Edeltraud begegnet. Den im Kampf erforderlichen »Mut« finden wir natürlich auch sehr oft, zum Beispiel in Hartmut (»der mit dem festen Mut«).
Tierisches
Neben dem Krieg liebten die alten Germanen auch Tiere. Das zeigt sich in weiteren Namenkombinationen. So steckt im Bernhard vorn der »Bär«, während uns im obligaten zweiten Namensteil wieder »hard« begegnet. Natürlich passt hier der Wolfgang, der bedeutet tatsächlich genau das, was man heute noch liest: der Mann, der geht wie ein Wolf. Auch andere Tiere finden sich: der Rabe als »ram« (und dazu noch der Wolf) zum Beispiel in Wolfram. Oder auch der Adler (»Aran«) war, wie im heute fast vergessenen Namen Arnfried, ein ebenfalls von den Germanen sehr verehrtes Tier. Ebenfalls in diese Reihe passen der Eberhard (was frei übersetzt so viel bedeutet, wie »stark wie ein Eber«).
Auch in den Namen Hengist (Hengst), Hiruz/Herzo (Hirsch), Welfhard/Welfo (junger Hund, junges Tier), Berowelp (kleiner Bär), Hunibald (junger Bär), Lewohard (Löwe), Hundbald/Hundo (Hund) und Marabert (»marah« bedeutete »Pferd«; davon abgeleitet heute: Mähre), oder bei den Frauen Swanhild (Schwan), Swala (Schwalbe), Bera/Birina (Bärin), Tupa (Taube) oder Hinta (Hirschkuh) wurden Tiere verewigt.
SO SOLLST DU SEIN!
Namen wurden auch aus Charaktereigenschaften abgeleitet. Das Adjektiv »edel« (oder »adel«) taucht relativ oft auf, bekannt in Namen wie Edelgard, Edeltraut, Adelbert. Und es heißt genau das – edel. Und ein in einem anderen Kapitel noch näher behandelter Tabuname (siehe Seite 75 ff.) ist eine althochdeutsche Wortkombination aus zwei damals gebräuchlichen Worten: Abgeleitet von »adal« (»edel« oder »vornehm«) und »wolf« entstand der Adalwolf, der später zum Adolf wurde.
Beispiele für tierische Namen
Eingliedrig, zweigliedrig, dreigliedrig
Diese beiden Bestandteile waren jeweils relativ frei kombinierbar. Also gab und gibt es die Hildegund, aber auch die Gundhild. Den Siegfried und den Gerhard, aber auch den Gerfried und den Sieghard. Und so weiter. Wobei die Germanen ebenfalls schon Anwandlungen heutiger Helikoptereltern zeigten. Denn ging es anfangs bei der Kombination beider Bestandteile noch rein nach der Bedeutung und dem Sinn, setzte sich auch hier schon bald der Modename durch. Man ging nicht mehr nach der Bedeutung, sondern nach der Klangfärbung und dem persönlichen Geschmack. Gundhild ist so ein früher Modename, bei dem die reine Bedeutung schon zweitrangig war. Denn sowohl »gund« als auch »hilt« bedeuten ja Kampf. Und zweimal Kampf, das hätten selbst die frühen Germanen nicht kombiniert.
Einsilbige Namen waren damals sehr selten, es gab sie aber: Karl und Ernst etwa, oder verkürzte Formen wie Bruno, Berno oder Arno. Zudem entstanden zahlreiche Lall- und Koseformen wie zum Beispiel »Poppo« für Volkmar, »Ludo« für Liudolf, »Anno« für Arnfried oder »Wolfo/Woffo« für Wolfgang.
Die ersten Quellen für germanische Namen finden sich im 1. Jahrhundert nach Christus. Also relativ spät. Da waren die Römer und Griechen und eben die Chinesen schon viel weiter. Die Römer hatten schon weit vor den Germanen Familiennamen, ja sogar eine dreigliedrige Struktur. Der römische Name bestand aus einem Pränomen, einem Gentilnomen und einem Cognomen. Oder einfacher gesagt: aus einem Vornamen, einem Familiennamen und einem Spitznamen. Das lässt sich an einem der berühmtesten Römer veranschaulichen – Julius Caesar. Der hieß ja eigentlich Gaius Julius Caesar. Wobei Gaius der Vorname im heutigen Sinne war. Julius war dagegen der Familienname, denn er entstammte dem Geschlecht der Julier.
Caesar ist also der Spitzname von Julius Gaius und soll angeblich auf das lateinische »caedere« zurückgehen, was so viel bedeutet wie »ausschneiden«. Es wurde als »der aus dem Mutterleib Geschnittene« interpretiert, also der per Kaiserschnitt Entbundene. Allerdings gab es diesen in unserem Sinne damals noch nicht. Aber noch heute heißt der Kaiserschnitt im Spanischen »cesárea«. Interessant ist, dass der Name Caesar als Herrschaftstitel im Römischen Reich aufkam und die Bezeichnung »Kaiser« davon abgeleitet wurde.
HINZ UND KUNZ
Nur die männlichen Adligen hatten drei Namen, einfache Bauern, Sklaven oder Frauen spielten in der damaligen Gesellschaft keine Rolle und hatten nur einen Namen. Das war später auch im deutschen Sprachraum nicht anders. Der Adelige hatte einen langen und mehrteiligen Namen, hieß dann eben »Konstantin vom Rabenstein«, während der einfache Bauer einen einzigen Namen hatte und dann auch oft nur eine Kose- oder Kurzform. Wie eben »Hinz« oder »Kunz«, statt Heinrich und Konrad, die eigentliche Form beider Namen. So entstand die Redewendung: Weil so viele Menschen Heinrich oder Konrad hießen, wurde beider Koseform schnell zum Synonym für die »breite Masse«.
Leit- und Familiennamen
Der Name war auch immer ein Statussymbol. Wobei sich hier bei einfachen Bürgern Zweit- bzw. Familiennamen durchsetzten, schon aus Gründen der Unterscheidbarkeit. Wo viele »Hinzens« lebten, da war es nötig, zu wissen, welcher denn nun gemeint war. Heinrich der Lang(e), Heinrich der Kurz(e), Heinrich der Metzger, Heinrich der Müller oder Heinrich, der Besitzer des kleinen Ladens (Winkler).
Das aber passierte erst seit dem 12. Jahrhundert nach und nach. Während es in Italien oder Spanien bereits im 8. oder 9. Jahrhundert Familiennamen gab, dauerte es im deutschen Sprachraum etwas länger. Später wurden diese Beinamen dann vererbt, und ab dem 14. Jahrhundert spricht man schon von Familiennamen, die vom Vater auf den Sohn übergingen.
Beim Adel wird es zuerst üblich, den Rufnamen weiterzuvererben. Es entsteht ein sogenannter Leitname: Beispiele sind Karl und Ludwig bei den Karolingern, Otto bei den sächsischen Kaisern, Poppo bei den Hennebergern, Friedrich bei den staufischen Adligen oder Balduin bei den Grafen von Flandern.
Hier einige weitere Beispiel für Leitnamen:
Welfen und Staufer (1120–1252): Heinrich, Friedrich, Otto, Wilhelm, Philipp, Gertrud, Lothar, Judith, Agnes, Mechthild, Wulfhild
Askanier (1123–1267): Otto, Hermann, Dietrich, Adalbert, Heinrich, Siegfried, Albrecht, Johann, Bernhard, Mechthild, Elisabeth, Sophia
Ludowinger (1131–1247): Ludwig, Heinrich, Friedrich, Hermann, Konrad, Dietrich, Sophia, Gertrud, Irmgard, Jutta, Elisabeth, Agnes
Wettiner (1156–1291): Heinrich, Konrad, Dietrich, Friedrich, Albrecht, Adelheid, Dedo, Gertrud, Sophia, Agnes, Oda
Zurück zu den Germanen. Die waren, wie gesagt, sehr kriegerisch veranlagt, und das brachte es mit sich, dass sie sich auch territorial ausbreiteten. Im 6. Jahrhundert war die Hälfte der Rufnamen in Frankreich germanischen Ursprungs. Aber auch auf der iberischen Halbinsel breiteten sie sich aus. Das hat Spuren hinterlassen – ganz erstaunliche Spuren in der heutigen Weltsprache Spanisch und damit auch in der Namengebung. Zunächst einmal haben die alten Germanen eines ihrer Lieblingswörter eingeführt. Das spanische Wort »guerra« für Krieg stammt vom germanischen »werra« (steckt noch im heutigen »wehren«) ab.
Auch viele bekannte spanische Namen haben eindeutig germanischen Ursprung. Fangen wir bei meinem Namen an, den ich durch die Heirat mit Herrn Rodríguez bekommen habe. Rodríguez ist der »Sohn des Rodrigo«, und der wiederum hat seinen Ursprung im … Roderich. Da sind sie wieder, die zwei Bestandteile des germanischen Namens: »rod« heißt so viel wie »Ruhm« und »rich« nichts anderes als »reich«. Rodrigo, der Ruhmreiche. Der Name gelangte auf die iberische Halbinsel, weil der Westgotenkönig Roderich diese im 5. Jahrhundert eroberte. Und nach ihm wurden dort viele Kinder benannt. Überhaupt waren natürlich Herrschernamen immer sehr beliebt. Auch viele andere spanische Namen haben einen germanischen Ursprung, eigentlich alle, die zum Beispiel auf »-ez« enden. Und das sind viele: Sanchez, Alvarez, Rodríguez, Ramírez, González, Fernandez. Fernandez ist der Sohn von Fernando, und der stammt von »unserem« Ferdinand ab. Denn »nand« (»nanth«) bedeutete so viel wie »kühn« (das Kriegerische ist halt immer da) und »frith«, woraus sich »ferdi« entwickelte, in etwa »Schutz, Sicherheit«. Der Gonzalez ist analog dazu der Sohn des Gonzalo, und der wiederum geht auf den germanischen Gundisalvus zurück. Und auch hier wieder: das Element »gund« für Krieg. Allein diese drei Namen decken den Großteil der spanisch sprechenden Bevölkerung ab. Wenn die wüssten, dass sie einen germanischen Namen haben …
Interessant ist, dass der heute nahezu vergessene Name Bringfried oder Bringfriede, den man eindeutig in diese Zeit der alten Germanen verorten würde, erst vor gut Hundert Jahren während des Ersten Weltkriegs entstand – und genau das ausdrückte: die Sehnsucht der Menschen nach Frieden, die man dem Kind schon im Vornamen mit auf den Weg geben wollte.
Das Comeback im Heute
Seit einigen Jahren gibt es eine Rückbesinnung auf die zuvor selten gewordenen altdeutsch-germanischen Namen. Sie werden seit etwa zehn Jahren wieder verstärkt vergeben. Besonders männliche Vornamen, und das nicht nur zu Ehren des Großvaters als Zweit- oder Drittname, sondern auch als Rufname. Junge Eltern sagen immer wieder zu mir, dass Otto ein niedlicher Name sei. Noch vor 20 Jahren hätte niemand sein Kind Otto genannt.
Die jungen Leute nehmen diese alten Namen aber ganz anders wahr als die ältere Generation. Da sie kaum noch (ältere) Verwandte haben, die solche Namen tragen, erscheinen sie ihnen auch nicht als altmodisch und verstaubt. Sie haben auch keine Abgrenzung mehr nötig, weder zu dieser Generation noch zu deren Namen. In meiner Großeltern-Generation erscheinen zum Beispiel Namen wie Friedrich, Heinrich, Richard, Ludwig, Leopold, Otto, Oskar, Gustav, Karl oder Bruno, die allesamt heute wieder modern sind und zu den häufig vergebenen Namen gehören.
Auch die weiblichen Formen Frieda, Ida und Wilhelmine sind heute wieder beliebt. Der weibliche Name Ida etwa ist schon seit über 1400 Jahren bezeugt. Ida war die Gattin Pipins I. im 7. Jahrhundert. Er wirkt heute wieder wegen seiner Lautstruktur sehr weiblich und modern.
Bereits vor etwas mehr als Hundert Jahren gab es so eine Rückbesinnung auf altdeutsch-germanische Rufnamen.
Im Jahr 1846 lobte die »Berliner Akademie der Wissenschaften« einen Preis für denjenigen aus, dem es gelang, ein Wörterbuch der alten deutschen Namen bis zum Jahre 1100 zu erstellen. Lediglich einer, der Historiker und Bibliothekar Ernst Förstemann (1822–1906), stellte sich dieser Herausforderung. Er bekam den Preis aber nicht und musste sich viel Kritik anhören, aber sein monumentales Werk »Altdeutsches Namenbuch« aus dem Jahr 1857 ist trotz einiger Mängel bis heute für Namenforscher ein Standardwerk. Und auch viele Eltern, die heute nach einem besonders ungewöhnlichen Vornamen fahnden, entdecken irgendwann dieses Nachschlagewerk – mit Namen, die mehr als Tausend Jahre alt sind. Wenn sie sich zudem für die germanische Geschichte interessieren, ist dieses Werk eine wahre Fundgrube.
So baten mich Eltern einmal um die Bestätigung des weiblichen Vornamens Isika. Er klang für mich recht modern, und ich hatte ihn vorher noch nicht gehört. Sie hatten aber eben in diesem »Altdeutschen Namenbuch« den männlichen Namen Isiko entdeckt, der im 10. Jahrhundert belegt ist und eine Kurzform eines zweigliedrigen Namens mit dem althochdeutschen Element »īs« für »Eisen, Waffe« ist. Er gefiel ihnen und deshalb bildeten sie kurzerhand die weibliche Form »Isika« dazu. In altdeutschen Rufnamen erscheint übrigens »Isan-« oder »Isen-« (also »Eisen«) oft als Erstelement in zweigliedrigen männlichen Namen wie Isenbert oder Isenhard.
Auch wieder sehr populär bei Eltern des 21. Jahrhunderts sind die männlichen Vornamen Eisenherz, Eisenhard, Eisenhans sowie Frowin. Da sie aber bei den Behörden heute überhaupt nicht mehr bekannt sind, müssen sie oft von uns bestätigt werden. Auch Löwenherz wird als eine Neubildung und in Anlehnung an Richard Löwenherz als männlicher Vorname eingetragen.
Manche Eltern graben regelrecht in Geschichtsbüchern auf der Suche nach alten vergessenen Namen und historischen Gestalten. Ich kenne eine kinderreiche Familie in Brandenburg, in der alle Kinder mehrere germanische Namen erhielten. Unter anderem sind dort zu finden: Rikimer, Nestika, Svanhild, Vitigis, Sigisleif, Leovigild, Alarich, Dagaleif, Vidukind, Irmelin, Hildigis, Heilika und Godelinda. Auch Namen wie Erelive (das war der Name der Mutter des Ostgotenkönigs Theodorichs des Großen im 5. Jahrhundert), Hludana (eine nordgermanische Göttin), Hoamer (Name eines ostgermanischen Wandalen- Königs) und Hengist (er war der zweite Heerführer der Angelsachsen im 5. Jahrhundert) finden sich in dieser Familie.
Eine andere Familie nannte ihren Sohn Thumelikar. Der war der im Jahr 15 nach Christus geborene Sohn des Cherusker-Fürsten Arminius (auch bekannt als Hermann der Cherusker) und seiner Gattin Thusnelda (der Tochter des Cherusker-Fürsten Segestes). Die erste Silbe des Namens stammt von der Mutter.
TUSSI MIT NIVEAU
Apropos Thusnelda: Letztens rief mich eine ältere Dame an und wollte ein paar Dinge zu ihrem Familiennamen wissen. Nachdem ich ihr einige Auskünfte dazu erteilt hatte, erzählte sie mir, dass sie Thusnelda hieße und meist »Tussi« gerufen würde. Sie war stolz auf ihren Vornamen, und sie störte sich nicht daran, dass er eher negativ assoziiert wird. Dies war aber nicht immer so. Erst im Alter konnte sie sich mit ihrem Namen versöhnen. Erstaunlich finde ich, dass es diesen Namen heute nur noch höchstens 65-mal in Deutschland gibt. Früher was Thusnelda ein gängiger Mädchenname. Seine Bedeutung ist aber nicht eindeutig geklärt. Der vordere Namensteil kann »þūs« (»Kraft«), oder auch »thursa« (»groß, gewaltig«) bedeuten. Der zweite Teil kann sich aus »hildjō« (»Kampf, Schlacht«) oder aus dem althochdeutschen »snel« für »schnell, tapfer« herleiten. Wie auch immer: Heute wird dieser Name nicht mehr eingetragen. Anders als die Kurzform Nelda, die aber nicht mit Thusnelda in Verbindung gebracht wird.