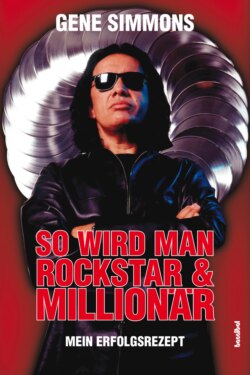Читать книгу So wird man Rockstar und Millionär - Gene Simmons - Страница 12
Оглавление„Früh ins Bett und früh aus dem Bau, das macht einen Mann gesund, wohlhabend und schlau.“
BENJAMIN FRANKLIN
(Gründungsvater, Erfinder des Blitzableiters, der Bifokalbrille und des Franklin-Stubenofens. Pionier bei der Entdeckung der Elektrizität, Mitautor der Unabhängigkeitserklärung, erster US-Botschafter in Frankreich und Unterzeichner der Unabhängigkeitserklärung sowie der Verfassung der Vereinigten Staaten von Amerika.)
Nach einem Jahr waren Mutter und ich endlich in der Lage, in ein Apartment zu ziehen, das nur einige Blocks von der Yeshiva University entfernt lag. Die Miete betrug 35 Dollar im Monat.
Wir konnten uns keinen großen Luxus erlauben, doch wir besaßen wenigstens einen kleinen Fernseher. Nachdem die Kiste in der Wohnung stand, hatte ich das Gefühl, als würde sich mir die Welt eröffnen. Ich sah die Nachrichten. Ich sah Superman. Ich schaute Zeichentrickfilme. Ich schaute Spielfilme. Ich lernte mehr vom Fernsehen als von jedem anderen Medium, mit dem ich mich jemals auseinandersetzte. Mehr als aus Büchern. Mehr als von den Lehrern und in der Schule.
Das Fernsehen öffnete mein Bewusstsein für Fantasy. Für Science Fiction. Für die Realität, und zwar durch die Nachrichtensendungen. Fernsehen wirkte direkt und unmittelbar. Besonders die Adventures Of Superman waren für mich eine Offenbarung: Oh mein Gott. Dieser Mann kann durch die Luft fliegen und stammt noch nicht mal aus den USA – so wie ich ist er auch ein Einwanderer. Das Fernsehen zeigte mir damals wie auch heute noch, dass es für die Vorstellungskraft keine Schranken oder Barrieren gibt. Keine Idee ist zu fremdartig oder abwegig, als dass man ihr nicht nachgehen könnte – im Geschäfts- wie auch im Privatleben.
Da ich den Tag an der Yeshiva verbrachte, hatte ich unter der Woche kaum Zeit zum Fernsehen. Aber an den Wochenenden – ja, sogar am Sabbat, der bei uns am Samstag begangen wurde – klebte ich förmlich vor der Flimmerkiste, oft sogar den ganzen Tag und abends so lange ich durfte. Manchmal blieb ich bis zum Sendeschluss wach und starrte auf den leeren Bildschirm, nachdem die vier oder fünf lokalen Sender, die uns damals zur Verfügung standen, abgeschaltet hatten.
Durch das Fernsehen lernte ich, wie man mit einem sogenannten „midatlantic accent“ sprach, der vor allem in New York, New Jersey und Pennsylvania üblich ist und sich von da aus ausbreitete. Es handelt sich um den von Nachrichtensprechern in allen Teilen des Landes gesprochenen Tonfall des amerikanischen Englischs, egal, ob sie aus dem Süden stammten (wo die Silben von der Bevölkerung eher ausgewalzt werden) oder aus dem Norden (wo die Silben von der Bevölkerung eher verkürzt werden).
Das faszinierte mich, denn ich war in die USA eingereist, ohne eines einzigen Wortes der Sprache mächtig zu sein. Und so machte ich es einfach den Nachrichtensprechern nach. Zugleich bemerkte ich, dass sie stets bessere Kleidung trugen als die Menschen auf der Straße, was ihnen einen Hauch von Autorität verlieh. So lernte ich ihre Sprache – ohne Akzent –, und sogar heute noch höre ich Kommentare von Leuten, die meinen, ich redete wie ein Nachrichtensprecher.
Ich erinnere mich, dass ich 1959, ein Jahr nach unserer Ankunft in den USA, einen Freund in seinem Apartment in Brooklyn besuchte und einen hohen Stapel Comics sah, aufgetürmt in einer Ecke. Vor diesem Tag hatte ich noch nie etwas von Comics gehört, geschweige denn, einen gesehen. Damals besuchte ich noch die Yeshiva University und versuchte, die englische Sprache zu kapieren. Ich konnte nur wenige Bocken, und die nur mit einem breiten israelischen Akzent. Mein Freund und ich setzten uns vor den Stapel, und er reichte mir den ersten Comic.
Ich kann mich noch ganz genau erinnern. Er stammte aus der Serie World’s Finest Comics und beinhaltete Superman (den Mann also, denn ich im Fernsehen gesehen hatte, wie er durch die Luft raste) und Batman. Mich beeindruckte die Tatsache, dass es sich hier um keine gewöhnlichen Menschen handelte. Es waren außergewöhnliche Menschen, die außergewöhnliche Leben führten. Und immer gab es ein Gut und ein Böse.
Ich wurde augenblicklich süchtig und verschlang Comics. Das mache ich immer noch, so, wie offensichtlich die ganze Welt. Comics, einst ein verhältnismäßig kleines Underground-Phänomen, werden mittlerweile längst als ein einflussreiches kulturelles Genre und eine nicht zu unterschätzende Wirtschaftkraft anerkannt. Die jährlich in San Diego stattfindende Comic Con hat sich von einer eintägigen Veranstaltung mit 145 Besuchern zu einem viertägigen Event entwickelt, der Hunderttausende anzieht, ähnlich dem Filmfestival in Cannes, und zahlreiche Ableger in aller Welt hervorrief.
Die kulturelle Energie der Comics, der Fantasy und der Science Fiction lässt sich am zeitgenössischen Einfluss auf die Popkultur ablesen und bedingte Multimillionen-Dollar Ableger wie Star Wars, Superman, The Avengers, Avatar und Der Herr der Ringe. All die Hollywood-Blockbuster-Franchise-Unternehmen erwuchsen aus derselben Welt der Fantasy, der Sci-Fi und der Comics, die einst als „Kinderzeug“ galten.
Der erste World’s Finest Comic markierte für mich den Beginn einer lebenslangen und obsessiven Leidenschaft. Und wie auch auf allen anderen Gebieten, für die ich eine Passion entwickelte, mutierte ich quasi zu einem Besessenen, was die winzigsten Details anbelangte. Ich kann sogar „Psalme und Zeilen“ des „Alten Testaments“ der Comics zitieren. Ohne zu überlegen, erzähle ich die Geschichte von Hulk: des ersten grauen Hulks, geschrieben von Stan Lee, gezeichnet von Jack Kirby und koloriert von Dick Ayers, aus dem die „grüne Version“ erwuchs und dann die rote. Ich weiß sogar, in welcher Ausgabe von Der unglaubliche Hulk Steve Ditko die künstlerische Leitung übernahm. Ja, der Spider-Man-Künstler zeichnete einige Zeit tatsächlich den Hulk. Ohne Probleme kann ich alles über Iron Man berichten, der von Jack Kirby und Dick Ayers gezeichnet wurde. Ich weiß genau, bei welchen späteren Ausgaben Don Heck als Künstler tätig wurde. Das waren meine modernen Mythen, meine Samsons, meine Davids und Goliaths. Aus ihnen erwuchs die Blaupause für Gut und Böse, meine persönlichen Archetypen der Tugend.
Meine „Rock On“-Handgeste, die sich zu einem Markenzeichen entwickelte – meist wird sie als „devil’s horns“ oder „Teufelszeichen“ beschrieben und ist mittlerweile in jeder Sportarena und bei jedem Rockkonzert irgendwo auf der Welt zu sehen – begann als ein Hommage an Steve Ditkos Dr. Strange. Dieser Charakter benutzte das Zeichen, um seine magischen Kräfte zu evozieren („Möge der gefürchtete Dormamu seinen Zorn auf euch richten“). Wenn Spider-Man, ein weiterer Charakter von Ditko, das Spinnennetz oder die Spinnenfäden aus dem Handgelenk schossen, benutzte er die gleiche Geste, nur in einem anderen Winkel.
Damals hätte ich mir nicht in den wildesten Träumen vorstellen können, dass die USA mir erlaubten, selbst ein Comic-Superheld zu werden! KISS-Comics wurde in den späten Siebzigern von Marvel publiziert und avancierten zum am besten verkauften Titel – bei einem Preis von 1,50 Dollar die Ausgabe, während andere Comics für 25 Cents über die Theke gingen. Das KISS-Comic wurde in Magazingröße aufgelegt, also nicht im üblichen kleineren Format, um es neben Time und ähnlichen Titeln einzusortieren. Ich kann voller Stolz berichten, dass ich mit den Bandkollegen in der ersten Ausgabe gegen Dr. Doom kämpfen musste und die Fantastischen Vier traf.
Auch hätte ich nie ahnen können, eines Tages die Simmons Comics-Produktserie zu besitzen und damit einhergehend die Freiheit, eigene Comic-Charaktere und Titel zu kreieren.
Doch ich nehme schon zu viel vorweg.
1959 war ich neun Jahre alt und besuchte die Yeshiva sechs Tage die Woche. Wenn ich nicht in der Yeshiva studierte, saß ich in der von uns nur drei Blocks entfernten Bibliothek. Voller Freude erfuhr ich, dass dort alles kostenlos war. Damals verstand ich die geschichtliche Bedeutung dieses Ansatzes im Gegensatz zu heute noch nicht.
Zum ersten Mal im Leben befand ich mich an einem Ort, wo die Ärmsten der Armen und die Wohlhabendsten der Reichen denselben Zugang zu Informationen hatten – und das umsonst und auf einer identischen Ebene. Ohne Zensur! Ohne Nazis, die Bücher verbrennen. Ohne Menschen anderer Religionen, die Ungläubige bei lebendigem Leib am Spieß braten wollen. Hier gab es die uneingeschränkte Freiheit und den Zugang zu jeglichen Informationen, zu Kunst und Kultur aus aller Welt.
Damals gab ich mir das Versprechen, mich selbst zu bilden und nie mit dem Lernen aufzuhören. Die stetige Fortbildung lag ganz allein in meiner Verantwortung. Ich verbrachte an den Wochenenden Stunden in der Bibliothek und verschlang alles, was mir in die Hände kam. Bücher über Dinosaurier. Geschichtsbücher. Ich las beinahe die gesamte Encyclopaedia Britannica. Und das alles kostenlos.
Es gibt einen Grund, warum ich all das erzähle: Ich möchte, dass du es dir zu Herzen nimmst und verstehst – die Verantwortung für Bildung liegt einzig und allein bei dir. Es ist nicht wichtig, ob du über Qualifikationen verfügst – geh raus und lerne, und du wirst dir nach und nach eine Qualifikation aneignen. Niemand wird mit idealen Voraussetzungen oder perfektem Können geboren – man muss sich alles durch harte Arbeit aneignen.
Mir standen meine geliebten Bücher zur Verfügung. Ich hatte die Comics. Ich konnte fernsehen. Das alles waren Medien des Autodidaktentums. Was brauchte ich denn sonst? Ich schätze mal, ich führte ein beschütztes Leben, denn meine Mutter wünschte sich für mich nur das Beste, und darin liegt der Grund, warum sie mich zur Yeshiva schickte. Sie wollte mich von der Straße fernhalten und meine Sicherheit vom frühen Morgen bis zum späten Abend gewährleistet sehen, wenn sie von einem harten Arbeitstag nach Hause kam. Sie stand schon am frühsten Morgen auf und kam erst um 19 Uhr zuhause an. Täglich musste sie von Jackson Heights nach Brooklyn fahren, um Knöpfe für eine Bezahlung anzunähen, die unterhalb des Mindestlohns lag. In diesen Stunden wollte sie mich sicher wissen, denn es gab in unserem Stadtteil Straßengangs, und als Jude war man nicht unbedingt populär. Tatsache ist: Als Jude war man noch nie sonderlich beliebt.
Und das trifft auch heute noch zu.
Damals war Williamsburg ein Stadtteil, in dem verschiedene Kulturen zusammenarbeiteten und -lebten: Juden, Afroamerikaner, Puerto Ricaner und andere. In der heutigen Ausdrucksweise würde man es als Ghetto bezeichnen. Mal beiläufig gesagt: Die meisten Amerikaner wissen nicht, dass Ghetto ursprünglich ein venezianischer Begriff ist, der ein abgetrenntes Viertel beschreibt, in dem Juden leben. Der Terminus hat für mich natürlich eine besondere Bedeutung.
Während der italienischen Renaissance, als sich Juden in den italienischen Stadtstaaten als Handwerker, Händler und Kaufleute hocharbeiteten, erlaubte man ihnen nur in einem bestimmten Teil der Stadt (Getta) zu leben – weit weg vom Zentrum, wo die Ziegel für Bauwerke gefertigt wurden. Dort standen große Brennöfen, an denen Männer rund um die Uhr arbeiteten. Es erübrigt sich eigentlich, darauf hinzuweisen, dass die Lebensbedingungen schrecklich waren und dicker Rauch Tag und Nacht in der Luft hing. Dort entstand der Begriff Ghetto. Als die polnischen Juden im Zweiten Weltkrieg gegen die Besatzung der Nazis rebellierten, trieb man sie in einen Stadtteil, genannt Warschauer Ghetto …
Meine Mutter arbeitete in einem Ausbeuterbetrieb – sechs Tage die Woche. Es gab keinen Mindestlohn. Es war damals der einzige Job in New York, den sie mit Blick auf ihre handwerklichen Fähigkeiten ausüben konnte. Sie nahm einen Wintermantel vom Kleiderbügel, trug ihn zu ihrer Singer-Nähmaschine, nähte sechs bis acht Knöpfe an, hängte ihn wieder auf den Bügel und trug den Mantel danach in eine andere Abteilung. Dann wiederholte sie den Arbeitsprozess – wieder und wieder.
Pro Knopf verdiente Mum einen halben Penny. Wenn meine liebe Mutter also einen Mantel nahm, sechs Knöpfe annähte und ihn dann wieder aufhängte, bedeutete das einen Verdient von drei Cent. Irgendwie gelang es ihr mit dieser sechstägigen Schinderarbeit 150 Dollar in der Woche zu verdienen, womit sie in der Lage war, die Miete zu bezahlen, die Nahrungsmittel und die Kleidung.
Für mein Arbeitsethos stellte Mutter das beste Beispiel dar, das man sich vorstellen kann. Durch sie verstand ich den Wert und die Bedeutung von Geld.
Mit 14 Jahren gab ich mir das Versprechen, etwas aus mir zu machen, auch wenn ich dadurch nur meiner Mutter die harte Arbeit ersparen konnte. Und innerhalb von acht Jahren sah ich mich dann in die Lage versetzt, das Leben von Mum substanziell zu verbessern. Wenige Jahre später brauchte sie sich nie wieder abzuplagen.