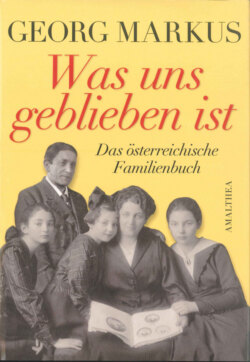Читать книгу Was uns geblieben ist - Georg Markus - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
»AUCH SEIN BETT SOLLTE
RÄDER HABEN« Vom Entstehen des Porsche-Clans
ОглавлениеAutos galten in jenen Tagen als übelriechende Ungeheuer, vor denen die Menschen mehr Angst als Respekt hatten und an deren Zukunft kaum jemand glauben wollte. »Wird aa wieder abkommen«, murrten die Dorfbewohner, wenn so ein stinkendes Gefährt unter enormer Lärm- und Staubentwicklung die Landstraße hinaufzuckelte.
In Maffersdorf freilich, einem Vorort der sehr früh vom industriellen Zeitalter erfassten Stadt Reichenberg in Böhmen, gab es einen kleinen Buben, der sich nicht satt sehen konnte an den sonst so misstrauisch beobachteten Kraftfahrzeugen. Sie übten eine Faszination auf ihn aus, und er träumte von nichts anderem, als selbst einmal so einen Wagen fahren – oder gar bauen zu können.
Da er mit vierzehn noch keine Autos chauffieren, geschweige denn konstruieren konnte, tröstete sich Ferdinand Porsche vorerst mit einer anderen technischen Spielerei, der die Menschen damals ähnlich skeptisch gegenüberstanden. Mit der Elektrizität. Und so brachte er auf dem Dachboden seines Elternhauses durch eine Batterie kleine Lämpchen zum Glühen. Mit unheilvollem Ausgang, denn als ihn sein als cholerisch verschriener Vater bei der Herstellung einer solchen Lichtquelle ertappte, zertrampelte er den »Firlefanz«, nannte seinen Sohn einen elenden Nichtsnutz und untersagte ihm jedwedes weitere Experiment.
Ferdinand Porsche nahm diese Anordnung nicht besonders ernst, er setzte seine Experimente fort – und das für den Rest seines Lebens. Der Grund für die unbarmherzige Reaktion des Vaters Anton Porsche war sein Wunsch, dass der 1875 geborene Ferdinand das Spenglerhandwerk erlernen und später einmal seinen Betrieb übernehmen würde, statt unsinnige Flausen wie Autos und elektrisches Licht im Kopf zu haben, die ohnehin keine Zukunft hätten. Hinter der strengen Forderung des Vaters stand eine Familientragödie: Ferdinands für die Übernahme der Spenglerei ursprünglich vorgesehener älterer Bruder war bei einem Unfall in der familieneigenen Werkstatt ums Leben gekommen, weshalb nun der Zweitgeborene verpflichtet wurde, eine Spenglerlehre zu absolvieren.
Kaum hatte sein Vater jedoch ein paar Tage außerhalb von Maffersdorf zu tun, wurden sie von Ferdinand genützt, um im ganzen Haus heimlich elektrischen Strom zu installieren. Als er heimkam, verfügten Wohnung und Werkstatt nicht nur über eine Klingel, sondern auch über elektrisches Licht. Das war der Moment, in dem Anton Porsche erkannte, dass der Bub für das »möglicherweise doch« anbrechende technische Zeitalter wie geschaffen – und für den Familienbetrieb verloren war. Und er ließ ihn schweren Herzens aus der Spenglerei ziehen, in der nun sein dritter Sohn Oskar ausgebildet wurde.
Ferdinand Porsche ging in die Haupt- und Residenzstadt, mietete sich in einem kleinen Zimmer nahe der Matzleinsdorfer Kirche ein und wurde Praktikant der Vereinigten Elektrizitäts-AG, aus der später die Brown Boveri Werke hervorgingen. Béla Egger, der Chef des Unternehmens, zählte zu den technischen Pionieren der Gründerzeit und hatte sich auf die Elektrifizierung von Eisenbahnen, Fabriken sowie die Errichtung von Kraftwerksanlagen spezialisiert. Porsche beschäftigte sich als einer seiner dreihundert Mitarbeiter mit der Entwicklung des Radnabenmotors, einem revolutionären Elektroantriebssystem, nach dessen Prinzip siebzig Jahre später das erste Mondauto bewegt werden sollte.
Wenn der junge Ferdinand Porsche von seinen Biografen als Workaholic beschrieben wird, der nichts anderes als die Konstruktion von Automobilen im Kopf hatte, dann stimmt das nur bedingt. Denn gerade in der Zeit, als er für Béla Egger tätig war, dachte er sehr wohl auch an sein privates Glück. Eines Tages fiel ihm auf dem großen Werksgelände eine junge Mitarbeiterin namens Aloisia Kaes auf, die 1895 im Alter von siebzehn Jahren als Lager-Buchhalterin bei der Vereinigten Elektrizitäts-AG begonnen hatte.
Porsche zog es nun nicht nur auffallend oft ins Lager, sondern auch vor Aloisias Elternhaus, um das er seine Runden drehte. Zwei Kolleginnen machten die junge Buchhalterin auf den offensichtlichen Verehrer aufmerksam, der zu schüchtern war, sie anzusprechen. Stattdessen besorgte sich Ferdinand Porsche eine Fotografie, auf der alle weiblichen Mitarbeiter der Vereinigten Elektrizitäts-AG abgebildet waren und ließ daraus das Porträt der von ihm angehimmelten Aloisia vergrößern. Er zeigte es ihr – und sie war beeindruckt, dass der junge Mann sich so viel Mühe gegeben hatte, um mit ihr in Kontakt zu kommen. Der Bann war gebrochen, und in den nun folgenden Monaten konnten die beiden einander näherkommen.
Aloisia Kaes war die Tochter eines in Wien ansässigen Schneidermeisters, der aus einer böhmischen Weberfamilie stammte, und auch ihre Mutter Margaretha war böhmischer Herkunft. Wie es sich gehörte, brachte Aloisia ihren Galan bald mit nach Hause, um ihn den Eltern vorzustellen. Ferdinand Porsche, der die nicht besonders zukunftsträchtige Position eines Montagetechnikers innehatte, wurde im Hause Kaes skeptisch betrachtet und von Aloisias Mutter mit den Worten empfangen: »Den hab ich schon öfter gesehen, er schleicht ja immer um unser Haus herum. Ich erkenne ihn an seinem steifen Kragen.«
Tatsächlich legte Porsche mit seinen 22 Jahren Wert auf ein gepflegtes Äußeres, er kleidete sich eleganter als seine Kollegen in der Werkstatt und wurde, weil man ihn meist in schwarzem Anzug und weißem Kragen sah, von Aloisias Brüdern für einen Pfarrer gehalten. Das war er aber ganz sicher nicht, Ferdinand Porsche hatte ernste Absichten und besiegelte am 30. Mai 1897 auf einer Parkbank im Wiener Prater mit einem Kuss die Verlobung mit seiner Aloisia.
In Maffersdorf hatte das heimliche Eheversprechen einen neuerlichen Wutausbruch zur Folge, da Anton Porsche seinen Sohn bereits einer Tochter der in Reichenberg beheimateten Familie Ginzkey versprochen hatte. Doch Ferdinand war nicht bereit, von seiner Aloisia zu lassen, und die beiden heirateten am 17. Oktober 1903 entgegen dem väterlichen Befehl in der Pfarrkirche von Maffersdorf. Die Hochzeitsreise führte das junge Paar durch Österreich, Frankreich und Italien und wurde vom frischgebackenen Ehemann zur Vorsprache bei diversen Automobilunternehmen genützt, bei denen er für seine technischen Innovationen warb.
Das junge Paar bezog eine Wohnung in der Berggasse 6, was sich insofern als praktisch erwies, als Ferdinand Porsche mittlerweile bei der k. u. k. Hof-Wagenfabrik Jacob Lohner in der nahegelegenen Porzellangasse angeheuert hatte, die gerade dabei war, ihre Produktion von Pferdekutschen auf elektrisch betriebene Kraftwagen umzustellen. Nun war Ferdinand dort, wo er seit seinen Kindheitstagen hinwollte. Nach wenigen Monaten in den Lohner-Werken erregte er bereits bei der Pariser Weltausstellung des Jahres 1900 mit einem Elektromobil großes Aufsehen. Bald sprach sich seine außerordentliche Begabung als Konstrukteur, aber auch als Renn- und Herrenfahrer herum, sodass ihn der Thronfolger Franz Ferdinand aufforderte, ihn zu den Kaisermanövern zu chauffieren.
In diesen Jahren wurde der Grundstein für den Aufbau des legendären Porsche-Clans gelegt, der heute zu den bedeutendsten und reichsten Dynastien der europäischen Industrie zählt: 1904 durch die Geburt der Tochter Louise, fünf Jahre später durch Sohn Ferry, die beide ein wesentliches Stück Automobil- und Unternehmensgeschichte schreiben sollten. Wie sehr Porsche den Automobilsport liebte, zeigt die Tatsache, dass er am 19. September 1909 – dem Tag, an dem sein Sohn in Wiener Neustadt zur Welt kam – ein Rennen am Wiener Exelberg absolvierte.
Im Alter von 31 Jahren technischer Direktor der Austro-Daimler-Werke in Wiener Neustadt geworden, entwickelte Porsche bahnbrechende Auto- und Flugmotoren. Die beiden Kinder wurden auf dem Fabrikgelände groß, wodurch ihr Weg in die Fahrzeugindustrie vorgezeichnet war. »In dieser Welt des Automobils wuchs ich auf«, schreibt Ferry Porsche in seiner Autobiografie, »schon als Knirps fühlte ich mich zum Automobil hingezogen. Waren wir mit dem Auto unterwegs, dann hatte ich in Gedanken vor mir ein Lenkrad, mit dem ich während der ganzen Fahrt mitlenkte.«
Als Porsche 1916 Generaldirektor der Austro-Daimler-Werke wurde, bot sich den beiden Kindern mehr denn je die Gelegenheit, den steten Fortschritt des Automobilbaues zu beobachten. »Wir wohnten in unmittelbarer Nähe des Werks, und es verging kein Tag, an dem ich dort nicht herumspazierte«, erinnert sich Ferry, der »mit allen Meistern gut Freund war und Zutritt zu den Werkstätten hatte. Am Sonntag ging mein Vater stets in das Konstruktionsbüro und nahm mich mit. Ich war noch ein kleiner Bub, von dem man annehmen hätte können, er wollte am Sonntag lieber spielen gehen; aber mich hat dieser sonntägliche Werksbesuch in keiner Weise gelangweilt, obwohl die Erwachsenen, die mit meinem Vater technische Angelegenheiten besprachen, der Meinung waren, ›der Bub versteht eh nix‹. Ich verstand aber eine ganze Menge von dem, was da diskutiert wurde.«
Die Ehe von Ferdinand und Aloisia Porsche galt als vorbildlich – abgesehen davon, dass der Patriarch kaum Zeit für seine Familie hatte. Ruhelos in seiner Arbeit, war Porsche Tag und Nacht unterwegs, eilte von einer Sitzung in Wiener Neustadt zu Besprechungen nach Wien, Berlin und von dort zu einem Rennen am Nürburgring. Aloisia drückte die Rastlosigkeit ihres Mannes mit dem treffenden Satz aus: »Am besten wär’s, auch sein Bett hätte Räder.« Was das Ehepaar verband, war die Liebe zum Theater – auch wenn sie für die Opern Richard Wagners und er für die leichte Muse schwärmte. Musik und Inhalt waren ihm dabei nicht so wichtig, da er in jeder Vorstellung schon nach wenigen Minuten einzuschlafen pflegte.
Es war klar, dass Aloisia samt Kindern ihrem Mann überallhin folgen würde, wo er eine neue Aufgabe fand. So auch 1923, als er Chefkonstrukteur bei Mercedes-Benz in Stuttgart wurde und dann fünf Jahre später, als er wieder nach Österreich zurückkehrte – diesmal, weil die Steyr-Daimler-Werke riefen. Dass er in den meisten Autofabriken nur kurze Zeit blieb, hatte oft wirtschaftliche Gründe, lag aber auch an Ferdinand Porsches Hang zu Wutausbrüchen. Wie sein Vater neigte auch er zu Jähzorn.
Ehemalige Mitarbeiter berichteten, dass er – wenn nicht alles nach seinem Kopf lief – zuweilen seinen Hut auf den Boden warf und auf ihm herumtrampelte. Nachdem Porsche mit fast allen großen Automobilerzeugern zerstritten war, blieb ihm 1931 nichts anderes übrig, als sich selbständig zu machen. Die Familie ging einmal mehr nach Stuttgart, wo der Senior – nun schon assistiert von Sohn Ferry – sein eigenes Konstruktionsbüro eröffnete und die Entwicklung von Rennwagen vorantrieb, in denen dann spätere Legenden wie Hans Stuck, Rudolf Caracciola und Bernd Rosemeyer Weltrekorde fuhren.
Gleichzeitig erkannte Porsche aber auch, dass die Zukunft des Autos nicht in der Produktion von ein paar Renn- und Luxuslimousinen liegen könne, sondern im Fortbewegungsmittel für die Massen. Deshalb erdachte er einen kleinen, billigen Pkw, wie ihn die Autoindustrie bis dahin abgelehnt hatte: den späteren Käfer, der der Familie Porsche zu Reichtum und Macht verhalf.
Freilich legte er sich zur Verwirklichung dieses Traums mit dem Teufel ins Bett: Hitler war es, der die Möglichkeiten schuf, Porsches KdF*-Auto, auch Volkswagen genannt, für den »kleinen Mann« zu bauen. Wenn auch vorerst nur für kurze Zeit, denn während des Krieges durften im Volkswagen-Werk Wolfsburg ausschließlich Schwimmund Kübelwagen für die Wehrmacht erzeugt werden.
Die Folgen des Pakts mit dem »Führer« waren schwerwiegend, zumal Porsche 1945 von den Alliierten verhaftet wurde, weil er mit Hilfe von 20 000 Zwangsarbeitern an der Rüstungsindustrie der Nazis erheblich profitiert hatte.
Während der 22 Monate, die Ferdinand Porsche im Gefängnis saß, übernahm sein Sohn – nachdem auch er kurz in Haft gewesen war – die Leitung der Betriebe. Nun setzte der unvergleichliche Aufstieg des Käfers als Symbol des Wirtschaftswunders ein: Er wurde insgesamt 21 Millionen Mal verkauft – nicht zum Schaden der Familie Porsche, die ab 1945 an jedem einzelnen Exemplar mit fünf Mark beteiligt war.
Ferdinand Porsche wollte nach seiner Freilassung aus der Gefangenschaft, obwohl bereits 72 Jahre alt, nicht untätig bleiben. Er siedelte sich mit seiner Frau am familieneigenen Schüttgut in Zell am See an und begann in zwei winzigen Baracken der Kärntner Ortschaft Gmünd mit der Konstruktion jenes Sportwagens, der heute noch – in modifizierter Form – erzeugt wird und seinen Namen trägt. Wäre es nach ihm gegangen, wäre Gmünd auch die Produktionsstätte des Porsche geworden, doch da sich in Österreich keine Geldgeber zur Finanzierung der Serienproduktion fanden, verlegte er sie nach Stuttgart.
Nach Ferdinand Porsches Tod im Jahre 1951 wurde sein Erbe zwischen seiner in Österreich lebenden Tochter Louise – die seit 1928 mit dem Wiener Rechtsanwalt Anton Piëch verheiratet war – und Sohn Ferry Porsche aufgeteilt. Während Louise die Porsche Holding in Salzburg leitete – sie ist mit 17 000 Mitarbeitern heute Österreichs größtes privat geführtes Unternehmen – besteht Ferry Porsches Leistung darin, das Stuttgarter Ingenieurbüro seines Vaters zu einem Großkonzern ausgebaut zu haben.
Wie ihre Vorfahren haben auch Louise Piëch und Ferry Porsche ihr auf komplizierte Weise miteinander verbundenes Firmengeflecht sehr emotional geführt. Hatte Anton Porsche noch am Dachboden seines Hauses in Maffersdorf Lämpchen zerstört und Ferdinand Hüte zertrampelt, soll es zwischen Ferry und Louise sogar zu Handgreiflichkeiten gekommen sein.
Ferry Porsche starb 1998 in Zell am See, Louise Piëch im Jahr darauf ebendort. Während er vier Söhne als Erben hinterließ, hatte sie drei Söhne und eine Tochter. Die unausbleiblichen Machtkämpfe wurden nun mit wesentlich subtileren Mitteln ausgetragen: 1972 waren die Familien Porsche und Piëch dermaßen zerstritten, dass es keine andere Möglichkeit gab, als alle Clan-Mitglieder von der operativen Leitung des Volkswagen-Werks abzuziehen.
Zuweilen nahmen die Familienstreitigkeiten in der dritten Generation auch skurrile Züge an, als sich nämlich in den Machtkampf auch Liebe und Eifersucht einzuschleichen begannen: Als Höhepunkt des Krieges zwischen den Cousins Ferdinand Piëch und Gerd Porsche fing der eine mit der Frau des anderen eine Affäre an: Ferdinand Piëch und Marlene Porsche wurden ein Paar. Den Vorwurf, dies sei aus Verbitterung über den Rückzug der Familie aus der Konzernspitze geschehen, wies Piëch zurück. Es sei auch nicht sein Plan gewesen, dass sich die Mehrheitsverhältnisse durch die folgende Scheidung der Eheleute Gerd und Marlene Porsche verändern würden.
Aber praktisch war die neue Konstellation allemal. Piëch, auch sonst kein Kind von Traurigkeit – er hat zwölf Kinder aus vier Beziehungen – war zwölf Jahre lang mit der Frau seines Cousins liiert und übernahm 1993 als Vorstandsvorsitzender die Hebel der Macht bei VW. All der Streit und auch der Liebes-Reigen konnten aber nichts daran ändern, dass das Haus Piëch-Porsche mit einem geschätzten Vermögen von dreißig Milliarden Euro zu den reichsten Familien im deutschsprachigen Raum zählt. Europas größte Automobil-Dynastie besteht aus rund sechzig Mitgliedern, allesamt leibliche und angeheiratete Nachfahren des Konzern-Vaters Ferdinand Porsche. In ihrem Besitz befinden sich die (deutsche) Porsche Fabrik und die (österreichische) Porsche Holding, weiters kontrolliert die Familie das größte Aktienpaket am Volkswagen-Werk, dessen Aufsichtsratsvorsitzender seit 2002 Ferdinand Piëch ist.
* Abkürzung für »Kraft durch Freude«.