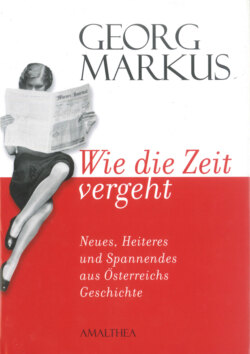Читать книгу Wie die Zeit vergeht - Georg Markus - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
GESCHICHTEN ERZÄHLEN GESCHICHTE Vorwort
ОглавлениеJa, sie vergeht wie im Flug, die Zeit. Nicht nur in unserem eigenen Leben. Es ist gerade erst ein bisserl mehr als tausend Jahre her, seit Österreichs Geburtsstunde schlug – und schon haben wir zwei Dynastien mit 37 Kaisern, Königen, Herzögen und Markgrafen, die dieses Land regierten, hinter uns gebracht.
Die Geschichten, die in diesem Buch erzählt werden, sollen – wie es der Untertitel verspricht – spannend oder heiter sein, wobei das signifikant Österreichische an ihnen ist, dass sich diese beiden Eigenschaften oftmals miteinander verbinden. Zu den Hauptdarstellern zählen neben den wichtigsten Herrschern auch die Musiker, Dichter, Maler, Architekten, Ärzte, Politiker und Schauspieler dieses Landes.
Und möglichst neu für den Leser sollen die Geschichten sein, auch das besagt der Untertitel. Dass die Habsburger lieber heiraten als Kriege führen wollten, wäre wohl nicht neu genug. Sehr wohl aber, wie so ein Kaiser an eine standesgemäße Ehefrau herankam: Es gab einen richtigen Heiratsmarkt, auf dem die jungen Damen von königlichem Geblüt besichtigt werden konnten und zwar auf gemalten Miniaturen, die von reitenden Boten von Hof zu Hof befördert wurden. Sich in ein solches Bildnis zu verlieben, war riskant, da die Hofmaler den Auftrag hatten, die heiratswillige Herrschaft möglichst idealisiert darzustellen. Ob’s dann so aufregend war, in das Haus Habsburg einzuheiraten, ist fraglich. Im Kapitel »Majestät rasierte sich ganz alleine« erfährt man nämlich, welch strenge Auflagen das Spanische Hofzeremoniell den Mitgliedern dieser Familie abverlangte, dessen Normen sie bis ins eheliche Schlafgemach verfolgten.
Kein Wunder, dass unter solchen Umständen so mancher Kaiser und Erzherzog im Kapitel »Toll trieben es die alten Wiener« aufscheint, in dem die Angehörigen auch ganz anderer Schichten Erwähnung finden. »Der kleine Mann« suchte sein Vergnügen oft in bordellartigen »Badstuben«, in denen man von spärlich bekleideten Bademägden nicht nur abgerieben und gewaschen, sondern auch sonst »gut bedient« wurde.
Mehr über das Alltagsleben der einfachen Menschen erfährt man im Kapitel »Wie groß ist der kleine Mann?«, wo auch »Typen« wie Fiaker, die Frau Sopherl und der Wiener Hausmeister in seiner Allmacht vorgestellt werden.
In ganz anderen Kreisen bewegen wir uns im Abschnitt »Adel verpflichtet«, in dem etwa erzählt wird, wie die Schwarzenbergs zu ihrem Reichtum kamen: Es war der 31-jährige Georg Ludwig Schwarzenberg, der im 17. Jahrhundert eine 81-jährige Witwe heiratete, die dem Geschlecht dann ihr durch fünf vorherige Ehen ererbtes Vermögen hinterließ. Nebst Geschichten der Liechtensteins, Starhembergs oder der Henckel-Donnersmarcks wird auch verraten, über wie viele adelige Ahnen man verfügen musste, um am Hof des Kaisers zugelassen zu werden oder warum sich etwa Herbert von Karajan in der Zweiten Republik »von« nennen durfte, Otto Habsburg aber nicht.
Es wird wohl erstaunen, dass der Name Grillparzer bei den »Großen Kriminalfällen« aufscheint. Der Grund dafür: Der Bruder des Dichters kam mehrmals mit dem Gesetz in Konflikt, einmal stand er sogar unter Mordverdacht. In erster Linie findet sich Grillparzer aber natürlich im Kapitel der Literaten, in dem einmal mehr der Beweis erbracht wird, wie kurios die österreichische Geschichte mitunter ist: Zur Uraufführung des Grillparzer-Dramas »König Ottokars Glück und Ende« konnte es erst kommen, als die Frau des damaligen Kaisers unter Zahnschmerzen litt! Weitere Episoden erzählen von Nestroy über Schnitzler bis Karl Kraus und Joseph Roth.
Viele dieser Künstler verkehrten im Kaffeehaus, dem ein eigener Abschnitt gewidmet ist. Nicht nur die Dichter hatten ihre Stammcafés, es gab auch solche für Komponisten, Schauspieler, Maler, Politiker und Originale aller Art. In einem Fall wurden die Kaffeehausbesitzer fast so prominent wie ihre Gäste: die Hawelkas.
Von manchen Österreichern sagt man, sie wären »in Österreich weltberühmt«. Es gibt aber auch solche, die überall weltberühmt sind, nur nicht in Österreich: Karl Landsteiner etwa, der die Blutgruppen entdeckte, wurde von der Universität Wien mit 52 Jahren frühpensioniert, woraufhin er in die USA auswanderte und den Nobelpreis erhielt. Für eine Professur abgelehnt wurde in Wien Ignaz Philipp Semmelweis, der als »Retter der Mütter« gilt. Seine dramatische Geschichte findet sich im Kapitel »Österreichs Ärzte und ihre Patienten«, in dem wir auch Theodor Billroth, Sigmund Freud, Julius Wagner-Jauregg oder Adolf Lorenz begegnen. Unglaublich mutet die Biografie der Gabriele Possanner an, die viele Jahre kämpfen musste, ehe sie als erste Frau zum Medizinstudium zugelassen wurde.
Dieses Buch will spezifisch österreichische Eigenheiten aufzeigen. Natürlich kommen im Kapitel »Musikland Österreich« alle Großen von Mozart bis Johann Strauß vor, ich gehe aber auch der Frage nach, warum gerade hier so viele Genies gewachsen sind. Und eine Geschichte erzählt davon, wie Gustav Mahler es verhindern konnte, dass die Komposition eines Erzherzogs an der Wiener Oper zur Aufführung gelangte.
»Hinter den Kulissen« gibt’s Heiteres und Spannendes aus dem Theater, von seinen Anfängen bis zu den Lieblingen Josef Kainz, Alexander Girardi und Josef Meinrad, aber auch über die armseligen Lebensumstände der »Schmierenkomödianten«, die von Dorf zu Dorf zogen und in Schuppen oder Wirtshaussälen auftreten mussten. Große Namen finden sich auch in jenem Kapitel, das dem österreichischen Film gewidmet ist: Paula Wessely natürlich und Hans Moser, weiters Hedy Lamarr und Oskar Werner, die internationale Wege gingen. Wie auch Romy Schneider, deren Aufstieg mit der Rolle der »Sissi« begann, die sie aber nicht glücklich machte, wie ein Blick in ihr Tagebuch zeigt: »Ich war nicht mehr Romy, sondern nur noch Sissi. Mir hing diese Person zum Hals heraus.« Regisseure wie Billy Wilder, Fred Zinnemann und Otto Preminger wurden vertrieben, ehe sie in Hollywood Filmgeschichte schrieben. Andere bedeutende Österreicher fielen dem NS-Regime zum Opfer.
Unter den Radiopionieren begegnen wir Willy Schmieger, Maxi Böhm oder Edi Finger, von dem wir erfahren, wie ihm sein berühmter Ausspruch »I wer narrisch« zum Verhängnis wurde. Als das Fernsehen in seinen Kinderschuhen steckte, gingen Legenden wie Hans-Joachim Kulenkampff, Rudolf Hornegg, Hans Hass und Heinz Fischer-Karwin auf Sendung. TV-Geschichte schrieb Helmut Qualtinger, den wir neben Fritz Grünbaum, Karl Farkas und Gerhard Bronner natürlich auch im Kapitel Kabarett antreffen.
Leider haben die Habsburger nicht nur geheiratet, sondern doch auch Kriege geführt. Das hätten sie sich – und vor allem ihren Völkern – ersparen sollen, mussten sie doch trotz bedeutender Feldherren wie Wallenstein, Prinz Eugen oder Radetzky weit mehr Niederlagen als Siege hinnehmen. Zu den großen Demütigungen der einst »stolzen k.k. Armee« zählte die zweimalige Einnahme Wiens durch Napoleon. Er hat nicht nur die Haupt- und Residenzstadt erobert, sondern auch mehrere Frauenherzen: In den wenigen Monaten, die er an der Donau verbrachte, zeugte der Korse zwei Söhne. Mit den österreichischen Gebräuchen dürfte er sich jedenfalls schnell zurecht gefunden haben, ließ es sich Napoleon doch nicht nehmen, den Stiefvater einer seiner Geliebten zum Hofrat zu ernennen!
Apropos: Selbstverständlich ist auch dem österreichischen Beamten ein Kapitel gewidmet, in dem ich der Frage nachgehe, warum es in keinem anderen Land der Welt so viele Amts- und Ehrentitel gibt wie in diesem. Nicht, dass es keine Reformversuche gegeben hätte: Der Titel Hofrat sollte bereits im Jahre 1850 abgeschafft werden, aber dann …
Jetzt muss ich aber aufpassen, dass ich nicht das ganze Buch schon im Vorwort erzähle. Nur so viel noch: »Wie die Zeit vergeht« will Geschichte durch Geschichten erzählen. Es will informieren und vor allem: in keiner Zeile langweilig sein, denn langweilige Geschichtsbücher gibt es schon mehr als genug.
GEORG MARKUS
Wien, im September 2009
Der Autor dankt den folgenden Personen, die ihn bei der Arbeit zu diesem Buch unterstützten: Victoria Bauernberger, Peter Broucek, Julia Holzschuh, Maria Hutter, Carina Kerschbaumsteiner, Christoph Lechner, Peter Marboe, Stefan Raynova-Lintl, Dietmar Schmitz, Susanne Schoberberger und Thomas Schreiner.