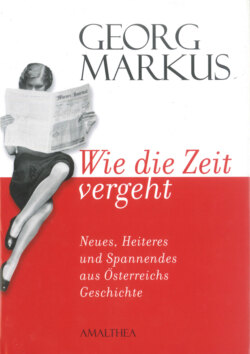Читать книгу Wie die Zeit vergeht - Georg Markus - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
WOLFERL, FRANZL, SCHANI Musikland Österreich
ОглавлениеEin Volk, das seine Komponisten beim Vornamen nennt, muss wohl eine sehr innige Beziehung zur Musik haben. Und das hat es auch, die Österreicher holten sich aus der Fülle ihrer Begabungen ein paar ganz spezielle heraus und erklärten Wolferl, Franzl und Schani zu ihren Lieblingen. An Genies gibt’s keinen Mangel.
Mozart ist die oberste Instanz. Und das, obwohl er nie Österreicher war. Als er am 27. Jänner 1756 in Salzburg zur Welt kam, gehörte die Stadt nicht zu Österreich, sie war vielmehr ein souveränes Erzbistum und war davor noch im Herzogtum Bayern gelegen. Als Salzburg österreichisch wurde, war Mozart schon tot.
Sein Leben zeigt, wie sehr die Menschheitsgeschichte von schicksalhaften Fügungen abhängt: Mozarts Mutter brachte sieben Kinder zur Welt, von denen fünf im Säuglingsalter starben. Eines der beiden, die überlebten, war Wolfgang Amadeus. Er lebte nur 35 Jahre, aber wäre er ein Jahr früher gestorben – wir hätten »Die Zauberflöte« nicht. Andererseits: Welche Melodien wären noch entstanden, hätte er länger gelebt.
Schon die frühen Kompositionen zeigen das Genie des kleinen Wolfgang, der das Klavierspiel in Vollendung beherrschte, wie sein Vater bescheinigte: »Diesen Menuett und Trio hat der Wolfgangerl den 26ten January 1761 einen Tag vor seinem 5ten Geburtstag um halb 10 Uhr nachts in einer halben Stund gelernet.« Ein Jahr später wurde das Wunderkind bereits auf Konzertreisen gefeiert.
Mozarts Vater begleitete die ersten Tourneen seines Sohnes und seiner Tochter Maria Anna, genannt Nannerl. Im Alter von sieben Jahren spielte Wolfgang Amadé, wie er sich nun nannte, vor Maria Theresia in Schönbrunn. Oft zitiert wird, wie er der leutseligen Kaiserin »auf den Schoß sprang, sie um den Hals nahm und ihr Gesicht mit Küssen bedeckte«. Weniger bekannt ist, dass Maria Theresia später ihrem Sohn Ferdinand brieflich mitteilte, Mozart gehörte »dem unnützen Volk an, das Kunst nicht als noble Freizeitpassion, sondern zum Profit betreibt«.
Mozart fühlte sich in der späteren Mozartstadt beengt und ging nach Wien, wo er als freier Komponist arbeitete und Constanze Weber, die Schwester seiner Jugendliebe Aloysia, heiratete. Sie schenkte ihm sechs Kinder, von denen wieder nur zwei den Vater überleben sollten. In dieser Zeit entstanden einige der gewaltigsten Werke der Musikgeschichte: »Die Entführung aus dem Serail«, »Die Hochzeit des Figaro«, »Don Giovanni«, »Cosi fan tutte« … Zwar musste er die ersten Jahre seines Wien-Aufenthalts durch Klavierunterricht »an meist unbegabten Schülern« finanzieren, aber sein überragendes Talent war – zumindest in den musikinteressierten Kreisen – in der Stadt Gesprächsthema.
Josef II., der Mozart eine Stelle als k. k. Kammerkompositeur gab, wusste, was er an ihm hatte. Als sich ein General während einer Hoftafel beim Kaiser beklagte, dass Mozart sich nicht gehörig benehme, erwiderte Josef gelassen: »Lass Er mir den Mozart in Ruhe. Einen General kann ich mir alle Tage machen, aber einen Mozart nie wieder!«
Das Genie war nicht arm, es verdiente, selbst in weniger guten Zeiten, mehr als ein Arzt oder Universitätsprofessor. Neben seinem Gehalt als Kammerkompositeur brachten ihm die Aufführungen seiner Opern Einnahmen, die ihm ein zumindest gutbürgerliches Leben hätten sichern können. Allein als Klaviervirtuose verdiente er rund 10 000 Gulden pro Jahr*.
Und doch war er stets in Geldnöten und oft sogar verschuldet. Mozart lebte auf großem Fuß, hatte meist geräumige Wohnungen mit Personal, besaß ein Reitpferd und andere Luxusartikel. Doch der wahre Grund der Finanznot lag in seiner krankhaften Leidenschaft fürs Glücksspiel. »Er spielte hoch, ganze Nächte hindurch, er war sehr leichtsinnig«, vermerkte sein Zeitgenosse, der Kapellmeister Destouches. Karten und Billard wären ihm wichtiger gewesen als das Klavierspiel: »Wenn ein berühmter Billardspieler in Wien ankam, hat’s ihn mehr interessiert als ein berühmter Musiker.« Mozart dürfte den größten Teil seines Vermögens verspielt haben.
Aber er war ein treu sorgender Familienvater, seine Ehe mit Constanze galt als glücklich, von den vielen Liebschaften, die ihm unterstellt werden, ist keine nachweisbar.
Zeitgenossen beschrieben ihn als aufbrausend, ungestüm und im Umgang mit Musikerkollegen alles andere als diplomatisch. Er hat seine Meinung immer offen ausgesprochen und sich damit Gegner und Neider geschaffen. In seiner Arbeit hektisch, aber diszipliniert, hielt Mozart bestimmte Tageszeiten ein, in denen er komponierte.
Im Jahre 1790 ging es dem sonst eher fröhlichen Gemüt psychisch schlecht. Österreich steckte in einer Krise, die zur Folge hatte, dass der Besuch seiner Konzerte nachließ. Von den vielen Spekulationen, die seine Person betreffen, lässt sich die um seinen Tod am wenigsten aus der Welt schaffen. Da die wirkliche Ursache für sein Ableben nie nachgewiesen werden konnte, gelangten Medizinhistoriker, die Mozarts Krankheiten beschrieben, zu widersprüchlichen Ergebnissen.
Die absurde Version, sein Rivale Antonio Salieri hätte ihn ermordet, hält keiner Überprüfung stand. Salieri empfand Mozart nicht als Konkurrenz, er war als Hofkapellmeister in einer wesentlich besseren Position als er. Abgesehen davon, standen die beiden in Mozarts letzten Lebensjahren in gutem Verhältnis zueinander.
Mozart wurde am 7. Dezember 1791 in einem der damals üblichen »Schachtgräber« am St. Marxer Friedhof beerdigt. Diese waren auf Initiative Josefs II. entstanden, der die Meinung vertrat, dass »bei Toten der einzige Zweck die Verwesung ist«. Deshalb wurden die sterblichen Überreste der meisten Menschen würdelos in ein für mehrere Personen bestimmtes Erdloch geworfen. Die Wiener protestierten dagegen, weil man ihnen mit dieser neuen Bestimmung ihre »schöne Leich« nahm, sodass die Einführung der Schachtgräber zu jenen Maßnahmen Josefs zählte, die wieder zurückgenommen wurden.
Sie ist jedenfalls der Grund dafür, dass Mozarts Gebeine für alle Zeiten verschwunden sind.
Mozart war ein in gebildeten Kreisen bekannter Mann, aber keineswegs so populär, dass ihn jeder auf der Straße erkannt hätte. Wirklich berühmt wurde er nach seinem Tod, als der Erfolg der »Zauberflöte« seinen Namen in alle Welt trug.
Erst als er tot war, wusste jeder, wer Mozart gewesen ist.
Dass Österreich weltweit als das Musikland schlechthin gilt, hat viel mit Mozart zu tun – aber nicht nur. Erste Hinweise für musikalisches Treiben im Gebiet der heutigen Alpenrepublik finden sich in Instrumenten aus der Altsteinzeit. Im Frühmittelalter zugewanderte Völker übten Einfluss auf die musikalische Entwicklung aus, und ab dem Hochmittelalter kann von einem eigenständigen österreichischen Musikleben gesprochen werden.
Den »komponierenden Barockkaisern« Ferdinand III., Leopold I., Joseph I. und Karl VI. ist es zu danken, dass die Wiener Hofkapelle im 17. und 18. Jahrhundert zu einem Ensemble von Weltruf wurde. Später begründete die »Wiener Klassik« Wiens Ruf als Weltstadt der Musik, von der sich große Komponisten angezogen fühlten.
Der bedeutendste neben Mozart war Beethoven. Dessen Vater, selbst Musiker, war vom kleinen Amadeus dermaßen beeindruckt, dass er es sich zum Ziel setzte, auch aus seinem Sohn ein »Wunderkind« zu machen. Ludwig begann in seiner Geburtsstadt Bonn früh zu musizieren, er wurde Bratschist in der Bonner Hofkapelle, ehe er sich als 17-Jähriger entschloss, nach Wien zu reisen, um bei Mozart studieren zu können. 1787 kam es zur ersten und einzigen Begegnung der beiden Giganten. Mozart war von dem um 14 Jahre Jüngeren angetan, lehnte es jedoch ab, ihm Unterricht zu erteilen, da er gerade am »Don Giovanni« arbeitete.
Beethoven kehrte enttäuscht nach Bonn zurück, um fünf Jahre später neuerlich nach Wien zu kommen. Mozart war inzwischen verstorben, also wandte er sich jetzt an Haydn und Salieri, die ihn beide als Schüler aufnahmen. Von dieser, seiner zweiten Studienreise, kehrte Beethoven nie wieder zurück, er blieb für den Rest seines Lebens in Wien.
Beethoven erregte schon durch seine ersten Auftritte in der österreichischen Residenzstadt als Komponist wie als Virtuose Aufsehen. Besonders beeindruckten seine Improvisationen am Klavier, deren Höhepunkt er erreichte, als er den berühmten Abbé Gelinek bei einem Wettspiel besiegte. Angeblich stellte Beethoven kurz vor Beginn eines Konzerts fest, dass der Flügel einen Halbton zu tief gestimmt war, worauf er – da die Zeit nicht mehr reichte, um das Instrument neu zu stimmen – sein Erstes Klavierkonzert in C-Dur kurzerhand in Cis-Dur spielte.
Um das Jahr 1795 bemerkte er, dass sein Gehör stetig nachließ – vermutlich als Folge einer in der Kindheit übergangenen Mittelohrentzündung. »Ich kann sagen, ich bringe mein Leben elend zu«, schrieb der 31-Jährige seinem Freund Franz Georg Wegeler, »seit zwei Jahren fast meide ich alle Gesellschaften, weil’s mir nun nicht möglich ist, den Leuten zu sagen: Ich bin taub. Hätte ich irgendein anderes Fach, so ging’s noch eher; aber in meinem Fach ist das ein schrecklicher Zustand.«
Bei aller Tristesse blitzen Spuren von Humor durch. So etwa am 2. September 1812, als Beethoven mit Goethe zusammentraf. Beide waren auf Kur in Karlsbad und beschlossen, eine gemeinsame Spazierfahrt zu unternehmen. Die Leute, die den Wagen mit den beiden Männern vorbeifahren sahen, blieben stehen und grüßten ehrfürchtig.
»Es langweilt mich, so berühmt zu sein«, sagte Goethe, »schon deshalb, weil mich alle Leute grüßen!«
»Eure Exzellenz brauchen sich nichts daraus zu machen«, erwiderte Beethoven, »vielleicht bin ich es, den die Leute grüßen.«
Beethoven musste seine Konzertreisen und Auftritte als Klaviervirtuose einstellen und widmete sich seinen Kompositionen. Er litt an Magen- und Darmbeschwerden, deren Ursprung vermutlich eine Bleivergiftung war. Ab dem Jahre 1819 vollkommen taub, komponierte er unaufhörlich weiter. »Es fehlte wenig, und ich entledigte selbst mein Leben«, schrieb er in seinem berühmten Heiligenstädter Testament. »Nur sie, die Kunst, sie hielt mich zurück, ach es dünkte mir unmöglich, die Welt eher zu verlassen, bis ich das alles hervorgebracht … und so friste ich dieses elende Leben.«
Als Beethoven am 7. Mai 1824 im Wiener Kärntnertortheater die kurz davor fertig gestellte Neunte Symphonie op. 125 dirigierte, stand er mit dem Rücken zum Publikum und las die Worte der Sänger von ihrem Munde ab. Es wurde ihm als Zeichen von Arroganz ausgelegt, dass er dem frenetisch applaudierenden Publikum weiterhin den Rücken zuwandte. Die Sängerin Caroline Unger begriff, dass der taube Komponist den Jubel nicht hören konnte, sie ging auf ihn zu, nahm Beethoven an den Schultern und zwang ihn, sich mit dem Gesicht den Menschen im Konzertsaal zuzuwenden. Erst jetzt merkte er, welch triumphalen Erfolg er errungen hatte, und verbeugte sich tief bewegt.
Die Folgen der Taubheit prägten Persönlichkeit und Erscheinungsbild des in jungen Jahren geselligen Beethoven, der sich nun völlig zurückzog und dem Alkohol hingab. Er führte ein unstetes Leben, bezog in seinen 35 Wiener Jahren 35 Wohnungen.
Er hat alles versucht, das Fortschreiten seiner Schwerhörigkeit zu beenden, doch die langwierigen Badekuren halfen ebenso wenig wie die oft propagierten neuen Hörrohrsysteme aus Holz, Stein und Metall, in die er so viel Hoffnung gesetzt hatte.
1822 stattete ihm sein großer italienischer Kollege Gioacchino Rossini anlässlich seines Wien-Aufenthalts einen Besuch ab. Rossinis Schilderung gibt Zeugnis über die Lebensumstände des Giganten. »Ich stieg die Treppen zu der ärmlichen Wohnung Beethovens hinauf«, erinnerte sich Rossini, »dort fand ich mich auf einer Art Dachboden wieder, der völlig in Unordnung und überaus dreckig war. Besonders erinnere ich mich an die Zimmerdecke. Sie befand sich unmittelbar unter dem Dach und ließ starke Risse erkennen, durch die sich bei Schlechtwetter wohl Regen in Strömen ergoss.«
Beethoven bemerkte zunächst nicht, dass ein Gast eingetreten war. »Er blieb weiter sitzen, über Korrekturen gebeugt, die er zu Ende las. Dann hob er den Kopf und sagte in anständigem Italienisch: ›Ah, Rossini, der Komponist des ‚Barbier von Sevilla‘. Meine herzlichen Glückwünsche! Das ist eine ausgezeichnete Opera buffa. Ich habe mit großem Vergnügen darin gelesen und alles sehr genossen.‹«
Rossini kritzelte seinem Gastgeber ein paar Worte auf ein Blatt Papier, die ihn seiner grenzenlosen Bewunderung versicherten, worauf Beethoven mit einem tiefen Seufzer erwiderte: »O, ich Unglücklicher!«
Als der Italiener nach kurzem Gedankenaustausch zum Abschied aufbrach, rief Beethoven ihm noch nach: »Und machen Sie noch vieles wie den ›Barbier‹!«
Rossini beendete seinen Bericht mit den Worten: »Als ich die verfallene Treppe hinabstieg, konnte ich meine Tränen nicht mehr zurückhalten.«
Beethoven wurde von mehreren Frauen, vor allem von seinen Schülerinnen, umschwärmt, blieb aber einsam. Sehr nahe kam er den Schwestern Therese und Josephine Brunswick, die sich in ihn – vor allem wohl in sein Genie – verliebt hatten, jedoch eine dauerhafte Beziehung ebenso wenig zuließen wie die von ihm verehrte Gräfin Julie Guicciardi.
Da etlichen seiner Biografen Taubheit, Alkoholkrankheit und unglückliche Liebschaften als Schicksalsschläge nicht »genügten«, entdeckten sie weitere dramaturgische Elemente, die allesamt widerlegt werden können. So glaubt ein Autor Beethovens Impotenz nachweisen zu können, weil er angeblich nie mit Frauen geschlafen, sondern sie alle nur verehrt hätte. In krassem Widerspruch dazu wird anderswo darauf hingewiesen, dass Beethoven Dauergast in Wiener Bordellen gewesen sei. Als »Beweis« dafür legt ein amerikanischer Biograf eine Rechnung vor, die aus dem »Lusthaus« im Prater stammte. Der wusste freilich nicht, dass das Lusthaus kein Haus der Lust, sondern ein ehrbares Wiener Restaurant ist. Anderswo wird Beethoven als homosexuell bezeichnet, was durch Briefstellen wie diese untermauert wird: »Wie kann Amenda* zweifeln, dass ich seiner je vergessen könnte.« Oder: »Leb wohl, lieber guter edler Freund, erhalte mir immer Deine Liebe!« Solch blumige Satzkonstrukte gehörten zur überschwänglichen Sprache der gebildeten Schicht dieser Zeit, der zufolge sämtliche Romantiker gleichgeschlechtlich veranlagt gewesen sein müssten, nähme man derartige Floskeln als Indiz dafür.
An seinem Begräbnis nahmen 20 000 Menschen teil. Der »Vollender der Wiener Klassik« hatte seit Längerem über Schmerzen im Unterleib, Appetitlosigkeit und Durstgefühle geklagt. Am 24. März 1827 reichte man ihm die Sterbesakramente, zwei Tage später verschied er im Beisein seiner Schwägerin Johanna und seines Freundes, des Komponisten Anselm Hüttenbrenner, in seiner Wohnung in der Schwarzspanierstraße. Im Gegensatz zu Mozart hatte er seinen Weltruhm noch erleben können.
Im Obduktionsbericht des Arztes Dr. Johann Wagner wird Leberzirrhose als Todesursache genannt, die im Nachruf der »Wiener Zeitung« als Wassersucht abgemildert wurde.
Dass sein Schüler Beethoven und sein Freimaurer-Bruder Mozart ihm einmal den Rang ablaufen würden, hätte Joseph Haydn vermutlich nicht für möglich gehalten, galt er doch in seiner Zeit als bedeutendster Komponist. Joseph »Papa« Haydn war am 31. März 1732 im niederösterreichischen Rohrau als Sohn eines Bauern und Wagnermeisters zur Welt gekommen und schon als Kleinkind durch seine Musikalität aufgefallen. Er erhielt Gesangs- und Instrumentalunterricht und wurde mit acht Jahren Chorknabe im Stephansdom.
Mit Einsetzen des Stimmbruchs nahm er das Studium bei dem berühmten, aus Neapel stammenden und in Wien lebenden Komponisten Niccolo Antonio Porpora auf. Als er von seinem Lehrer Abschied nahm, sagte Haydn: »Jetzt erst weiß ich, wie schwer die italienische Leichtigkeit ist.«
Wie Mozart heiratete auch Haydn die Schwester der Frau, die er eigentlich liebte, wurde aber in seiner Ehe nicht glücklich. 1761 holte ihn Fürst Paul Esterházy als Kapellmeister nach Eisenstadt, wo er seinen musikalischen Stil entwickeln konnte.
Auf den beiden England-Reisen, die er im Alter unternahm, wurde Haydn wie ein König gefeiert. In London ereignete sich ein Zwischenfall, der Geschichte schrieb: Haydn legte am Ende eines Konzerts den Taktstock aus der Hand und verbeugte sich. Da erhoben sich die Besucher und strömten zum Orchester, um dem Meister aus der Nähe zuzujubeln. Kaum waren die Sitze in der Mitte des Parketts geleert, löste sich der schwere Kronleuchter aus der Verankerung, stürzte eben dort zu Boden und zerstörte Teile des Konzertsaales. Abgesehen von wenigen Besuchern, die durch Kristallsplitter leicht verletzt wurden, kam niemand zu Schaden. Haydn dankte der Vorsehung, dass ein gütiges Geschick so viele Menschenleben gerettet hat. Die Symphonie wurde fortan unter dem Beinamen »Mirakel« aufgeführt.
Seine letzten Lebensjahre verbrachte Haydn in der heutigen Haydngasse 6 in Wien-Gumpendorf. Als Napoleon – dessen Truppen die Hauptstadt des Kaiserreichs gerade besetzt hielten – erfuhr, dass Haydn im Sterben lag, ließ er vor dessen Haustor eine Ehrenwache aufstellen und die Straße mit Stroh bestreuen, damit der Meister nicht durch das Rumpeln der Wagenräder gestört würde. Er starb am 31. Mai 1809 in seinem 78. Lebensjahr.
Nur wenige Tage nach der Beerdigung am Hundsturmer Friedhof wurde sein Schädel aus dem Grab gestohlen – wie sich später herausstellte von Fanatikern, die anhand der Kopfform Rückschlüsse auf das Genie ziehen wollten. Der Schädel tauchte erst 1954 wieder auf und wurde dann in die Bergkirche Eisenstadt überstellt, wo der Körper bereits 1820 beigesetzt worden war.
Im Biedermeier entwickelte sich der Musikgenuss vom Privileg des Adels hin zum allgemeinen Bildungsgut. Die Hausmusik eroberte die Salons des Bürgertums und erlebte ihre Blüte. Philharmoniker, Musikverein, Salzburger Mozarteum und Wiener Männergesang-Verein wurden gegründet, und an den Vorstadtbühnen in der Leopoldstadt, der Josefstadt und im Theater an der Wien erlangte das Singspiel weite Verbreitung.
Franz Schubert kam 1797 als Sohn eines Lehrers am Wiener Alsergrund zur Welt und wuchs in beengten Verhältnissen auf. Mit elf Jahren wurde er von den Sängerknaben aufgenommen, nachdem er die musikalische Grundausbildung bereits von seinem Vater erfahren hatte. Da es von Schubert nur wenige Lebenszeugnisse gibt, bleibt ein Großteil der überlieferten Lebensumstände Spekulation. Auch viele Geschichten um seine angeblich unerfüllten Liebschaften sind erfunden. Nur zwei Beziehungen sind gesichert: Seine Jugendliebe Therese Grob wartete drei Jahre auf ihn, ehe sie einen anderen heiratete. Diese Affäre widerlegt also den »Dreimäderlhaus«-Romanstoff ganz klar, demzufolge ihn »keine wollte«. Nachweisbar ist nur, dass Schubert seine Schülerin Comtesse Carolin Esterházy verehrte, diese seine Liebe jedoch nicht erwiderte. Dass er deswegen gleich zum unglücklichen Liebhaber auf Lebenszeit gestempelt wurde, ist das Produkt einer unbarmherzigen Kitsch-Industrie.
Seine Bescheidenheit geht aus einem Brief hervor, in dem er sich seiner Kindheit erinnerte: »Zuweilen glaubte ich wohl selbst im Stillen, es könne etwas aus mir werden – aber wer vermag nach Beethoven noch etwas zu machen.«
Schubert gab seine Stellung als Hilfslehrer bald auf, weil ihm diese Tätigkeit keine Zeit zum Komponieren ließ, es fanden sich auch kaum Verleger, die seine Noten druckten, und nur drei seiner Bühnenstücke wurden zu seinen Lebzeiten aufgeführt. Aber gerade dem tragischen Umstand, dass er keine feste Anstellung fand, ist die Fülle seines Werks zu danken, denn nur dadurch konnte sich Schubert Tag und Nacht seinen Kompositionen widmen. Obwohl Beethoven fast doppelt so alt wurde wie er, ist Schuberts Oeuvre noch umfangreicher. In den wenigen Jahren, die ihm zur schöpferischen Arbeit blieben, schuf er mehr als tausend Lieder, Klavierstücke, Ouvertüren, Kammermusiken, Messen, Chöre, Tänze, Bühnenstücke sowie acht Symphonien. »In einem halbdunklen, feuchten und ungeheizten Kämmerlein, in einen alten, fadenscheinigen Schlafrock gehüllt, frierend und komponierend«, so behielt ihn ein Freund in Erinnerung. »Die Schwierigkeiten seiner Lage lähmten seinen Fleiß und seine Lust durchaus nicht«, schreibt ein anderer, »er musste singen und dichten, das war sein Leben.«
Allen Widrigkeiten zum Trotz brachte es Schubert zu einem gewissen Bekanntheitsgrad im biedermeierlichen Wien. Er gab Konzerte in privaten Salons und hatte einen prominenten Freundeskreis, zu dem Grillparzer und Moritz von Schwind zählten.
Im Gegensatz zu Mozart war Schubert tatsächlich arm, der »Liederfürst« konnte oft nicht für die Miete seines Zimmers aufkommen und schlief dann bei Freunden oder Verwandten. Auch die letzten Wochen seines Lebens verbrachte er bei seinem älteren Bruder Ferdinand. »Ich werde wohl im Alter an die Türen schleichen und um Brot betteln müssen«, lautete ein Verzweiflungsschrei Schuberts.
Doch es gab kein Alter, das Musikgenie starb in den besten Mannesjahren, mit 31 Jahren. Nicht an Syphilis, wie oft behauptet wird, sondern an »schwerem Nervenfieber«. Vermutlich war er an Bauchtyphus erkrankt, einem in diesen Tagen infolge der schlechten Trinkwasserqualität weit verbreiteten Übel.
Vor der Wende des 19. zum 20. Jahrhundert erfuhr das österreichische Musikleben einen neuen Höhepunkt: in der Oper durch Richard Strauss und Hugo Wolf, in der Symphonik durch Brahms, Bruckner und Mahler. 1860 in Böhmen als Sohn eines Weinbrenners und Gasthausbesitzers zur Welt gekommen und in Mähren aufgewachsen, schrieb Gustav Mahler mit sechs Jahren erste Kompositionen, die von der Militärmusik und von der jüdischen Musik der Synagoge geprägt waren. Mit fünfzehn ging er zum Musikstudium nach Wien, wo Anton Bruckner sein Lehrer war. Mahler durchlief eine Karriere als Kapellmeister an verschiedenen Opernhäusern und zählte bald zu den anerkannten Dirigenten Europas. In Budapest besuchte Brahms eine von ihm dirigierte »Don Giovanni«-Aufführung und war tief beeindruckt.
1897 zum Direktor der Wiener Hofoper bestellt, führte er das Opernhaus in nie da gewesene Höhen. In den zehn Jahren, die er das Haus leitete, wurde Mahler zum großen Reformer. Er führte die intensive Probenarbeit ein, in der die Leistungen der Musiker gesteigert und die bis dahin üblichen pathetischen Gesten der Sänger zurückgedrängt wurden. Mahler schuf die Ära der neuzeitlichen Operninszenierungen, in denen Bühnenbild und Kostüme zentrale Rollen spielten, er scharte das weltbeste Opernensemble um sich, zu dem Erik Schmedes und Leo Slezak zählten, aber auch die Sängerinnen Selma Kurz und Anna von Mildenburg – mit denen er, noch ehe er ihr Direktor war, Affären hatte.
Kaiser Franz Joseph ließ den Direktoren der Hoftheater freie Hand, weder er selbst noch seine Minister oder Beamten sollten auf die Führung der Wiener Bühnen Einfluss nehmen. Umso heftiger die Reaktion Mahlers, als Erzherzog Peter Ferdinand – ein entfernter Verwandter des Kaisers aus der toskanischen Linie des Hauses Habsburg – bei ihm vorsprach, um eine eigene Komposition zur Aufführung zu bringen. Der Erzherzog betonte, es sei »der ausdrückliche Wunsch des Kaisers«, dass sein Werk an der Wiener Hofoper gespielt würde.
Mahler selbst hinterließ uns, wie er daraufhin reagierte: »Ich habe zu dem Erzherzog gesagt: ›Es tut mir leid, Kaiserliche Hoheit, aber ich kann nicht Wünsche, sondern nur Befehle Seiner Majestät erfüllen. Wenn mir der Kaiser befiehlt, Ihre Oper aufzuführen, werde ich es tun. Nur werde ich dann ins Programmheft drucken lassen: ‚Auf Befehl Seiner Majestät, Kaiser Franz Josephs, Erstaufführung der Oper Soundso von Erzherzog Peter Ferdinand.‘‹«
Die Oper blieb unaufgeführt.
Mahler machte sich durch seine offene Art viele Gegner, aber die übelsten Anfeindungen waren antisemitisch geprägt. Er litt so sehr darunter, dass er zum katholischen Glauben konvertierte, was natürlich wenig half. Die von mehreren Zeitungen unterstützte Kampagne gegen ihn gipfelte darin, dass ihm die Uraufführung von Richard Strauss’ »Salome« untersagt wurde. Damit hatten seine Vorgesetzten bei Hof übers Ziel hinaus geschossen, und er trat als Operndirektor zurück. »Ich gehe«, schrieb er 1907 an einen Freund, »weil ich das Gesindel nicht mehr aushalten kann.«
Felix Salten urteilte nach Mahlers Abgang: »Im Anfang hat ihn nur seine frenetische Unbeliebtheit populär gemacht, es war täglich zu hören, dass er seine Musikanten misshandelt, sie zu unmenschlicher Arbeit peitscht, schier zu Tode hetzt, und dass ihn alle, wären sie’s nur imstande, am liebsten in einem Löffel Wasser ertränken möchten. Die Intensität seines Wesens schien die ganze Stadt zu füllen. Leute stritten hitzig über ihn, die niemals sonst in der Oper waren. Jetzt liefen sie herzu, um ihn zu sehen. Wieder andere Leute, die bisher kaum gewusst hatten, was ein Theaterdirektor ist und soll, fragten nach dem bösen Mahler.«
Noch als Operndirektor hatte Mahler im Salon der Bertha Zuckerkandl die um fast zwanzig Jahre jüngere Alma Schindler kennen gelernt und sich Hals über Kopf in sie verliebt. Die Tochter des Malers Emil Jakob Schindler und Stieftochter des Malers Carl Moll war in einem künstlerischen Umfeld aufgewachsen, in dem sie früh Gustav Klimt und Alexander von Zemlinsky kennen lernte (mit denen sie ebenfalls Verhältnisse hatte). Als Alma und Gustav Mahler im März 1902 heirateten, stellte er klar, dass sie nicht weiterkomponieren dürfte, um sich auf ihre Aufgaben als Ehefrau konzentrieren zu können, was sie ihm nie verzieh.
Die Sommerferien verbrachte das Ehepaar in einem »Komponierhäuschen« am Attersee, das eigens für Mahler errichtet worden war und in dem er sich voll und ganz der Musik hingab. Als er dort den Besuch seines Komponisten- und Dirigentenkollegen Bruno Walter erhielt, fiel Mahler auf, dass dieser sich jeden Berg, jeden Baum und jeden Strauch der Landschaft ganz genau ansah. Mahler nahm Walter an der Hand und sagte: »Sie brauchen sich hier gar nicht mehr umzusehen. Hier herum hab ich schon alles wegkomponiert!«
Auch den Sommer des Jahres 1910 verbrachten Alma und Gustav Mahler am Attersee. Während dieses Urlaubs hatte Alma eine stürmische Liebesbeziehung mit dem Architekten Walter Gropius, der sich im steirischen Tobelbad zur Kur aufhielt. Als der fünfzigjährige Mahler von der Affäre seiner Frau erfuhr, war die Erschütterung so groß, dass er Sigmund Freud konsultierte.
Mahler wurde nach seinem Abgang aus Wien Leiter der New Yorker Philharmoniker und Dirigent an der Metropolitan Opera, wo er mit Enrico Caruso und wieder mit Leo Slezak arbeitete.
Alma heiratete, nachdem Mahler 1911 verstorben war, ihren Geliebten Walter Gropius und später den Dichter Franz Werfel. Dennoch ließ sie sich bis an ihr Lebensende als »Witwe Gustav Mahlers« feiern. Sie wurde zur Femme fatale, zum Inbegriff der Muse großer Künstler. Als Gerhart Hauptmann und seine Frau einen Abend mit ihr verbrachten, griff er zu später Stunde nach ihrer Hand und seufzte: »Alma, wenigstens im Jenseits müssen wir ein Paar werden. Dafür melde ich mich jetzt schon an.«
»Aber Gerhart«, unterbrach Frau Hauptmann, »ich bin überzeugt, dass Frau Alma auch im Himmel schon gebucht ist.« Sie starb 1964 in New York.
Mit seinen Symphonien, seinen Orchester- und Klavierliedern steht Mahler an der Schwelle zur Neuen Musik, die den Weg zu Alban Berg, Anton von Webern und Arnold Schönberg ebnete.
Für den 1874 in Wien geborenen »Vater der Zwölftonmusik« war es nicht leicht, sich daran zu gewöhnen, dass die Musiker im Orchestergraben seinem Werk skeptisch gegenüberstanden. Als Schönberg bei einer Probe wieder einmal erkennen musste, dass die Mitglieder eines Symphonieorchesters sehr zurückhaltend spielten, erklärte er: »Meine Herren, in fünfzig Jahren wird man meine Musik überall aufführen und verstehen, und die Gassenjungen werden sie pfeifen.«
Da zischelte der erste Geiger seinem Sitznachbarn zu: »Und warum müssen wir sie dann heute schon spielen?«
Die Jahrhundertwende war auch die Zeit der gehobenen Wiener Unterhaltungsmusik – gekrönt durch die »Walzerdynastie« Strauß, durch Lanner, Millöcker, Heuberger, Ziehrer und Franz von Suppè, dem im dalmatinischen Split geborenen »Erfinder« der leichten Muse. Er hatte die ursprünglich aus Frankreich kommende und von Offenbach erdachte Operette mit Elementen des Altwiener Singspiels verschmolzen und damit den speziellen Typus der Tanzoperette geschaffen. Form und Inhalt der Wiener Operette waren ganz anders als das Pariser Vorbild, ja geradezu ins Gegenteil verkehrt. Sollte sie an der Seine verspotten und kritisieren, so diente die Operette an der Donau – durchaus im Einklang mit der österreichischen Lebensart – von Anfang an der Verherrlichung des Kaiserhauses und der Erhaltung bestehender Gesellschaftsformen.
Johann Strauß Vater, der Gründer der Familie, die den Dreivierteltakt populär machte, war 1804 in Wien als Sohn des Gastwirts der Schenke »Zum guten Hirten« am Donaukanal zur Welt gekommen. Schon in der väterlichen Schankkapelle stellte er sein überragendes Talent unter Beweis, wurde aber von den Eltern gezwungen, bei einem Buchbinder in die Lehre zu gehen. Als er 15 Jahre alt war, lernte er den etwas älteren Joseph Lanner kennen, der ein Dreimannorchester leitete und ihn als Bratschisten engagierte. Bald gingen die beiden jedoch getrennter Wege, Strauß gründete eine eigene Kapelle, wurde zum erbitterten Konkurrenten Lanners und stellte im Alter von 22 Jahren seine erste Komposition, den »Täuberlwalzer«, vor. Während bis dahin in Adelskreisen immer noch fast ausschließlich das gespreizte Menuett getanzt wurde, machte Strauß den Dreivierteltakt hoffähig und den Walzer zum beliebtesten Gesellschaftstanz.
Als Dreißigjähriger zum Hofballmusikdirektor ernannt, verließ er im selben Jahr seine Frau Maria Anna Streim und die drei Söhne. Der älteste, Johann, war zehn, Josef acht und Eduard gerade erst zur Welt gekommen. Johann Strauß Vater lebte fortan mit der Modistin Emilie Trampusch und kümmerte sich herzlich wenig um seine Familie. Nur einen Wunsch wollte er »den Buben« mit auf den Weg geben: »Alles könnt’s werden, nur eins nicht – Musikanten!« Zu viele gescheiterte Existenzen hatte er im Laufe seines Berufslebens gesehen, Künstler gehörten damals – mit Ausnahme der wenigen, die berühmt waren – immer noch den untersten sozialen Schichten an.
Der väterliche Protest half nichts, die Musik lag den Söhnen im Blut, sie mussten Musiker werden.
War Joseph Lanner anfangs der Konkurrent von Strauß Vater, so wuchs bald in seinem eigenen Sohn Johann ein Genie heran, das die Popularität des »alten Strauß« in den Schatten stellte. Der »Walzerkönig«, wurde zum beliebtesten Österreicher ex aequo mit dem Kaiser, weshalb man auch davon sprach, dass Österreich »von zwei Kaisern regiert« würde. Als Strauß 1862 die um sieben Jahre ältere Sängerin Henriette Treffz heiratete, ließ er sich einen mächtigen Vollbart wachsen, der den Altersunterschied ausgleichen sollte. Strauß Sohn machte seinem Namen alle Ehre und blieb auch in der Ehe der Sohn, »Jetty« nannte ihn sogar »mein Bub«.
Nach einiger Zeit des Wildwuchses wurde »Schanis« Bart zu einem Kaiserbart gestutzt, der dem des Monarchen verdächtig ähnelte. Das aber war Franz Joseph gar nicht recht. Im Sommer 1862 meldete die »Morgenpost«, dass »Allerhöchst Seine Majestät seinen Backenbart abrasiert hat und nur mehr einen Schnurrbart trägt. Wie man erfährt, fiel des Kaisers Bart aus galanter Zärtlichkeit für die Kaiserin. Ihre Majestät ließ nämlich die Bemerkung fallen, dass der Kaiser früher, bevor er den Backenbart getragen, jugendlicher und munterer ausgesehen habe.«
Kaiser und (Walzer-)König hatten der Liebe wegen konträr gehandelt: »Franzl«, weil er seiner Frau zu alt, »Schani«, weil er der seinen zu jung erschien. Nun wurde in allen Teilen der Monarchie heftig gestritten, ob die beiden mit oder ohne Bart fescher wären. Johann Strauß blieb zeitlebens Bartträger, und auch Franz Joseph ließ den seinen bald wieder sprießen. Das also war der Grund für den berühmten »Streit um des Kaisers Bart«.
Wie Johann Strauß die Noten förmlich zuflogen, entnimmt man der Aussage eines Komitee-Mitglieds des Wiener Technikerballs. Dieses trat kurz vor der Eröffnung in einem Restaurant an den »Walzerkönig« heran, um ihn zu fragen, wie weit die Komposition eines vor Wochen in Auftrag gegebenen Musikstückes gediehen sei. »Ach Gott, ich hab noch keine Note«, gestand Strauß, nahm die Speisekarte zur Hand und ließ innerhalb von dreißig Minuten den heute noch populären »Accelerationen-Walzer« entstehen.
Strauß erfreute sich in der Damenwelt derartiger Beliebtheit, dass sein Lebenswandel in einem Akt der k. k. Polizeidirektion als »unsittlich und leichtsinnig« bezeichnet wird. Der »Strauß-Schani« war nach »Jettys« plötzlichem Tod im April 1878 noch zweimal verheiratet, etliche Male verlobt und im Wien des 19. Jahrhunderts Mittelpunkt gesellschaftlicher Skandale – etwa, als seine zweite Frau Lily mit dem Direktor des Theaters an der Wien »durchging«. Oder als er in seiner dritten Ehe der Bigamie bezichtigt wurde, worauf er zum protestantischen Glauben überwechselte und die österreichische Staatsbürgerschaft aufgab, um den Rechtsfolgen seiner (gesetzlich gültig gebliebenen) zweiten Ehe zu entgehen.
Hätte Josef Strauß in einer anderen Generation gelebt, wäre er unter Garantie der bedeutendste Unterhaltungsmusiker gewesen. Aber da war eben der ältere Johann, neben dem keiner bestehen konnte, auch wenn Josef große Melodien wie den »Dorfschwalbenwalzer« oder »Mein Lebenslauf ist Lieb und Lust« komponiert hatte. Der Absolvent der Technischen Hochschule Wien war auch als Mathematiker überaus begabt und hatte eine Straßenkehrmaschine erfunden.
Aber in jedem Strauß steckte Musik. Und daher übernahm Josef, wann immer sein älterer Bruder verhindert war, die Leitung der Strauß-Kapelle. Der eitle aber doch als bescheiden geltende Johann soll über seinen Bruder Josef gesagt haben: »Ich bin populärer, er ist begabter.«
Eduard, der Jüngste, hatte es zweifellos am schwersten. Obwohl er eine Diplomatenschule absolviert hatte, war er von der Musik ebenso besessen wie seine Brüder und begann in Johanns Kapelle Violine und Harfe zu spielen, bis auch er sein eigenes Orchester gründete, mit dem er in aller Welt Gastspiele gab. Doch sämtliche Erfolge konnten nicht über die Verbitterung hinwegtäuschen, doch nur »der kleine Bruder« vom großen Johann zu sein. In einem Anfall von Sinnesverwirrung vernichtete er in seinen späten Jahren alle vorhandenen Noten des Vaters und der beiden Brüder.
Mehrere überragende Talente innerhalb einer Familie sind in der Musikwelt keine Rarität: Mozart hatte einen bedeutenden Vater, Bach und Wagner begabte Söhne, Haydn einen bemerkenswerten Bruder. Aber dass eine Musikerdynastie ausschließlich aus Genies besteht – das macht den »Sträußen« keine andere Familie nach.
Und es wird noch sehr viel Wasser die angeblich blaue Donau hinunterfließen, und die Welt wird immer noch nach ihren Klängen tanzen.
Mit den Werken Franz Lehárs, Emmerich Kálmáns, Leo Falls, Paul Abrahams, Oscar Straus’, Edmund Eyslers und Robert Stolz’ wurde die Goldene durch die Silberne Operette abgelöst. Die Kaiserhäuser gehörten ab 1918 der Vergangenheit an, dienten der Operette des 20. Jahrhunderts aber immer noch zur Befriedigung nostalgischer Sehnsüchte und zur Verherrlichung der »guten alten Zeit«, in der sich Aristokraten und Offiziere ihrer Heldentaten rühmen durften.
Lehárs Danilo ging, wenn er das Vergnügen suchte, ins Maxim, um sich dann doch für »Die lustige Witwe« zu entscheiden. Der Schöpfer dieser Operette war selbst alles andere als leichtlebig. Franz Lehár hat den Verlust seiner Jugendliebe Ferdinanda Weißenberger, um deren Hand er 1903, als 33-jähriger Kapellmeister, angehalten hatte, nie überwunden. Ferdinandas Tante, die legendäre Anna Sacher, untersagte ihr die Beziehung »mit dem Hungerleider«, worauf das Mädchen einen Bauunternehmer heiraten musste. Ferdinanda und Franz Lehár haben einander nie aus den Augen verloren.
Zwei Jahre nach der Ablehnung durch Anna Sacher war »der Hungerleider« dank des Welterfolgs der »Lustigen Witwe« ein vielfacher Millionär – der das Sacher, als es später in den Konkurs schlitterte, spielend hätte retten können.
Lehár – von dem der Satz »Die Frauen sind Luft für mich, aber ich kann ohne Luft nicht leben« überliefert ist, fand nach seiner großen Enttäuschung bei Ferdinandas bester Freundin Sophie Trost, die ihrerseits aber verheiratet war. Also konnte der Meister, den damaligen Konventionen gehorchend, auch mit Sophie nicht zusammenleben. Es dauerte zwanzig Jahre, bis Sophie Meth geschieden war, Lehár sie 1924 ehelichen und mit ihr einen gemeinsamen Haushalt gründen konnte.
Der »zweite Walzerkönig«, wie Lehár auch genannt wird, besaß zu diesem Zeitpunkt bereits eine am rechten Traunufer in Bad Ischl gelegene repräsentative Villa, die er mit den aus aller Welt einfließenden Tantiemen finanziert hatte. Der Hauptwohnsitz des Ehepaares befand sich aber seit den frühen Dreißigerjahren im »Schikaneder-Schlössel« in Wien-Nussdorf, das einst im Eigentum Emanuel Schikaneders gestanden war.
Nach 1938 gelang es Lehár dank seiner Prominenz seine jüdische Frau vor der angedrohten Verhaftung und Deportation durch die Nationalsozialisten zu schützen. Nichts unternahm er aber, um in dieser Zeit seinen langjährigen Librettisten Fritz Löhner-Beda zu schützen, der mit ihm die Operetten »Das Land des Lächelns« und »Giuditta« geschrieben hatte. Er wurde 1942 im KZ Auschwitz ermordet.
* Entspricht laut »Statistik Austria« im Juli 2009 einem Betrag von rund 120 000 Euro.
* Karl Friedrich Amenda, Geiger und enger Freund Beethovens