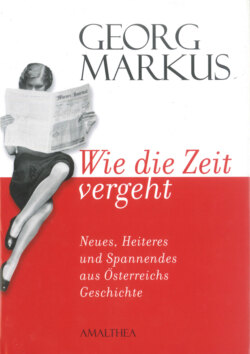Читать книгу Wie die Zeit vergeht - Georg Markus - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
MAJESTÄT RASIERTE SICH GANZ ALLEINE Wer aller dieses Land regierte
ОглавлениеDem künftigen Kaiser lag ein riesiges Reich zu Füßen. Was ihm noch fehlte, war eine passende Frau. Nicht, weil er das dringende Bedürfnis nach Zweisamkeit verspürte, sondern weil das Haus Habsburg andernfalls bankrott zu gehen drohte. Da erfand Maximilian I. die Formel, dass Österreich lieber heiraten als Kriege führen sollte.
Wie aber kam so ein Prinz an eine »gute Partie« heran, die noch dazu aus erster Familie zu stammen hatte?
Nun, es gab damals einen richtigen Heiratsmarkt, auf dem man junge Damen von königlichem Geblüt besichtigen konnte. Freilich wäre es unter den Reisebedingungen des 15. Jahrhunderts zu beschwerlich gewesen, alle in Frage kommenden Bräute Europas persönlich in Augenschein zu nehmen – und die Fotografie war noch lange nicht erfunden.
Maximilian, auch als letzter Ritter bekannt, bekam durch einen reitenden Boten eine auf Porzellan gemalte Miniatur überreicht, mit der er sich ein Bild von der Auserwählten machen konnte. Dafür waren an jedem Hof Künstler engagiert, die keine anderen Aufgaben hatten, als Porträts der Königstöchter und -söhne anzufertigen. Es konnte allerdings zu bösen Überraschungen kommen, zumal die Hofmaler den Auftrag hatten, die Kinder ihrer Herrschaft möglichst idealisiert darzustellen.
Der durch seinen prunkvollen Lebensstil mehrfach an den Rand des Ruins geratene Maximilian konnte mit seiner ersten Gemahlin Maria von Burgund eine glückliche, wenn auch nur kurze Ehe führen. Sie starb 1482 an einer Fehlgeburt, die sie als Folge eines Jagdunfalls erlitten hatte. Aber dafür erbten die Habsburger jetzt das blühende Burgund, das von Frankreich bis in die Niederlande reichte. Die Heirat hatte Österreichs Finanzen gerettet.
Wie’s der Zufall wollte, entstammte auch Maximilians Gattin Nummer zwei, Bianca Sforza, einem der reichsten Häuser Europas. Und eine Schönheit war sie obendrein.
Das mit dem Aussehen der Habsburger war so eine Sache. Während Kaiser Maximilian eine durchaus respektable Erscheinung war und sein Sohn Philipp sogar den Beinamen »der Schöne« trug, durfte sich dessen Sohn Karl V. keineswegs einer edlen Physiognomie erfreuen. Noch schlimmer erging es Kaiser Leopold I., einem hässlichen, fast zwergenhaften Mann, der mit einer besonders ausgeprägten Form der so genannten Habsburger-Lippe ausgestattet war.
Es war die polnische Prinzessin Cimburga von Masowien, die im 15. Jahrhundert durch Einheirat die wenig vorteilhaften Gesichtszüge in die Dynastie gebracht hatte. Von ihrer herabhängenden Unterlippe und ihrem vorspringenden Kinn waren mehrere Generationen betroffen, bei manchen Habsburgern war die Deformation so ausgeprägt, dass sie kaum in der Lage waren, den Mund zu schließen. Wie eben Kaiser Leopold, der sich nur »stockend und brummend« verständigen konnte, da ihn die Lippe sogar am Sprechen hinderte. »Man möchte fast bezweifeln, dass mit ihm der Herrgott wirklich einen Menschen erschaffen wollte«, beschreibt der türkische Gesandte Evliya Çedlebi die Erscheinung des Kaisers. »Seine Lippen sind wulstig wie die eines Kamels, und in seinen Mund würde ein ganzer Laib Brot auf einmal passen. Die Pagen wischen ihm mit riesigen roten Tüchern ständig den Geifer ab. Während die Pagen dieses armen Teufels von einem Kaiser allesamt lieblich und schön sind, ist er garstig anzusehen.« Leopold war dreimal verheiratet und hatte 16 Kinder.
Sein aus der Spanischen Linie der Habsburger stammender Vorfahre Karl V. hatte es zuwege gebracht, das ehemals bedeutungslose Geschlecht als einflussreichste Dynastie der Welt zu etablieren. Die Habsburgergebiete reichten im 16. Jahrhundert von Österreich über die Niederlande, Spanien, Portugal und Italien bis zu den überseeischen Besitzungen in Amerika, Afrika und Asien – tatsächlich schien in Kaiser Karls Reich immer irgendwo die Sonne. Die Allmacht wurde freilich nicht nur durch Heirat, sondern sehr wohl auch durch Kriege und unvorstellbare Brutalität erreicht, mit der die Konquistadoren Cortés und Pizarro Amerika in einen Kontinent des Blutes verwandelten.
Neben Heirat und Kriegsführung gab es noch einen dritten Weg, an die Macht zu gelangen oder sie zu behalten. Man konnte sie kaufen – durch Bestechung. Um von den Kurfürsten zum Kaiser des Heiligen Römischen Reichs gewählt zu werden, mussten diese jedes Mal mit »Geschenken« bedacht werden. Dabei ging es um so hohe Beträge, dass die Monarchen gezwungen waren, sich Geld zu leihen. Erste Adresse für Kredite in dieser Größenordnung waren die Fugger, die zu den reichsten Bank- und Handelsherren Europas zählten. Als Karl V. im Jahre 1530 nicht in der Lage war, seine zur Erlangung der Kaiserwürde längst fällig gewordenen Schulden zu begleichen, stattete er, von einer Reise aus dem Süden kommend, Jakob Fugger in Augsburg einen Besuch ab. Kaiser und Handelsherr nahmen gemeinsam das Frühstück ein, bei dem Karl um Verständnis dafür bat, das offene Darlehen nicht zurückzahlen zu können. Dann wechselte er das Thema: »Es ist kalt in Deutschland«, sagte der Kaiser, »wenn man aus Italien kommt.«
Jakob Fugger verstand den Wink. Er ließ das Kaminfeuer anmachen, zog die Schuldverschreibung aus der Jackentasche, warf sie ins Feuer und sprach: »Weil Eure Majestät mir die Ehre antun, Gast in meinem Hause zu sein, sind alle Eure Schulden beglichen.«
Als Karl V. regierte, übernahm der Wiener Hof das »Spanische Hofzeremoniell« der Habsburger, dessen Wurzeln von burgundischen Herzögen am Beginn des Mittelalters stammen. Es sollte vor aller Welt das Gottesgnadentum, aber auch Macht, Glanz und Würde des jeweiligen Herrschers dokumentieren. Wie streng die Vorschriften waren, zeigen schon die Tischsitten, denen zufolge es der Kaiserin untersagt war, gemeinsam mit ihrem Mann zu speisen. Doch es kam noch schlimmer. Dem Monarchen war es nicht gestattet, seiner Gemahlin einen »spontanen Besuch« abzustatten. Ein Tête-à-Tête musste lange davor, auf Tag und Stunde vorausgeplant, bekannt gegeben werden. War’s dann endlich soweit, legte der Kaiser das schwarze Hofkleid mit Mantel an, um vom Obersthofmeister in den Wohntrakt seiner Frau geleitet zu werden. Dort empfingen ihn deren gesamtes Gefolge sowie eine Abteilung von Hellebardieren, die den lüsternen Liebhaber durch eine Flucht von Vorräumen in das Schlafgemach der Kaiserin führten. Jetzt erst trat das Gefolge, streng nach Rängen geordnet, den Rückzug an und das Hohe Paar durfte sich – so noch ein Rest von Leidenschaft vorhanden – der Liebe hingeben. Damit’s nicht allzu intim wurde, wartete der gesamte Hofstaat in einer den Schlafgemächern angrenzenden Kemenate.
Laut Zeremoniell stand allein dem Kaiser das Privileg zu, seine Gemahlin völlig nackt erblicken zu dürfen. Das führte dazu, dass der Hofarzt, wenn sie medizinischer Hilfe bedurfte, darauf angewiesen war, sich bei den Hofdamen nach dem Befinden Ihrer Majestät zu erkundigen.
Zu welch grotesken Konsequenzen das Zeremoniell auch sonst noch führen konnte, zeigt eine im 15. Jahrhundert angesiedelte Episode: Als Spaniens regierende Königin Isabella I. beim Ausritt vom Pferd glitt, blieb sie mit einem Fuß im Steigbügel hängen und wurde von dem weitertrabenden Tier mitgeschleift. Der Erste Stallmeister, der als Einziger das Recht hatte, den königlichen Fuß zu berühren, war nicht zugegen, weshalb keiner der 43 anwesenden Aristokraten es wagte, der Königin zu helfen. Endlich befreite ein hoffremder Herr die Monarchin aus ihrer misslichen Lage. Die ritterliche Aktion zerstörte sein Leben: Weil er die Königin unerlaubterweise berührt hatte, wurde der Kavalier mit lebenslanger Verbannung aus Spanien belegt!
Besagte Isabella von Kastilien hat aber in erster Linie deshalb Geschichte geschrieben, weil sie Kolumbus den Auftrag zu jener Reise gab, die zur Entdeckung Amerikas führte. Ihre Tochter Johanna wurde im Alter von 16 Jahren – nach Austausch der auf Porzellan gemalten Miniaturen und ganz im Sinne der Habsburgischen Heiratspolitik – mit Kaiser Maximilians Sohn, Philipp dem Schönen, verlobt.
Als der seine Braut zum ersten Mal sah, bestand er darauf, augenblicklich getraut zu werden. Jegliches Zeremoniell außer Acht lassend, zog sich das Paar ins nun eheliche Schlafgemach zurück. Johanna war ihrem schönen Gemahl dermaßen verfallen, dass sie von zunehmend krankhafter Eifersucht geplagt wurde. Zeitweise war sie intensiv damit beschäftigt, alle weiblichen Wesen aus seiner Umgebung zu verbannen.
Dem Haus Habsburg fielen durch diese Heirat Spanien und Territorien in Italien zu.
Als der schöne Philipp – inzwischen König von Spanien geworden – nach zehnjähriger Ehe starb, verfiel Johanna dem Wahnsinn. Sie weigerte sich, den Sarg mit den sterblichen Überresten ihres Mannes herauszugeben, schleppte ihn auf Reisen mit sich und öffnete ihn regelmäßig, um sich zu vergewissern, dass Philipp tatsächlich tot war. Die Unglückliche überlebte ihren Mann um 48 Jahre und wird heute noch Johanna die Wahnsinnige genannt.
Ein gutes Jahrhundert später wurde Karl VI., der nicht nur als Vater der Kaiserin Maria Theresia Bedeutung erlangte, geboren. In seine Ära fällt die Entfaltung der Barockkunst und damit einer der kulturellen Höhepunkte des Landes. Der als Komponist wie als Dirigent überaus begabte Karl VI. ließ es sich nicht nehmen, die Oper »Elisa« seines Hofkompositeurs Joseph Fux persönlich aus der Taufe zu heben. Fux war von der Wiedergabe durch den kaiserlichen Maestro so angetan, dass er nach der Uraufführung ausrief: »Wie schade, dass Eure Majestät kein Virtuose geworden sind!«
Worauf der Kaiser erwiderte: »Macht nichts. Mir geht’s auch so ganz gut!«
Da Karls einziger Sohn früh starb, drohte das Haus Habsburg auszusterben. Allerdings hatte der Monarch durch Erlass der »Pragmatischen Sanktion« dafür gesorgt, dass die Erbfolge auch auf weibliche Mitglieder der Dynastie übergehen konnte. Dadurch wurde seine ältere Tochter Maria Theresia Thronfolgerin. Durch ihre Heirat mit Franz Stephan von Lothringen erhielt das österreichische Herrscherhaus den Namen Habsburg-Lothringen.
Karl VI. war ein strenger Verfechter des Hofzeremoniells, dessen Einhaltung er persönlich überwachte. Er kritisierte seine Umgebung sogar noch, als er im Herbst 1740 in seinen letzten Zügen lag. Angeblich, weil um sein Sterbebett herum nicht genug Kerzen aufgestellt wurden.
Maria Theresia, die »Kaiserin Maria Theresia«, wie sie von aller Welt genannt wird, trug eigentlich den Titel Erzherzogin – Kaiser war ihr Mann. Doch sie, die volkstümliche Frau des Kaisers, hatte »die Hosen an«. Obwohl es ihr von Anfang an nicht leicht gemacht wurde. Maria Theresia saß erst acht Wochen auf dem Thron, als Friedrich der Große mit seinen Truppen ohne vorherige Kriegserklärung über das österreichische Schlesien herfiel. Ausgerechnet jener Preußenkönig Friedrich, der in seiner Jugend von ihr geschwärmt und sie hatte heiraten wollen. In späteren Zeiten sagte die Kaiserin oft: »Es war besser, Schlesien verloren, als den geheiratet zu haben!«
Die junge und unerfahrene Regentin wurde auch von anderen Nationen auf eine harte Probe gestellt. Erst nach dem Ende des »Erbfolgekriegs« sollte es Maria Theresia gelingen, Österreichs Machtposition in Europa zu festigen. Nun konnte sie ihre historische Reformtätigkeit beginnen. Die parallel dazu geförderte Einheirat ihrer Kinder in andere regierende Häuser trug ihr den Titel »Schwiegermutter Europas« ein.
Die Kaiserin führte ihr Reich in ähnlicher Weise wie ihre Familie, und beide waren von beachtlicher Größe. Hatte sie in der Monarchie 19 Millionen Untertanen, so waren es zu Hause 16 Kinder. Nach drei Töchtern kam der sehnsüchtig erwartete Thronfolger Josef, der entsprechend verhätschelt wurde. »Die Kaiserin vergöttert den Erzherzog und lässt ihm viele Fehler hingehen, um derentwillen sie ihn lieber strafen sollte«, ist überliefert. Josef war – würde man heute sagen – ein Problemkind.
Maria Theresias Alltag zwischen Regieren und Kindererziehen war in ein strenges Korsett gedrängt, da blieb für philosophische Diskussionen keine Zeit. Als ihr ein Gelehrter erklärte, das einzig Richtige sei es, in vollkommener Einsamkeit zu leben, da man sich nur in diesem Zustand sammeln und konzentrieren könne, meinte die Kaiserin: »Einsamkeit ist gewiss etwas Schönes. Allerdings macht’s erst den rechten Spaß, wenn man jemanden hat, dem man diese kluge Erkenntnis auch mitteilen kann!«
Zu ihren Verdiensten zählen die für ganz Europa richtungweisende Einführung der Schulpflicht, die Verwaltungs-, Heeres- und Justizreform, sie förderte Industrie und Handel, baute Verkehrswege und trat für eine Angleichung der Stände ein: »Ein Fürst besitzt keine andere Berechtigung als jeder Privatmann«, teilte sie ihrem Staatskanzler Kaunitz mit, der selbst Fürst gewesen ist.
Bei all ihrer Bedeutung ähnelten Maria Theresias Sorgen innerhalb der eigenen vier Wände jenen, die viele andere Frauen hatten. Sie litt unter der Untreue ihres Mannes und gab sich schon aus diesem Grund sittenstreng. Als Maria Theresia erfuhr, dass eine ihrer Hofdamen eine nicht ganz einwandfreie Ehe führte, war sie derart empört, dass sie auf der so genannten Hofrangliste neben ihrem Namen eine tadelnde Bemerkung setzte. Daraufhin intervenierte deren Verwandtschaft gegen die Herabsetzung, worauf Maria Theresia Milde zeigte. Nicht ohne hinzuzufügen: »Meinetwegen, streich ich die Sache weg. Aber ich will es so machen, dass man gleich merkt, dass hier radiert wurde.«
Maria Theresia hatte die Zeichen der Zeit erkannt und die dringend notwendige Modernisierung des Reichs in die Wege geleitet.
So mächtig sich Österreich jetzt präsentieren konnte, so klein hatte alles angefangen. Vor der sechshundert Jahre währenden Herrschaft der Habsburger war das Land von Kelten, Römern, Hunnen, Goten, Langobarden, Awaren, Merowingern und Karolingern besetzt. Bis der erste Babenberger an die Macht kam. Er hieß Leopold – der Erste natürlich – und residierte in Pöchlarn, einem kleinen Ort an der Donau, der aufgrund seiner günstigen Lage ein wichtiges Handelszentrum und damit die ideale Hauptstadt war. Man schrieb, als besagtem Leopold der Titel Markgraf verliehen wurde, den 21. Juli 976. Und erklärte dieses Datum später zur Geburtsstunde Österreichs.
Der Mann, der am Anfang Österreichs stand, fand ein schreckliches Ende: Als Leopold am 10. Juli 994 Gast einer Festmesse des Bischofs von Würzburg war, wurde auf seinen Vetter Heinrich ein Mordanschlag verübt. Der Pfeil des Schützen verfehlte sein Ziel – und traf den armen Leopold, der tot zusammenbrach. Kein besonders guter Start für ein neues Land.
Aus der 270-jährigen Herrschaftsepoche der Babenberger blieben alle Ortsnamen, die mit -gschwend, -reith, -brand, -schlag enden und die Gründung Dutzender Klöster von St. Florian, Göttweig und Melk bis Heiligenkreuz und Klosterneuburg. Weiters danken wir ihnen den Ursprung der rot-weiß-roten Fahne: Als Herzog Leopold V. während des Dritten Kreuzzugs in der Schlacht bei Akkon im Jahre 1191 schwer verwundet wurde, legte er seinen breiten Gürtel ab. Der blutverschmierte Körper und die Stelle, an der er weiß blieb, führten zu den späteren Landesfarben. Das jedenfalls besagt eine der vielen Überlieferungen, die es zu diesem Thema gibt.
Auch dass Wien zur Metropole des Landes wurde, ist den Babenbergern zu danken. Leopolds Vater, Markgraf Heinrich Jasomirgott, war es, der nach Pöchlarn, Melk und Klosterneuburg Wien zur Residenz erhob. Seinen Beinamen Jasomirgott verdankt Heinrich übrigens dem Umstand, dass er bei wichtigen Entscheidungen immer den Satz »Ja so mir Gott helfe« gebraucht haben soll.
Schon die Babenberger haben es verstanden, ihre Ehepartnerinnen aus einflussreichen Sippschaften zu rekrutieren, woraus sich verwandtschaftliche Beziehungen zu den reichsten Familien Europas ergaben, die die Bedeutung der Dynastie stärkten. Besonders erfolgreich war diesbezüglich Markgraf Leopold III., dessen zweite Frau Agnes das Vermögen ihres verstorbenen Ehemannes Friedrich von Staufen mit in die Ehe brachte. Hatte sie diesem bereits elf Kinder geboren, so kamen nun 17 weitere mit dem Babenberger Leopold hinzu. Agnes hat mit 28 leiblichen Kindern bis zum heutigen Tag zweifellos jedweden diesbezüglichen Rekord in herrschaftlichen Häusern gebrochen. Leopold III. wurde später heilig gesprochen, was schon das Aufziehen so vieler Kinder zu rechtfertigen scheint, und ist heute noch Landespatron von Österreich.
Dennoch: Selbst die ständige Heiraterei und die vielen Kinder konnten das Aussterben der Babenberger nicht verhindern. Ausgerechnet im 13. Jahrhundert, als Wien drauf und dran war, ein kulturelles Zentrum des Heiligen Römischen Reichs zu werden, sah das Herrschergeschlecht seinem Ende entgegen. Herzog Friedrich II. – genannt der Streitbare (weil er sich mit allen überworfen hatte, inklusive seinem Vater, seiner Mutter, seiner Schwester und den Königen von Böhmen und Ungarn) – fiel unter Reichsacht und wurde aus Österreich vertrieben. Als er im Juni 1246 im Kampf gegen die Ungarn starb, war der Mannesstamm der Babenberger erloschen.
Daraufhin gelang es schließlich – nach einem Interregnum durch den Přemysliden Ottokar von Böhmen – Rudolf von Habsburg, in der Schlacht auf dem Marchfeld im Jahre 1278 die Macht an sich zu reißen.
Die ursprünglich unbedeutenden, aus der Schweiz stammenden Habsburger erwarben im späten Mittelalter eine Reihe von Ländern, darunter Kärnten, Krain, Tirol und Vorarlberg, wodurch am Beginn der Neuzeit – mit Ausnahme von Salzburg, dafür inklusive einiger Gebiete Italiens und Sloweniens – das heutige österreichische Territorium entstand.
Als Kaiserin Maria Theresia 1780 starb, wurde ihr seit Längerem schon mitregierender Sohn Josef Alleinherrscher. Er war ein kluger, sparsamer und weitsichtiger Reformator, dessen Leitsatz lautete: »Ich war ein Mensch, bevor ich Herrscher war, und das halte ich für meine beste Eigenschaft.«
Bekannt dafür, dass er sich gern »unters Volk« mischte, besuchte Josef II. eines Tages, während seine Pferde in Bologna an einer Tränke versorgt wurden, ein Kaffeehaus, in dem er mit einem ebenfalls durchreisenden Offizier ins Gespräch kam. Als ihm der Fremde anvertraute, dass er in Diensten des Papstes stünde, seit Längerem aber schon seinen Dienst quittieren wollte, weil er vom Vatikan schlecht bezahlt würde, meinte Josef: »Warum treten Sie nicht in andere Dienste ein, zum Beispiel in den italienischen Gebieten des Kaisers von Österreich?«
»An wen sollte ich mich dort wenden?«, fragte der Offizier. »Sie glauben doch nicht, dass die hohen Herren für unsereins zu sprechen sind.«
»Wenn’s weiter nichts ist«, sagte der Monarch, »ich gelte was beim Kaiser, ich will Sie empfehlen.«
Der päpstliche Offizier lachte über den jungen Mann, den er für einen Leutnant hielt, blieb aber höflich und bedankte sich.
»Um Ihnen zu beweisen, dass ich nicht mehr verspreche, als ich halten kann«, fuhr Josef fort, »will ich Ihnen einen Brief geben, der an eine hohe Standesperson gerichtet ist, die in wenigen Stunden hier durchkommen wird.« Der Kaiser schrieb den Brief und versiegelte ihn, adressiert an seinen Oberstallmeister Graf Dietrichstein.
Stunden später sprach der Fremde bei Dietrichstein vor, übergab ihm das Kuvert und versank fast im Erdboden, als der sagte: »Mein Herr, ich gratuliere, Sie haben den Kaiser selbst gesprochen. Er befiehlt mir, Ihnen vierhundert Zechinen zu geben, damit Sie sich zu dem Regiment verfügen, in dem er Ihnen eine Kompanie anvertraut.«
Der Offizier erhielt eine hohe und wesentlich besser bezahlte Stellung.
Seine große menschliche Breite führte auch dazu, dass Josef II. die mittelalterliche Leibeigenschaft der Bauern abschaffte, Mann und Frau in der Ehe gleichstellte, das Wiener Allgemeine Krankenhaus gründete, Folter und Todesstrafe abschaffte und die Steuereintreibung reformierte. Josefs Wirtschaftsmaßnahmen verdoppelten in manchen Ländern der Monarchie die Beschäftigungszahlen, seine Sozialreformen brachten Ansätze zur Kranken- und Altersversorgung. Er gründete das Burgtheater, ließ Presse und Bühne durch eine liberalere Zensurpolitik größere Freiräume, ja er duldete sogar Kritik an seiner Person. Mit dem »Toleranzpatent« gewährte er schließlich die freie Religionsausübung.
Im Gegensatz zu seiner Mutter, die behutsam reformierte, konnte es Josef nicht schnell genug gehen. Kraft und Tempo seiner Maßnahmen schufen viele Gegner – vor allem in der katholischen Kirche, als er ein Drittel aller Klöster sperren ließ, um in den frei werdenden Gebäuden Spitäler und andere soziale Institutionen zu errichten.
Dabei war Josef ein guter Christ. Als er den bis dahin nur Aristokraten zugänglichen Prater für jedermann öffnen ließ, pilgerten Tausende Familien in das Erholungsparadies. Sie stürmten Wirtshäuser und Erfrischungszelte, in denen Kaffee, Tee und Eis ausgeschenkt wurde. Kaiser Josef beobachtete an mehreren Sonntagvormittagen das bunte Treiben, ehe er in Gesprächen und Beobachtungen erkannte, dass viele Ausflügler in den Prater gingen, statt in die Kirche. Er schloss daraufhin die Parkanlage an den Sonntagvormittagen wieder. Um sie ab zehn Uhr, als die Messen vorbei waren, wieder zu öffnen. Nun gingen die Wiener in die Kirche – und danach in den Prater.
In seinem Privatleben bewies Josef II., dass er Staatsreform und Sparsamkeit nicht nur predigte: Er selbst lebte spartanisch, sperrte Schönbrunn und einen Teil der Hofburg zu, entließ die Dienerschaft seiner Mutter und kam mit einer einzigen Köchin aus. Er war der erste Herrscher, der sich alleine rasierte und selbst für die Körperpflege sorgte. Er entschärfte das Hofzeremoniell, schaffte Hofknicks und Handkuss ab und empfing Bittsteller aus dem Volk persönlich.
Wenn auch äußerst umstritten, war der »Reformkaiser« seiner Zeit um ein Jahrhundert voraus und ersparte Österreich damit möglicherweise einen Umsturz im Stil der Französischen Revolution. In den zehn Jahren, die der josefinischen Epoche gegeben waren, wurde in Österreich mehr verändert als in den Jahrhunderten davor.
Ein Aristokrat, dem die Öffnung zum Volke gar nicht recht war, beschwerte sich bei Josef: »Jetzt gibt es in Wien gar keinen Ort mehr, wo man unter seinesgleichen sein kann.«
»Ach ja«, stöhnte der Kaiser, »das Problem kenne ich. Wenn ich immer nur unter meinesgleichen sein wollte, müsste ich in die Kapuzinergruft hinuntersteigen!«
Das war eine nicht ganz ernst gemeinte Bemerkung, die sich aber allzu früh bewahrheiten sollte. Kaiser Josef starb, nur 48 Jahre alt, am 20. Februar 1790. Seine Bedeutung wird auch von der Tatsache nicht geschmälert, dass viele seiner Maßnahmen von seinem Bruder und Nachfolger, Leopold II., zurückgenommen wurden.
Nach Leopolds nur zweijähriger Regentschaft – er starb ebenso überraschend wie sein Bruder – begann der Niedergang des Hauses Habsburg, dem Leopolds engstirniger Sohn, Kaiser Franz, nur wenig entgegenzusetzen hatte. Er hat den Thron 1792 als Franz II. bestiegen und ist 43 Jahre später als Franz I. gestorben. Das lag daran, dass er 1806 als Kaiser des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation zurücktrat und fortan als Kaiser von Österreich (und somit Franz I.) weiterregierte.
Wie jeder Habsburger musste er ein Handwerk erlernen, wobei Franz sich für die Gärtnerei entschieden hatte, an der er sein Leben lang mehr Interesse zeigte als an der Politik. Er selbst soll einmal über seine schlichte Auffassung, die Staatsgeschäfte zu leiten, gesagt haben: »Kaiser, das ist ein großes Wort, aber ein guter Hofrat wär ich schon geworden.«
In der Tat war Franz einer der bürokratischsten Herrscher auf dem Thron der Habsburger. Diese Episode ist für ihn symptomatisch: Als sein Finanzminister Franz Graf O’Donnell 1810 starb, weilte der Kaiser zufällig in Prag, wo er sich nun auf die Suche nach einem Nachfolger für dieses schwierige Amt begab. Er befahl den Verwalter des Hradschin, Joseph Graf Wallis, zu sich und sagte ihm: »Ich will Sie, lieber Graf, für Ihre treuen Dienste belohnen. O’Donnell ist tot, Sie sollen sein Nachfolger werden.«
»Ich bitte Eure Majestät«, meinte der Verwalter, »allergnädigst bedenken zu wollen, dass ich vom Finanzwesen nichts verstehe und mich auch darum nie gekümmert habe.«
»Das macht gar nichts«, entgegnete der Kaiser, »genau solche Leute brauche ich. Sie waren ein treuer Burggraf und werden ein nicht minder treuer Finanzminister sein.«
Es folgte, was zu erwarten war: der Staatsbankrott.
Dem Kaiser blieb wenig Zeit, das Regieren zu erlernen: Gleich nach seinem Amtsantritt erklärte ihm das revolutionäre Frankreich den Krieg, in dessen Folge Österreich erhebliche Gebietsverluste erlitt. Zwei Persönlichkeiten prägten die Regierungszeit des »guten Kaisers Franz«: Metternich auf der einen und Napoleon auf der anderen Seite. Beide hatten wesentlichen Anteil am Zustandekommen des wohl wichtigsten politischen Ereignisses dieser Epoche, dem »Wiener Kongress«, zu dem ab September 1814 Monarchen und Staatsmänner sonder Zahl nach Wien reisten, um nach dem vermuteten Ende der Herrschaft Napoleons – der nach der verlorenen Schlacht bei Leipzig im Exil auf Elba saß – über eine »Neuordnung Europas« zu verhandeln.
Und zu tanzen, wie es heißt. Ja, gefeiert wurde viel, wobei der 28. Juni 1815 den festlichen Höhepunkt bildete: Der König von Dänemark hatte Geburtstag, die Königin von Bayern, der Herzog von Sachsen-Weimar und der Großherzog von Baden hatten Namenstag. Wie es das Zeremoniell vorschrieb, wurde Zar Alexander als Europas ranghöchster Monarch während des Diners neben Maria Ludovika, die Frau des österreichischen Kaisers, platziert. Leider hat man bei der Tischordnung nicht bedacht, dass sowohl Zar als auch Kaiserin auf je einem Ohr taub waren. Nun saßen die beiden unglücklicherweise so, dass sie nicht hören konnten, was ihr Gesprächspartner gerade sagte. Boshafte Wiener stellten die Konversation der Kaiserin mit dem Zaren so dar:
»Wie schmeckt’s Euer Majestät?«
»Schrecklich müde.«
»Freut mich sehr.«
Der Kongress kostete, vor allem wegen seiner vielen Feierlichkeiten, ein Vermögen, was ein geflügeltes Wort zur Folge hatte: »Der Zar von Russland liebt für alle, der König von Preußen denkt für alle, der König von Dänemark spricht für alle, der König von Bayern trinkt für alle, der König von Württemberg frisst für alle und der Kaiser von Österreich zahlt für alle.«
Aber der »Kongress« brachte auch ein politisches Ergebnis: Die Großmächte stellten ihr Gleichgewicht wieder her, mit anderen Worten: Alles war, wie es vor dem Kongress gewesen ist.
Typisch für den Eigensinn des Kaisers Franz war auch, wie er die Frage seiner Nachfolge löste: Obwohl sein Sohn Ferdinand weder über die geistigen noch über die körperlichen Fähigkeiten verfügte, das Amt eines Monarchen auszuüben, dachte Franz nicht daran, eine Änderung in der Thronfolge herbeizuführen. Dabei hatte er mehrere Kinder, die die Voraussetzungen weitaus besser erfüllt hätten. Franz beharrte aber darauf, seinen erstgeborenen Sohn Ferdinand »von Gottes Gnaden« an die Spitze des Staates zu stellen.
Als Kaiser Franz I. am 2. März 1835 starb, stand eine große Menschenmenge weinend am Burghof. Ein Beamter wurde zur Bevölkerung geschickt, um zu beruhigen. »Weint nicht«, sprach er, »es bleibt ja alles beim Alten.«
Da rief einer aus der Menge: »Deswegen weinen wir ja!«
Sein Sohn Ferdinand litt zeitlebens, als bedauernswertes Produkt der Verbindung doppelter Cousins ersten Grades, unter epileptischen Anfällen. Infolge seiner Erkrankung erhöhte sich die Allmacht des Fürsten Metternich beträchtlich. Das war wohl mit ein Grund, dass der Staatskanzler dafür sorgte, den schwachen Ferdinand so lang wie möglich auf dem Thron zu halten. Dadurch hatte Metternich die Möglichkeit, die Regierungsgeschäfte fast im Alleingang abzuwickeln. Immerhin blieb Ferdinand 13 Jahre an der Spitze des Staates, den man nun als »Monarchie ohne Kaiser« bezeichnete.
Von Wohlmeinenden »Ferdinand der Gütige« genannt, gelangten infolge seiner eingeschränkten Fähigkeiten zahllose Anekdoten in Umlauf. So wurde erzählt, dass bei einem Hauskonzert in der Hofburg der berühmte Pianist Thalberg seine Meisterschaft zeigte. Kaiser Ferdinand war hingerissen und animierte den Künstler zu etlichen Draufgaben, bis dieser schwitzend und ermattet abbrechen musste. »Mein lieber Thalberg«, bedankte sich der Kaiser, »bei mir haben schon viele Künstler gespielt, aber so wie Sie …«
»Majestät«, neigte der Meister in tiefer Dankbarkeit beschämt sein Haupt –
»… aber so wie Sie«, setzte der Kaiser fort, »hat noch keiner geschwitzt.«
Im März 1848 brach in Wien die Revolution aus. Das Elend der Massen war so groß, dass Studenten, Bürger und Arbeiter sich mit der kaiserlichen Armee heftige Straßengefechte lieferten. Noch gravierender wurde die zweite Revolution im Oktober, deren Kämpfe rund zweitausend Tote forderten und Kaiser Ferdinand I. und seinen Hofstaat zwangen, die Residenzstadt zu verlassen und in Olmütz Zuflucht zu suchen. Als »Entgegenkommen« sicherte die Regierung den Aufständischen die Aufhebung der Zensur, uneingeschränkte Pressefreiheit und eine neue Verfassung zu. Das Ende der Grundherrschaft und des Zunftzwanges und die Einführung der Gewerbefreiheit führten zu dem Schlagwort, in Österreich sei das Mittelalter erst im 19. Jahrhundert zu Ende gegangen.
Am 2. Dezember 1848 verzichtete Kaiser Ferdinand schließlich zugunsten seines Neffen Franz Joseph auf den Thron – ein Coup, den dessen Mutter Sophie eingefädelt hatte.
Die Übergabe der Regierungsgewalt in Olmütz wurde nach den strengen Vorschriften des Zeremoniells vollzogen. Zu ihnen gehört, dass der zurücktretende Kaiser die Abdankungsformel spricht. Die aber hatte Ferdinand vergessen, weshalb er zu seinem vor ihm knienden Neffen nur sagte: »Sei brav, es is gern g’schehn.«
Allerdings werden Ferdinands Fähigkeiten oft geringer dargestellt, als sie gewesen sind. Immerhin verstand er es, nach der Abdankung sein gewaltiges Vermögen durch geschickte Investition in gewinnbringende Unternehmungen erheblich zu steigern – auch wenn an diesen Transaktionen natürlich Berater beteiligt waren. Jedenfalls erwarb der Ex-Kaiser in der Zeit, als Europas Eisenbahnnetz immer dichter wurde, große Anteile an drei Eisenbahnlinien. Solange Ferdinand lebte, war der nunmehr regierende Kaiser relativ »arm«. Seinen Reichtum erlangte Franz Joseph erst, als sein Onkel und Vorgänger – der ihn zu seinem Universalerben bestimmt hatte – 1875 in seinem Exil am Prager Hradschin starb.
Ein neuer Kaiser. Franz Josephs legendäres Pflichtgefühl, seine Pedanterie und Regelmäßigkeit waren ihm schon als Kleinkind aufgezwungen worden – und diese Eigenschaften bestimmten seine Zukunft und die des Reiches. Kaum hatte der 18-Jährige den Thron bestiegen, wurde schon darüber diskutiert, ob er überhaupt imstande sein würde, die Last der Krone zu tragen. Als man dem eben zurückgetretenen Staatskanzler Metternich die Frage stellte, weshalb ein Mann seiner Meinung nach früher regierungsfähig als heiratsfähig sein könne, antwortete er: »Weil es leichter ist, ein Volk zu regieren als eine Frau!«
Die Wiener waren davon anfangs nicht ganz so überzeugt, sie tauschten ein »n« gegen ein »t« aus und nannten ihren neuen Kaiser in seinen ersten Regierungsjahren »Fratz Joseph«.
Niemand konnte damals ahnen, dass dieser Mann im Laufe einer langen Regentschaft zum Symbol der Donaumonarchie werden sollte. Sein Tagesablauf war genau eingeteilt und kannte kaum irgendwelche Abweichungen – egal, ob er in der Hofburg, in Schönbrunn oder während des Sommers in Bad Ischl residierte: Franz Joseph wurde um halb vier von seinem Kammerdiener Ketterl mit den Worten »Ich leg mich zu Füßen Eurer Majestät« geweckt. Nach dem Einseifen durch den »Badewaschel«, dem Ankleiden und der Morgenrasur setzte sich Franz Joseph an den Schreibtisch, um Akten zu erledigen. »Auf dem Schreibtisch des Kaisers«, hinterließ uns Eugen Ketterl, »musste hinter dem großen Stehkalender das kleine Bürstchen und der Abstaubwedel liegen, mit welchem er selbst während des Tages seinen Schreibtisch von Streusand und Asche reinigte.«
Um fünf Uhr nahm er das erste Frühstück ein – bestehend aus Gebäck, Butter, Schinken und Kaffee – dann rauchte er eine Zigarre. Befand er sich in Schönbrunn, verließ er das Schloss um Punkt halb sieben zu einem Spaziergang durch den Park, um danach in der benachbarten Villa der mit ihm befreundeten Schauspielerin Katharina Schratt das zweite Frühstück einzunehmen. Nach seiner Rückkehr studierte er wieder die geliebten Akten. Um zwölf wurde das Mittagessen aufgetragen, das praktisch immer aus derselben Menüfolge bestand: Suppe, Rindfleisch oder Naturschnitzel, Mehlspeise. War Franz Joseph alleine, ließ er sich die Speisen auf den Schreibtisch stellen. Interessanterweise war das Essen selten warm, was daran lag, dass die Hofküche von den kaiserlichen Appartements so weit entfernt war, dass die Speisen auf dem Weg durch Hunderte Meter lange Gänge auskühlten, ehe sie serviert wurden. Erst in den letzten Jahren seines Lebens wurde in einem Vorraum der kaiserlichen Gemächer ein Rechaud aufgestellt, mit dem das Essen aufgewärmt werden konnte.
Nachmittags beschäftigte sich der Kaiser wieder mit seinen Akten. Die unerledigten befanden sich auf der linken Seite des Schreibtischs, die erledigten auf der rechten. Um fünf nahm er eine leichte Jause zu sich, Abendessen gab’s fast nie. Kurz nach acht begab sich der Kaiser zu Bett – es sei denn, er musste ein offizielles Diner oder einen Hofball geben. Verständlich, dass dem notorischen Frühaufsteher solche Festivitäten ganz und gar nicht behagten. Eine Anekdote, die immer wieder erzählt wird, entbehrt allerdings jeglicher Grundlage: Die meisten Gäste, so heißt es, verließen die Hoftafel hungrig, um danach ins Sacher zu gehen, weil der Kaiser ein berüchtigter »Schnellesser« gewesen sei und die Tafel aufgehoben werden musste, sobald er fertig war. Das stimmt nicht, jeder Besucher konnte bei Hof satt werden, es hätte auch nicht Franz Josephs Stil entsprochen, seine Gäste hungrig zu verabschieden.
Nur seine Gemahlin Elisabeth, der jegliche Etikette verhasst war, schaffte es einigermaßen, das jahrhundertealte höfische Zeremoniell zu umgehen. Als Papst Pius IX. am 7. Februar 1878 in Rom starb, war die Kaiserin – wie so oft – gesundheitlich angeschlagen, weshalb sie es eine Woche lang vermeiden musste, ihre geliebten Ausritte zu unternehmen. Verschmitzt schrieb sie dem Kaiser: »Da ich nun einige Tage nicht reite, werden die Leute sagen, es sei wegen des Papstes. Das macht sich sehr gut.«
Letztlich konnte und wollte auch Franz Joseph als jener Regent, der das Habsburgerreich ins 20. Jahrhundert führte, die zum Teil mittelalterlichen Gesetzmäßigkeiten des Spanischen Hofzeremoniells nicht abschaffen. So war es selbst seinen Geschwistern und engsten Familienangehörigen nicht gestattet, das Wort an den Kaiser zu richten, nur ihm stand es zu, eine Frage zu stellen. Am meisten betroffen von den anachronistischen Bestimmungen des Zeremoniells war die Herzogin von Hohenberg, die »nicht ebenbürtige« Frau seines Thronfolgers Franz Ferdinand. Sie stand in ihrem Rang an letzter Stelle der Familienangehörigen – noch weit hinter der jüngsten Erzherzogin – und durfte bei Veranstaltungen niemals neben ihrem Mann auftreten. So wurde bei offiziellen Diners im Speisezimmer ihr Sessel möglichst weit weg von dem ihres Mannes aufgestellt. Wenn der Hof mit den Kutschen ausfuhr, musste die als »gewöhnliche Gräfin« geborene Sophie Chotek im letzten Wagen Platz nehmen. Sie durfte nicht einmal beim Fronleichnamsgottesdienst im Stephansdom neben Franz Ferdinand knien. Sämtliche Versuche des Erzherzogs, die Stellung seiner Frau – die sehr unter den starren Rangvorschriften litt – zu verbessern, blieben ergebnislos.
Nur einmal, ein einziges Mal nahm Sophie neben ihrem Mann Platz – ausgerechnet dieses eine Mal. Man befand sich weit weg von Wien und damit auch weit weg von den strengen Hütern des Zeremoniells. Das war an jenem 28. Juni 1914, an dem sie im Auto an der Seite des Thronfolgers durch Sarajewo fuhr. Und in dem sie von den tödlichen Kugeln des Attentäters Gavrilo Princip getroffen wurde. Von den Kugeln, die jener Monarchie galten, die sie angesichts ihrer »niedrigen Herkunft« so lange gedemütigt hatte.
Die Montag- und Donnerstagvormittage des Kaisers waren für Audienzen reserviert. Im Prinzip hatte jeder Staatsbürger mit gutem Leumund die Möglichkeit, seinen Kaiser persönlich zu sprechen. Entsprechend dicht war das Programm an den Besuchstagen: »Gestern hatte ich 127, heute werde ich 108 Audienzen geben«, schreibt Franz Joseph in einem Brief an Katharina Schratt. Insgesamt empfing er in den fast sieben Jahrzehnten seiner Regentschaft mindestens 200 000 Personen in Audienz. Während der bis zu zehn Minuten dauernden Begegnungen blieben sowohl der Kaiser als auch seine Besucher stehen. Seine Hand reichte Franz Joseph nur Ministern, Geheimen Räten und Aristokraten – Bürgerlichen nie. Dennoch bestand Handschuhpflicht für alle, die sich ihm nähern durften. Herren erschienen im Frack, Militärs in Uniform, Damen im hochgeschlossenen Kleid mit Hut. Für Arme und Mittellose gab es keine Toilettenvorschriften.
Bei Betreten des Raumes mussten die Damen in den großen Hofknicks versinken, die Herren in eine tiefe Verbeugung. Erheben durften sie sich erst auf Aufforderung des Kaisers. Der stand an seinem Pult und las dem Besucher den Grund seines Begehrs vor (als ob er den nicht selbst gekannt hätte) und teilte ihm das Ergebnis der Angelegenheit mit. Der Besucher sprach seinen Dank aus und bewegte sich – in nach rückwärts gerichteten Schritten und unter ständigen Verbeugungen – wieder dem Ausgang zu.
Entscheidend für die Geschichtsschreibung ist jedoch, was von den 68 Regierungsjahren Kaiser Franz Josephs blieb. Im Guten wie im Schlechten.
•Wien und viele andere Städte der ehemaligen Donaumonarchie verdanken den von Kaiser Franz Joseph eingeleiteten Städteplanungen ihr heutiges Erscheinungsbild. Er hat das Kaiserreich aus dem Biedermeier geführt, jeder Bahnhof, jedes Theatergebäude, jedes Amtshaus ist von seiner Zeit geprägt.
•Auch wenn er selbst kaum daran Anteil nahm, kam es während seiner Regentschaft zu einem Aufbruch des Geistes- und Kulturlebens in Österreich. Die franzisko-josephinische Ära war die Zeit von Freud, Schnitzler, Karl Kraus, Gustav Mahler, Klimt und Schiele.
•Franz Joseph hat durch die notwendigen Schritte der Industrialisierung entscheidend zur Modernisierung der Donaumonarchie beigetragen und damit ihren wirtschaftlichen Aufschwung ermöglicht.
Demgegenüber stehen folgenschwere Fehler:
•Während der Kaiser die Demokratisierung seines Reichs nur bedingt zuließ, waren andere Staaten viel weiter, übertrugen ihren Parlamenten größere Vollmachten. Die ersten freien Wahlen gab es in Österreich erst 1907; Frauen durften, solange es die Monarchie gab, überhaupt nicht wählen. Großbritannien zeigte sich wesentlich liberaler – und konnte auf diese Weise seinen imperialen Glanz bewahren.
•Die drückende Armut konnte trotz des wirtschaftlichen Aufschwungs nicht besiegt werden.
•Franz Joseph fand keine Lösung für die überbordenden Nationalitätenkonflikte, die letztlich zum Untergang des Kaiserreichs führten.
•Auch als Oberstem Kriegsherrn war ihm wenig Glück beschieden, verlor er doch die wesentlichen Schlachten seiner Regentschaft. Als man den zurückgetretenen Kaiser Ferdinand in Prag von den österreichischen Niederlagen in der Lombardei und in Königgrätz informierte, brummte er: »Also, des hätt i aa no z’sammbracht!«
Die folgenschwerste Unterschrift seines Lebens setzte Kaiser Franz Joseph am 28. Juli 1914 unter die Kriegserklärung an Serbien, die den Ersten Weltkrieg auslöste und das 20. Jahrhundert ins Verderben stürzte.
Zu den Widersprüchen in seiner Biografie zählt, dass Franz Joseph einerseits als Integrationsfigur gesehen wird, die das schwankende Reich zusammenhielt, andererseits aber auch als Totengräber der Monarchie. »Beides ist richtig«, meint der Historiker Gerhard Jagschitz, »die Integration ist das Ergebnis seiner langen Regentschaft und zum Untergang führte seine Starrheit, die moderne Entwicklungen vielfach nicht zuließ.«
Wenn an der persönlichen Redlichkeit des »alten Kaisers« auch lange nach seinem Tod kaum Zweifel bestehen und ihm immer noch ein hohes Maß an Sympathie entgegengebracht wird, dann hat das sicher auch mit der Anteilnahme an seinem persönlichen Schicksal – der Hinrichtung seines Bruders Maximilian von Mexiko, dem tragischen Tod seines Sohnes Rudolf, der Ermordung seiner Ehefrau Elisabeth und seines Thronfolgers Franz Ferdinand – zu tun.
Zu seinen Lebzeiten war Franz Joseph übrigens wesentlich beliebter als »Sisi«, da er als Herrscherpersönlichkeit alles überstrahlte, während die Bevölkerung für das Luxusleben seiner Frau wenig Verständnis zeigte.
Seiner großen Popularität entsprechend, ranken sich zahllose Episoden um die Figur des alten Kaisers. Die schönste vielleicht erzählt vom täglichen Besuch, den der Monarch frühmorgens von seinem Leibarzt Dr. Kerzl empfing. Die beiden Herren plauderten immer in angeregter Atmosphäre miteinander, meist über ganz harmlose Themen, da sich der Kaiser in den 86 Jahren seines Lebens bester Gesundheit erfreute. Nebenbei und pro forma fragte der Mediziner im Zuge seiner Visiten irgendwann nach dem Allerhöchsten Befinden. Als Dr. Kerzl eines Vormittags aber wie immer zum Kaiser wollte, wurde er von Kammerdiener Eugen Ketterl mit den Worten zurückgehalten: »Majestät bedauern lebhaft, den Herrn Doktor heute nicht empfangen zu können. Majestät fühlen sich nicht ganz wohl und bitten erst morgen wieder zu ihm zu kommen.«
In den letzten Oktobertagen des Jahres 1916 trat beim Kaiser ein hartnäckiger Bronchialkatarrh auf, der von heftigen Fieberanfällen begleitet wurde. Außerdem konstatierte Hofarzt Kerzl eine bedenkliche Appetitlosigkeit. Mitte November sprach sich Franz Josephs schlechter Gesundheitszustand in Wien herum. Trotz des deutlichen Kräfteverfalls hielt der Monarch seinen seit fast sieben Jahrzehnten gewohnten Lebensrhythmus weiterhin bei. Er stand in aller Früh auf, unterzeichnete Akten, empfing Minister und Abordnungen. »Am Montag, den 20. November, nach einer sehr schlechten, schlaflosen Nacht, in der ihn ein krampfhafter Husten sehr gequält hatte«, notierte Flügeladjutant Albert von Margutti, »saß der Monarch wieder an seinem Schreibtisch, doch die Nacht hatte ihm so übel mitgespielt, dass er kaum atmen konnte und von dem immer noch steigenden Fieber förmlich geschüttelt wurde. Da verlangte er das Heilige Abendmahl.«
Am selben Tag reiste die engere Familie des Kaisers an. Tags darauf saß er wieder an seinem Schreibtisch, obwohl er sich kaum noch aufrecht halten konnte. »Als Seine Majestät dann endlich zu Bett gebracht war«, hinterließ der Kammerdiener Ketterl, »fragte ich ihn um weitere Befehle. Laut und bestimmt sagte er zu mir: ›Ich bin mit der Arbeit nicht fertig geworden, morgen um halb vier Uhr wecken Sie mich wie gewöhnlich.‹«
Fünf Minuten vor 21 Uhr am Abend des 21. November 1916 stellten die Ärzte das Ableben Kaiser Franz Joseph I. fest.
Die Einsegnung des Leichnams fand im Stephansdom statt. Menschen aus allen Teilen der Monarchie strömten nach Wien, um von jenem Mann Abschied zu nehmen, der die Geschicke des Vielvölkerstaates länger als jeder andere gelenkt hatte.
Viele Menschen spürten, dass mit dem Tod des alten Kaisers auch die letzte Stunde für Österreich-Ungarn geschlagen hatte. Franz Joseph verkörperte in seiner 68-jährigen Amtszeit* eine Mischung aus imperialem Glanz und Volkstümlichkeit. Die Bewohner der Monarchie hatten als Kinder sein Bild in der Schule gesehen, sie waren damit erwachsen geworden, und als sie starben, war er immer noch da. Franz Joseph hatte in seiner Regentschaft drei deutsche Kaiser, vier russische Zaren, zwölf französische Staatsoberhäupter und achtzehn amerikanische Präsidenten erlebt.
Eine Monarchie ohne ihn war jenseits jeder Vorstellungskraft. Folgerichtig wurde die Regentschaft seines Neffen und Nachfolgers Kaiser Karl zum Zwischenspiel, das durch die Kriegssituation keine Aussicht auf ein Weiterleben hatte. Und so verzichtete dieser am 11. November 1918 »auf jeden Anteil an den Staatsgeschäften« und reiste mit seiner Familie über Schloss Eckartsau und die Schweiz nach Madeira.
24 Stunden später erfolgte die Ausrufung der Republik. Es dauerte aber noch lange, bis die Menschen die ganze Tragweite des Geschehenen erkennen konnten: Aus einem Reich, in dem zuletzt 52 Millionen Bürger gelebt hatten, war ein Kleinstaat mit sechs Millionen geworden, der fast neunzig Prozent des Territoriums verloren hatte.
Karl Kraus rechnete mit der Monarchie ab, als er den Text der alten Kaiserhymne veränderte: »Gott erhalte, Gott beschütze, vor dem Kaiser unser Land …«
* Nur Frankreichs »Sonnenkönig« Ludwig XIV. (1638–1715) herrschte mit 72 Regierungsjahren länger als Kaiser Franz Joseph.