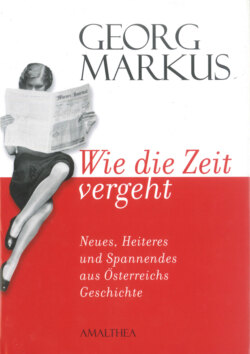Читать книгу Wie die Zeit vergeht - Georg Markus - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
CHIFFRE »GLÜCKSFAHRT« Große Kriminalfälle
ОглавлениеDass unsere Straßen beleuchtet sind, verdanken wir ursprünglich Raubmördern, Dieben und anderen lichtscheuen Elementen, die nachts durch Wien zogen und arglose Passanten überfielen. Als die Behörden erkannten, dass beleuchtete Gehwege die Kriminalität vermindern, stellte man in der Dorotheergasse probeweise 17 ölbetriebene Kandelaber auf. Da die Überfälle zurückgingen, wurden ab 1688 innerhalb der Stadtmauern rund zweitausend solcher Leuchten platziert. Keiner hätte es gewagt, eine davon zu stehlen oder zu beschädigen, war doch mittels kaiserlichem Erlass die Drohung ergangen: »Wer die auf vielen Orten aufgerichteten Laternen in boshafter Weise destruieret, sei er auch wer er wolle, dem werde die rechte Hand abgehackt.« Ab 1841 wurden die Innere Stadt und die Hauptstraßen der Vorstädte mit Gasbeleuchtung versorgt.
Während in der Antike durch das Römische Recht eine relativ fortschrittliche Gerichtsbarkeit gewährleistet war, ließen die Babenberger oft durch »Gottesurteil« entscheiden, ob ein Mensch schuldig zu sprechen wäre oder nicht. So musste der Verdächtige aus einem Kessel, in dem sich siedend heißes Wasser befand, mit der bloßen Hand einen Gegenstand herausholen. Der Rechtsspruch erging dann je nach Zustand der Brandwunden. Bei der »Eisenprobe« musste der Angeklagte über glühende Metallstücke laufen. Blieb er unverletzt, war seine Unschuld erwiesen. Bei der »Wasserprobe« legte man den Delinquenten mit gebundenen Händen ins Wasser. Wenn er ertrank, war er schuldig.
Zur Mitte des 14. Jahrhunderts wurde in Wien eine »Bürgerwehr«, später »Polizey« genannt, gegründet. Sie setzte sich aus einer Anzahl von Handwerksmeistern und -gesellen zusammen und war dem Stadtrichter bei der Festnahme »strafmäßiger Verbrecher« behilflich. Bald gab es eine hauptberuflich amtierende Tag- und Nachtwache, und unter Maria Theresia erhielt jedes Stadtviertel einen Kommissar, dem »Gassenkommissare« und »Hausnachseher« unterstellt waren.
Kaiser Josef bemühte sich um ein menschenwürdiges Rechtssystem. Als man ihm zutrug, dass sich in der Festung Spielberg in Brünn das inhumanste Gefängnis der Monarchie befände, wollte er sich persönlich ein Bild von den Zuständen machen. Die Insassen vegetierten in acht Grad kalten Zellen, in denen sich Wasserlachen stauten und ein bestialischer Modergeruch verbreitete. Die lebenslange Haft dauerte hier im Schnitt nur ein halbes Jahr, danach verfielen die Gefangenen dem Wahnsinn oder sie starben.
Der Kaiser fuhr nach Brünn und meldete sich beim verblüfften Festungskommandanten Herter, dem er den Befehl erteilte: »Schließen Sie mich ein und holen Sie mich nach einer Stunde wieder raus!«
»Aber Majestät können doch nicht …«
»Nach einer Stunde, keine Minute früher!«
Die Tür fiel ins Schloss und wurde nach sechzig Minuten wieder geöffnet. Der Kaiser trat aus der Zelle, blass, hustend, mit feuchter Uniform. Er versammelte das Offizierskorps um sich und entschied: »Ich war der letzte Mensch in diesen Räumen.«
Der Kerker im Tiefgeschoss wurde noch am selben Tag für immer geschlossen.
Josef II. fand auch eine neue Form, Kriminelle in das Arbeitsleben zu integrieren. Auf dem Weg in das von ihm bewohnte Augartenpalais war ihm aufgefallen, dass die Jägerzeile* an ihrem Ende in ein schmutziges Rinnsal, den Fugbach, überging. Der Kaiser befahl dessen Sanierung: »Da der Fugbach stinkt und für die in der Jägerzeile Wohnenden höchst ungesund sein muss, ist er ehestens zuzuschütten. Dazu sollen die im Zuchthaus müßig einsitzenden stärksten Männer mit Nutzen verwendet werden.«
Im Herbst 1808 betrat ein junger Mann das Vernehmungszimmer der Kriminalabteilung der Stadt Wien und erklärte den anwesenden Beamten: »Mein Name ist Grillparzer, ich hab einen Handwerksburschen im Wald erschlagen.« Der des Mordes Verdächtigte wurde festgenommen und ins Gefangenenhaus gebracht.
Bei besagtem Herrn Grillparzer handelte es sich natürlich nicht um Österreichs Nationaldichter. Sondern um dessen Bruder Karl, der bereits mehrmals mit dem Gesetz in Konflikt geraten war, zum ersten Mal, als er aus der kaiserlichen Armee desertierte und nur durch große Mühen seines Bruders – der eben seine ersten schriftstellerischen Gehversuche unternahm – gerettet werden konnte. Karl setzte sich nach Frankreich ab und kehrte nach fünf Jahren heim, um hier neuerlich von Franz unterstützt und aus manch misslicher Lage gerettet zu werden. Bald als Geldbote in Großgmain bei Salzburg angestellt, fehlten eines Tages aus der Amtskasse 41 Gulden. Wieder war es Sache seines dichtenden Bruders, dem um ein Jahr Jüngeren zu helfen und durch Hinterlegung einer Kaution den Schaden wiedergutzumachen.
Karl Grillparzer versteckte sich nach diesem Vorfall eine Zeitlang in Wien, wo es zu dem oben geschilderten »Mordgeständnis« bei der Polizei kam. Der Fall konnte nie geklärt werden – schon weil man an dem von Karl angegebenen »Tatort« keine Leiche fand. Franz Grillparzer musste einmal mehr für seinen Bruder geradestehen, diesmal mit einer Eingabe an das Kriminalgericht Wien, in der er erklärte, dass Karl »den Mord, dessen er sich anklagte, nicht begangen« hätte. Grillparzer gab an, dass sein Bruder als Kind eine Gehirnerschütterung erlitten hätte. Er wurde freigelassen, heiratete und hatte mehrere Kinder, die ebenfalls von seinem berühmten Bruder unterstützt wurden. Es gibt Vermutungen, dass Karls »Geständnis« ein Selbstmordversuch war: Hätte man ihm den Mord geglaubt, wäre er mit großer Wahrscheinlichkeit zum Tod verurteilt worden.
In der Zeit des Vormärz war der wegen seiner brutalen Maßnahmen zur Aufrechterhaltung von Recht und Ordnung gefürchtete Graf Josef Sedlnitzky Polizeipräsident von Wien, dessen Name bis heute ein Synonym für Unterdrückung ist. Jede Art der Auflehnung, ja der Diskussion konnte lebensgefährlich sein, und es gab nur einen, der den Mut hatte, den mitleidlosen Mann ins Lächerliche zu ziehen: den Wiener Dichter Ignaz Castelli, der seine Hunde Sedl und Nitzky nannte. Wann immer er bei einem Spaziergang Polizeiorganen begegnete, rief er ihnen laut und deutlich und in dieser Reihenfolge zu: »Sedl! Nitzky!«
Dagegen waren selbst die strengsten Ordnungshüter machtlos. In die Amtszeit des Polizeipräsidenten Sedlnitzky fiel ein Kriminalfall, dessen Bearbeitung sehr delikat war, spielte er doch in den allerhöchsten Kreisen. Man schrieb den 6. Juli 1822, als Fürst Alois Kaunitz in seinem Palais in der Dorotheergasse festgenommen wurde. Vor Gericht stellte sich heraus, dass der Enkel des einstigen Staatskanzlers Wenzel Kaunitz nicht weniger als zweihundert unmündige Mädchen missbraucht und geschändet hatte.
Im Theater an der Wien gab es ein Kinderballett, das in jenen Tagen von abartig veranlagten Herren aufgesucht wurde, allen voran: Alois Kaunitz, einst österreichischer Botschafter am Hof des Papstes, ehe er 1819 als »untragbar« vom Dienst suspendiert und in die Heimat rückbeordert wurde. Hier begannen die Ballettbesuche des dreifachen Familienvaters im Theater an der Wien.
Der Prozess gegen den Fürsten Kaunitz wurde lange hinausgezögert, da es im höchsten Staatsinteresse war, Mitglieder des Hochadels zu schonen. Als aber die krankhaften Leidenschaften des 49-Jährigen in Wien die Runde machten, erwies sich das Einschreiten der Behörde als unumgänglich. Kaunitz war meist an die Mütter und Väter der elf- bis vierzehnjährigen Kinder herangetreten, um mit ihnen einen regelrechten Vertrag abzuschließen, in dem er sich verpflichtete »für die Jungfernschaft Ihrer Tochter« eine bestimmte Summe zu zahlen. Die Armut im biedermeierlichen Wien war so groß, dass dieses schmutzige Geschäft mit dem Wissen der Eltern blühen konnte.
Auch später berühmt gewordene Namen finden sich in den Listen der Opfer. Zwar soll Kaunitz die Tänzerin Fanny Elßler, damals elfjährige Elevin am Kärntnertortheater, »nur geküsst« haben, ihre 14-jährige Schwester Therese wurde von ihm jedoch »fleischlich gebraucht«. Auch mit den Eltern der elfjährigen Louise Gleich – der späteren Frau Ferdinand Raimunds – hatte Kaunitz eine Vereinbarung getroffen, die jedoch nicht wirksam wurde, da sich die Mutter in letzter Minute weigerte, ihre Tochter zur Erfüllung des »Vertrags« freizugeben.
Der Kaunitz-Prozess wurde zur Farce. Der Fürst gab an, die Mädchen »vor dem 14. Lebensjahre berührt, aber nicht gebraucht« zu haben. Dies wurde trotz gegenteiliger Aussagen sämtlicher Betroffenen vom Gericht akzeptiert, weil die Stellungnahme eines Aristokraten mehr zählte als die der einfachen Kinder.
Schließlich wurde die Untersuchung aus Mangel an Beweisen, »unter der Bedingung, dass Kaunitz die Stadt Wien auf schnellstem Wege verlasse«, ad acta gelegt. Er begab sich auf sein Landgut bei Brünn, um dort sein Unwesen fortzuführen, wie einem örtlichen Polizeibericht aus dem Jahre 1823 zu entnehmen ist: »Eine im Kaunitzschen Dienste gestandene frühere Magd ist in Untersuchung, da sie dem Fürsten Mädchen, die Jungfrauen sein mussten, zugeführt hatte …«
Alois Kaunitz hingegen starb 1848 im Alter von 75 Jahren in Paris als unbescholtener Mann.
Therese Krones war die beliebteste Schauspielerin Wiens. Doch just als sie in der Rolle der Jugend in Ferdinand Raimunds »Der Bauer als Millionär« ihren größten Erfolg feierte, geriet sie in das Umfeld eines Kriminalfalls, der ihr Leben zerstörte.
Die Tragödie der 25-jährigen Volksschauspielerin begann im Herbst 1826, als sie am Graben von einem elegant gekleideten Herrn angesprochen wurde. Der Fremde gab sich als Verehrer ihrer Schauspielkunst aus und bat, sie besuchen zu dürfen.
Zwei Tage später klopft der Mann an ihre Wohnungstür und überreicht dem Dienstmädchen seine Visitenkarte, auf der in gestochenen Lettern »Le Comte Severin Jaroszynski« steht. Therese Krones lässt bitten, der Graf tritt ein und beginnt mit polnischem Akzent seine Lebensgeschichte zu erzählen: Aus altem Adel stammend, sei er in Galizien durch Erbschaft in den Besitz riesiger Ländereien gelangt, die große Einkünfte abwarfen und ihm ein sorgenfreies Leben erlaubten. Des Landlebens leid geworden, sei er nach Wien übersiedelt, was er noch keinen Tag bereute, vor allem seit er die Krones auf der Bühne gesehen und in sein Herz geschlossen hätte.
Die Schauspielerin schmolz dahin. Da saß ein offensichtlich steinreicher Aristokrat und zeigte sein ernsthaftes Interesse für eine aus kleinen Verhältnissen stammende Soubrette, das war schon etwas Besonderes.
Severin schien es ernst zu meinen, und so dauerte es nicht lange, bis Therese dem Charme des Edelmannes erlag. Die Affäre wurde zum Stadtgespräch, der verliebte Aristokrat gab für die Krones ausschweifende Gelage, bei denen der Champagner in Strömen floss.
Doch dann geschah Unglaubliches. Am 13. Februar 1827 wurde der siebzigjährige Priester Johann Konrad Blank in seiner Wohnung an der Ecke Seilerstätte zur Annagasse von Schülern tot aufgefunden. Ein Unbekannter hatte sein wehrloses Opfer mit mehreren Messerstichen getötet und Obligationen im Wert von 60 000 Gulden geraubt. Jaroszynski sprach mit der Krones darüber und zeigte seine Erschütterung.
Drei Tage später gibt der Graf in seiner Wohnung im Trattnerhof eine große Gesellschaft. Gerade als die Krones ihr berühmtes Lied »Brüderlein fein« anstimmt, stürmen Polizeibeamte durch die Tür, von denen einer losschreit: »Severin von Jaroszynski, Sie werden als Mörder von Professor Blank erkannt und verhaftet!«
Die Gäste glauben ihren Augen und Ohren nicht zu trauen, Therese Krones muss fassungslos mit ansehen, wie der geliebte Mann in Ketten gelegt und abgeführt wird. Der Presse ist zu entnehmen, dass der Täter nach dem Mord versucht hätte, Wertpapiere seines Opfers beim Geldmakler Wedel am Graben zu verkaufen, der sofort Anzeige erstattete.
Jaroszynski stammte aus adligem, nicht jedoch aus gräflichem Hause. Er war mit einer Polin verheiratet, die ihm drei Kinder und ein großes Vermögen geschenkt hatte, das durch seine Verschwendungssucht und Spielleidenschaft verloren ging. Als man ihm in seiner Heimat die Veruntreuung von Staatsgeldern nachwies, flüchtete er nach Wien, wo er Affären mit mehreren Frauen hatte. Die Krones war nur eine von ihnen.
Als er dem Abbé Blank, der einst sein Lehrer war, einen Besuch abstattete, kam er auf die Idee, ihn zu töten und mehrere in der Wohnung frei herumliegende Aktien an sich zu nehmen. Mit dem Raubmord glaubte Jaroszynski seinen aufwändigen Lebensstil finanzieren zu können.
Die Geschichte von der schönen Schauspielerin und dem Mörder füllte die Zeitungsseiten. Und das Publikum war empört, als die Krones einige Tage später im Leopoldstädter Theater ihren nächsten Auftritt im »Bauer als Millionär« absolvierte. Bisher immer mit Applaus bedacht, brach jetzt lautstarker Tumult aus. Therese Krones stand im Kostüm der Jugend unter Buhrufen und lautem Getrampel wie gelähmt da, ehe sie sich Hilfe suchend dem als Fortunatus Wurzel neben ihr stehenden Ferdinand Raimund zuwandte. Doch die Situation war nicht zu retten, die Schauspielerin verlor das Bewusstsein, und die Vorstellung musste abgebrochen werden.
In den folgenden Tagen wurde der seelisch und körperlich niedergeschlagenen Künstlerin zugetragen, dass viele Wiener ihr die Schuld an dem Verbrechen gaben. Die grenzenlose Eitelkeit der Krones hätte den verliebten Mann zur Erfüllung ihrer unverschämten Wünsche nach Schmuck und teuren Kleidern verführt, weshalb er sich in Schulden gestürzt und keinen anderen Ausweg gesehen hätte, als den Raubmord zu begehen. Mehr noch, viele Menschen sahen die Krones als Mitwisserin oder gar Anstifterin zur Tat.
Auch wenn sich derlei Anschuldigungen als haltlos erwiesen, änderte das nichts daran, dass das Renommee und die Popularität der Künstlerin dahin waren.
Severin von Jaroszynski gestand die Tat, er wurde zum Tod verurteilt und hingerichtet.
Die ahnungslose Diva zog sich vom Theater zurück, sie starb am 26. Dezember 1830 im Gasthaus »Zur Weintraube« auf der Praterstraße im Alter von 29 Jahren an den Folgen einer Blinddarmentzündung – vier Jahre nach der Tat, die ihr Leben zerstörte.
Als Folge der Revolution des Jahres 1848 musste der gefürchtete Polizeipräsident zurücktreten, was von der Bevölkerung Wiens mit großer Erleichterung aufgenommen wurde. Nach Auflösung der von Sedlnitzky gegründeten Militärpolizei war eine Zeitlang die Städtische Wache für die Sicherheit der Bevölkerung verantwortlich, es dauerte aber nicht lange, bis Kaiser Franz Joseph wieder eine »Militärpolizeiwache« ins Leben rief.
1870 wurde die Wiener Kriminalpolizei gegründet – doch ein geradezu unglaublicher Betrugsfall aus der näheren Umgebung des Kaisers ist dieser nie zu Ohren gekommen: Dem für Wirtschaftsfragen bei Hof zuständigen Hofrat Franz Wetschl war 1896 nach Durchsicht der Auftragsbücher aufgefallen, dass die für die aufwendigen Hoffeste angeschafften Delikatessen, darunter Hummer, Lachs, Kaviar und Champagner, in immer kleineren Mengen einlangten, ohne dass sich der Preis vermindert hätte. Hofrat Wetschl ging der Sache nach und konnte unter Beiziehung mehrerer Privatdetektive einen Ring von Betrügern ausforschen, der sich in die kaiserliche Küche eingeschlichen hatte. Wie sich im Zuge der Überprüfung herausstellte, hatte der Chefkoch des Kaisers seit Jahren Lebensmittel in großen Mengen »abgezweigt« und unter der Hand an Restaurants weiterverkauft. Neben dem Chefkoch gab es in der Hofküche eine Reihe von Mitwissern, die von den Unregelmäßigkeiten informiert waren.
Da die Affäre für den Hof äußerst peinlich war, achtete man darauf, nichts nach außen dringen zu lassen. Weder wurde die Kriminalpolizei eingeschaltet, noch der Haupttäter oder seine Mitwisser entlassen. Der betrügerische Chefkoch, der durch den illegalen Lebensmittelhandel ein kleines Vermögen angehäuft hatte, wurde in allen Ehren in Pension geschickt, die durch Schweigegeld abgefundenen Komplizen an andere Hofstellen versetzt.
Doch der Korruptionsfall vor den Augen des Kaisers hatte ein tragisches Nachspiel: Der für die Verwaltung der Hofküche zuständige – in der Sache selbst unschuldige – Oberstküchenmeister Heinrich Graf Wolkenstein wurde, da man ihm nach Auffliegen des Falles massive Führungsschwäche vorwarf, mit einem anderen Aufgabengebiet innerhalb des kaiserlichen Haushalts bedacht. Wenige Wochen danach nahm sich Wolkenstein das Leben, er hatte die Schande, dass Derartiges in seinem Verantwortungsbereich passieren konnte, nicht verkraftet. Der Kriminalfall wurde nach mehr als hundert Jahren (!) durch die Historikerin Martina Winkelhofer aufgedeckt, als sie die alten Bestände des Hofwirtschaftsamtes durchforstete.
Auch Kaiser Franz Joseph inspizierte hin und wieder einzelne Gefängnisse seines Reichs. Einmal war der als »rasender Reporter« berühmt gewordene Journalist Egon Erwin Kisch als Berichterstatter dabei, als der Monarch eine Haftanstalt besuchte. Franz Joseph trat, berichtete Kisch, auf einen Häftling zu und fragte ihn: »Wie lange muss er sitzen?«
»Lebenslang, Majestät!«
Der Kaiser wandte sich an den Gefängnisdirektor: »Dem Mann ist die Hälfte der Strafe zu erlassen.«
Als Franz Joseph gegangen war, begann man zu überlegen, wie einem »Lebenslänglichen« die Hälfte der Strafe nachzulassen sei.
»Das ist ganz einfach«, riet Kisch, »einen Tag sitzen, einen Tag frei, einen Tag sitzen, einen Tag frei …«
Der Name Maria Veith ist durch ein Bühnenstück zu literarischen Ehren gelangt, doch ihr wahres Schicksal, ihre Tragödie, findet sich in den Akten der Polizeidirektion Wien.
Die »Komtesse Mizzi« galt zur Jahrhundertwende als Liebling der Männerwelt. Adel und Politik waren hingerissen von dem Wiener Mädel, das man in den Ronacher-Séparées, im Prater-Vergnügungs-Etablissement »Venedig in Wien« sowie auf Bällen und Redouten antreffen konnte. Mizzis eleganter Papa Marcel Graf Veith war meist in finanziellen Schwierigkeiten, doch konnte man mit einer noblen Zuwendung dessen Gunst – und damit die seiner Tochter – erkaufen.
Schönheit, Charme und erotische Freizügigkeit der Komtesse sprachen sich bei prominenten Freiern herum. Jeder wusste davon, doch niemand unternahm etwas dagegen. Bis zu jenem 13. November 1907, an dem in der k. u. k. Polizeidirektion Wien eine anonyme Anzeige gegen den angeblichen Grafen wegen Kuppelei eintraf. Obwohl Mizzis zügelloses Verhalten ohnehin stadtbekannt war, schritt nun die Exekutive ein. Marcel Veith wurde verhaftet, vorerst nur wegen unerlaubten Führens des Grafentitels. Bei einer Hausdurchsuchung fand man aber auch Material, das einen Verstoß gegen den Kuppelei-Paragraphen bestätigte. Veith hatte seine Tochter ab ihrem fünfzehnten Lebensjahr an zahlende Kunden vermittelt.
Während der Vater hinter Gittern saß, begann das nächste Kapitel in Mizzis Tragödie. Ihre einflussreichen Liebhaber blieben aus, da sie fürchteten, in den Skandal verwickelt zu werden. Sie fand keine Freier mehr und verarmte. Eines Tages zog man ihre Leiche aus dem Donaukanal. Mizzi Veith hatte sich ertränkt.
Das Gericht hatte, ehe der Prozess gegen ihren Vater eröffnet wurde, Mizzis Tagebuch entdeckt, in dem die Namen ihrer prominenten Kunden samt pikanter Details aufgelistet waren. Es kam zu Scheidungen, Karrieren gingen zu Ende, Ehemänner waren plötzlich treu, weil sie ähnliche Skandale fürchteten. Marcel Veith wurde zu einem Jahr Kerker verurteilt.
Arthur Schnitzler bewegte das Schicksal der »Komtesse Mizzi« so sehr, dass er es 1909 zu dem gleichnamigen Theaterstück verarbeitete.
Nach dem Zusammenbruch der Monarchie übernahm die Republik die bisherige k. u. k. Polizeiorganisation und baute sie zu einem Exekutivapparat auf, der weltweite Anerkennung fand – eine Reihe von Beamten wurde sogar nach Chicago geholt, wo sie die Ausbildung amerikanischer Nachwuchskräfte unterstützten. Wiens Polizisten erhielten den Spitznamen »Mistelbacher« – nicht, weil so viele von ihnen aus der niederösterreichischen Bezirksstadt stammten, sondern weil die Wiener Polizeidirektion in Mistelbach ein Erholungsheim für ihre Beamten errichtet hatte. 1923 gründete Polizeipräsident Schober die Interpol mit Sitz in Wien, der bald 34 Länder beitraten. Vier Jahre später zeichnete derselbe Johann Schober allerdings für die blutige Niederschlagung der Julirevolte 1927, nach dem Brand des Justizpalasts, verantwortlich.
Zu den spektakulärsten Kriminalfällen der Ersten Republik zählt der des »Eisenbahnattentäters« Sylvester Matuschka, der innerhalb kürzester Zeit mehrere rätselhafte Zugentgleisungen verursacht hatte. Vorerst wurden an der Westbahnstrecke bei Maria Anzbach zweimal hintereinander die Gleisanlagen mutwillig beschädigt – jedes Mal mit der Absicht, den heranrollenden Zug in ein tiefes Tal stürzen zu lassen. Gingen diese beiden Attentate wie durch ein Wunder glimpflich aus, so wurde kurze Zeit später in der Nähe von Berlin eine Zugsgarnitur durch eine Bombe in die Luft gesprengt, wobei mehr als hundert verletzte Passagiere zu beklagen waren. Bahn- und Polizeiermittler fahndeten nun fieberhaft nach dem unbekannten »Eisenbahnattentäter«, ohne das schwerste Unglück dieser Serie verhindern zu können: Am 13. September 1931 wurde der Nachtschnellzug Budapest–Wien auf einer Brücke nahe der Stadt Biatorbágy in die Luft gesprengt und in eine tiefe Schlucht gerissen. 24 Passagiere waren tot, Hunderte schwer verletzt.
Ein Mann meldete sich bei den ungarischen Staatsbahnen und gab an, als Passagier in einem der Waggons gesessen und durch das Unglück verletzt worden zu sein, wofür er nun Schmerzensgeld verlangte. Der Mann hieß Sylvester Matuschka und lebte als Wein- und Realitätenhändler in Wien. Da seine Schadensmeldung unglaubwürdig erschien, wurde er in das Wiener Sicherheitsbüro geladen, wo sich in wochenlangen Verhören herausstellte, dass er nicht in der Eisenbahngarnitur gesessen war, sondern nahe der Brücke auf das Kommen des D-Zuges gewartet hatte. Bald konnten die Kriminalbeamten den Nachweis erbringen, dass Matuschka in Wien zehn Kilogramm Sprengstoff gekauft hatte – mit der Begründung, Reparaturarbeiten an seinem Haus durchführen zu müssen. Matuschka wurde für seine in Österreich begangenen Verbrechen zu sechs Jahren schweren Kerkers verurteilt und nach Verbüßung dieser Strafe an Ungarn ausgeliefert, wo ihn für das Attentat bei Biatorbágy die Todesstrafe erwartete, die jedoch nicht vollstreckt wurde.
Mit einem Versicherungsbetrug begann auch die Kriminalgeschichte des Ehepaares Emil und Martha Marek: Der 24-jährige Kaufmann aus Mödling bei Wien stand im Frühjahr 1927 wegen des Verdachts, sich selbst das linke Bein abgehackt zu haben, vor Gericht. Er und seine Frau hatten von der »Anglo-Danubian-Lloyd« wegen eines »Arbeitsunfalls« 400 000 Schilling zu kassieren versucht. Nicht nur, dass die Polizze erst einen Tag vor dem Unfall in Kraft getreten war, ergab die gerichtsmedizinische Untersuchung des Stumpfes, dass das Bein durch vier Axthiebe abgetrennt wurde. Laut Anklage handelte es sich um Selbstverstümmelung Emil Mareks unter Beihilfe seiner Frau Martha.
Dennoch wurde das Paar mangels Beweisen freigesprochen. Mit der Versicherung einigte man sich auf einen Kompromiss: Emil Marek wurden 180 000 Schilling zugesprochen und ausgezahlt.
Der Prozess war freilich nur das Vorspiel zur eigentlichen »Karriere« der Martha Marek.
Ihr Mann starb fünf Jahre nach der Amputation des Beines.
Bald folgte ihm die einjährige Tochter Ingeborg ins Grab.
Wie Martha Marek später gestand, hatte sie Mann und Kind getötet, »um ein freies Leben führen zu können«.
Diese »Freiheit« nützte sie zu weiteren Giftmorden. Das nächste Opfer war ihre Tante Susanne Löwenstein. Kurz nachdem diese ihr Testament »zugunsten der bedauernswerten Witwe Martha Marek« verändert hatte, starb Frau Löwenstein unter mysteriösen Umständen.
Als das von der Tante geerbte Vermögen aufgebraucht war, nahm Frau Marek eine Untermieterin namens Theresia Kittenberger auf, die sich kurz nach dem Einzug in Mareks Wohnung bereitfand, eine Lebensversicherung in Höhe von 5000 Schilling zugunsten der Vermieterin abzuschließen.
Damit hatte auch sie ihr Todesurteil unterschrieben. Theresia Kittenberger starb kurze Zeit später. Der Fall wurde gelöst, weil ihrem Sohn der plötzliche Tod seiner Mutter aufklärungsbedürftig schien und er seinen Verdacht der Polizei meldete. Bei der nun folgenden Untersuchung kam Schreckliches ans Licht: Martha Marek hatte sowohl ihren Mann als auch ihre Tochter, ihre Tante und die Untermieterin, in allen Fällen durch das Rattengift »Zelio-Paste«, ermordet.
Martha Marek wurde im Jänner 1938 wegen vierfachen Mordes zum Tod verurteilt. Da in Österreich seit 1900 keine Frau mehr hingerichtet worden war, konnte sie mit der Umwandlung in eine lebenslange Freiheitsstrafe rechnen. Doch wenige Wochen nach ihrer Verurteilung marschierten deutsche Truppen in Wien ein, worauf Frau Marek ihr Gnadengesuch nicht an den Bundespräsidenten, sondern an Adolf Hitler richten musste.
Und der lehnte ab. Im September 1938 brachte man aus der Strafanstalt Berlin-Tegel das »Gerät F« nach Wien. »F« stand für Fallbeil. Es wurde am 6. Dezember 1938 zum ersten Mal in Österreich angewendet. Martha Marek wurde an diesem Tag enthauptet.
Vier Jahre lang waren Polizei und Gendarmerie unter der Kontrolle des faschistischen Ständestaates gestanden, nach dem »Anschluss« ging die Exekutive in die Befehlsgewalt des Deutschen Reichs über. Zu den Aufgaben der Sicherheitsorgane gehörte jetzt das Aufspüren von »Volksschädlingen«, die schon wegen geringfügigster Delikte wie »Schwarzhören« oder »Erzählen regimekritischer Witze« an Sondergerichte übergeben und von diesen sogar zum Tod verurteilt werden konnten. Bei Kriegsausbruch gewann die zur »Stärkung der Wehrkraft« eingesetzte Schutzpolizei zunehmend an Bedeutung, die wie alle Polizeiorgane von der Gestapo überwacht wurde.
Nach 1945 musste der von den Nationalsozialisten zerschlagene Polizei- und Gendarmerieapparat neu aufgebaut werden. In dieser Zeit bitterer Armut stieg die Kriminalität rasant an, Raubmord und Plünderungen standen ebenso an der Tagesordnung wie der als Folge der geringen Lebensmittelrationen blühende Schleichhandel. Ausgerechnet in dieser Situation gab es keine schlagkräftige Polizeitruppe zum Schutz der Bevölkerung, da viele Beamte im Krieg gefallen oder in Konzentrationslagern ums Leben gekommen waren, andere hatten als ehemalige NSDAP-Mitglieder Berufsverbot. Die Personalnot war so groß, dass praktisch jeder, der sich um eine Stelle bewarb, ohne nähere Überprüfung aufgenommen wurde. Einer der damaligen Polizisten soll sogar ein Kassenschränker gewesen sein. Der »Wagenpark« der Wiener Polizei bestand aus einem einzigen Pkw und einem alten Steyr-Lastauto, die beide nur bedingt einsatzfähig waren. Besondere Verdienste beim Aufbau der neuen Truppe erwarb sich Polizeipräsident Josef Holaubek, auch weil es ihm gelang, die Polizei vor allzu großem Einfluss durch die Besatzungsmächte in der vierfach geteilten Stadt zu schützen. Er war es auch, der die Werbesprüche »Bist du jung, gesund und frei, komm zur Wiener Polizei« und »Die Polizei, dein Freund und Helfer« kreierte.
Am 14. April 1958 wurde der Leichnam der 21-jährigen Mannequinschülerin Ilona Faber hinter dem »Russendenkmal« am Wiener Schwarzenbergplatz aufgefunden. Das hübsche Mädchen hatte an diesem Abend den Elvis-Presley-Film »Gold aus heißer Kehle« im Schwarzenberg-Kino gesehen und war dann von einem unbekannten Mann hinter das nahe »Russendenkmal« gezerrt, sexuell missbraucht und erwürgt worden.
Das »Denkmal für den unbekannten Sowjetsoldaten« erinnert an die Befreiung Wiens durch die Rote Armee im Jahre 1945. Dem Polizeibeamten, der dort an diesem Abend routinemäßig Wache stand, war ein Verdächtiger aufgefallen, der bald ausgeforscht werden konnte. Es handelte sich um den dreißigjährigen Beschäftigungslosen Johann G., dessen Fußspuren mit denen hinter dem Hochstrahlbrunnen identisch waren.
Der Fall sorgte auch deshalb für Aufsehen, weil das Opfer aus »besseren Kreisen« stammte. Ilonas Vater, Ministerialrat Dr. Ludwig Faber, war ein hoher Beamter im Kabinett des damaligen Handelsministers Fritz Bock, der nach Bekanntwerden der Tat aus Solidarität zu seinem Mitarbeiter soweit ging, »die Wiedereinführung der Todesstrafe für Sexualverbrecher« zu fordern. Dies wäre, erklärte der Minister, »im Sinne der öffentlichen Sicherheit in unserer Stadt angemessen«.
Obwohl der mehrfach vorbestrafte Johann G. an Beziehungen mit Frauen kaum je Interesse hatte – er war zeitweise als »Strichjunge« im Homosexuellenmilieu tätig – gab es mehrere Indizien, die ihn schwer belasteten. So wurde ein Ohrring, den Ilona Faber am Tag ihres Todes getragen hatte, vor einem Lokal am Wiener Naschmarkt gefunden, in dem der Verdächtige Stammgast war.
Der Mord an der Schülerin wurde zum ersten großen Kriminalfall, über den das junge Medium Fernsehen umfangreich berichtete. Das Gericht kam zu einem denkbar knappen Ergebnis: Vier Geschworene hielten G. für schuldig, vier waren von seiner Unschuld überzeugt. Er wurde im Zweifel freigesprochen.
War er wirklich unschuldig? Vier Jahre nach der Tat starb ein Mann, in dessen Wohnung ein Schuh der Ermordeten gefunden wurde. Und 2002 behauptete eine Wienerin, dass ihr mittlerweile verstorbener Mann Eduard S. ihr nach der Tat gestanden hätte, Ilona Faber ermordet zu haben.
Das Verbrechen blieb ungeklärt. Heute wäre die Ausforschung des Täters mithilfe moderner DNA-Methoden zweifellos möglich.
Als »Blaubart von St. Pölten« ging der Frauenmörder Max Gufler in die Kriminalgeschichte ein. Zehn Jahre lang hatte sich der Waschmaschinenvertreter durch Heiratsinserate mit der Chiffre »Glücksfahrt« an wohlhabende Frauen mittleren Alters herangemacht und ihnen die Ehe versprochen. Sobald er ihnen ihr Geld abgenommen hatte, lud er sie zu einer Art Verlobungsreise ein, in deren Verlauf er ihnen ein Schlafmittel in den Kaffee mischte. Die bewusstlosen Frauen ertränkte er dann unbekleidet in Seen oder Flüssen, um Selbstmord vorzutäuschen.
Als im September 1958 der Leichnam der 47-jährigen Maria Robas aus Reifnitz am Wörther See gefunden wurde, richtete sich der Verdacht gegen Gufler, weil eine Nachbarin der getöteten Frau zufällig dessen Autonummer notiert hatte. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung in St. Pölten konnten mehr als tausend Gegenstände sichergestellt werden, die auf zahlreiche ungeklärte Mordfälle hinwiesen. Der unscheinbare Mann hatte eine mörderische Spur durch ganz Österreich gezogen. Gufler wurde unter dem Verdacht, 18 Frauen ermordet zu haben, festgenommen.
Letztlich für sieben Morde angeklagt, konnten ihm in einem Geschworenenprozess im Wiener Straflandesgericht vier Morde und zwei Mordversuche nachgewiesen werden. Der Serienmörder Max Gufler starb, zu lebenslanger Haft verurteilt, 1966 im Alter von 56 Jahren in der Strafanstalt Stein.
Am Abend des 12. März 1963 stand in der Wiener Staatsoper Richard Wagners »Walküre« auf dem Programm. Unmittelbar vor Beginn der Vorstellung wurde dem Dienst habenden Polizeibeamten mitgeteilt, dass sich im Duschraum der Damengarderoben ein lebloser Mädchenkörper befände. Tatsächlich lag dort die Leiche der elfjährigen Ballettschülerin Dagmar Fuhrich. Der Täter, der das Kind mit 34 Messerstichen ermordet hatte, war entkommen.
Ganz Österreich nahm an der schrecklichen Tat Anteil – wohl auch, weil nie zuvor ein Mord an so »prominenter Adresse« geschehen war. In den folgenden Wochen und Monaten wurden alle als Triebtäter registrierten Personen überprüft, weiters jeder, der Zugang zum Opernhaus hatte, die Angehörigen von Dagmars Schulkollegen und die kurz vor der Tat aus der Haft entlassenen Straftäter. Insgesamt führte die Polizei rund 14 000 Alibiuntersuchungen und Vernehmungen durch.
Vorerst ohne eine brauchbare Spur zu finden. Doch nach drei Monaten wurden in der Wiener Innenstadt drei Frauen durch Messerattentate verletzt. Das letzte Opfer schrie laut um Hilfe, sodass es einem herbeieilenden Polizeiinspektor gelang, den 33-jährigen Verkäufer Josef Weinwurm festzunehmen, der wegen diverser Diebstähle, nicht jedoch als Triebtäter vorbestraft war. Nach tagelangen Verhören, in denen er sich in Widersprüche verwickelte, gelang es der Polizei, ihn als den gesuchten »Opernmörder« zu überführen.
Als Grund für das Verbrechen gab der Täter in dem Prozess im Wiener Landesgericht an, dass er nach einem Streit mit seiner Mutter aggressiv geworden und in diesem Zustand zur Staatsoper gefahren sei. In dem Gebäude fand er sich gut zurecht, da er bereits des Öfteren unbemerkt in die Damengarderoben geschlichen war.
Josef Weinwurm wurde vom Gerichtspsychiater als »krankhafter Frauenhasser« eingestuft, der zur Tatzeit voll zurechnungsfähig gewesen sei. Zwei Jahre nach seiner Verurteilung unternahm der »Opernmörder« im Gefängnis einen Selbstmordversuch, den er überlebte. Alle Gesuche auf vorzeitige Haftentlassung wurden abgelehnt. Josef Weinwurm starb im August 2004 in der Strafanstalt Stein.
Dagmar Fuhrich fand in einem Familiengrab an der Seite ihrer inzwischen verstorbenen Eltern am Grinzinger Friedhof die letzte Ruhe.
* die heutige Praterstraße