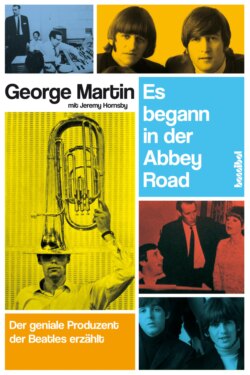Читать книгу Es begann in der Abbey Road - George Martin - Страница 7
ОглавлениеDa in diesem Buch Musik den Themenschwerpunkt bildet, scheint jetzt die Zeit gekommen, um kurz zu pausieren und Ihnen meine Ansichten und Gefühle zur Musik generell, der Komposition und der Orchestrierung darzulegen.
Wenn ich Ihnen ein einziges Werk nennen müsste, das mir als Jugendlichem die Musik näherbrachte, würde ich Debussys „Prélude à l’après-midi d’un faune“ antworten. Mit 15 hörte ich in meiner Schulaula eine Aufführung des BBC Symphony Orchestra unter der Leitung von Adrian Boult. Ich konnte kaum glauben, dass Menschen in der Lage waren, so ergreifende, wunderschöne Klänge zu schaffen. Ich beobachtete die Männer im Frack, wie sie manisch mit tierischen Eingeweiden und Rosshaar hantierten und in lustige Instrumente bliesen, an deren Ende ein Holzblättchen angebracht zu sein schien. Die rein mechanischen Vorgänge, die ich beobachtete, standen scheinbar in keiner Beziehung zu dem traumähnlichen Klang. Ich empfand es als pure Magie und fühlte mich vollkommen verzaubert.
Meine Neugier war geweckt. Ich besorgte mir eine vereinfachte Partitur des Werks, studierte sie und erkannte den Aufbau. Ich sah, welche Melodielinien die Flöten übernahmen und welche die Klarinetten, entdeckte die Stelle, an der das Waldhorn einsetzte. Auch das besondere Sforzando, also die übermäßige Betonung der Streicher, blieb mir nicht verborgen. Ich betrachtete und analysierte die Noten. Heute weiß ich genau, wie die Atmosphäre der Musik erzeugt wird und warum das Werk als so intelligent einzuordnen ist. Trotz des technisch-harmonischen Verständnisses ist es für mich immer noch die magischste und wundervollste Komposition der Musikgeschichte.
Obwohl ich heutzutage ähnlich aufgebaute Musik komponieren kann, beschäftigte ich mich anfänglich nicht mit solchen Herausforderungen – ganz im Gegensatz zu Debussy. Das wahre Wunder der Musik und der Umsetzung mit einem großen Orchester liegt darin, mit Klängen zu malen. Trotzdem würde kein moderner Künstler, der etwas auf sich hält, den Versuch unternehmen, einen Botticelli zu imitieren. Die klassische Musik war meine erste Liebe, und ich werde oft gefragt, warum ich im Pop-Kontext arbeite. Eine typische Frage lautet: „Lassen Sie sich da nicht zu einer niedrigeren Kunstform herab?“ Die typische Antwort ist ein Nein, und das aus diversen Gründen.
Mit dem Begriff „Klassik“, so wie er im allgemeinen Sprachgebrauch verwendet wird, bezeichnet man Musik, die mindestens 50, doch meist mehr als 100 Jahre alt ist. Natürlich gibt es auch die sogenannte zeitgenössische Klassik. Fast alle Hörer empfinden diese Melodien als dissonant. Ich persönlich kenne niemanden außerhalb des Berufs, der solche Werke tatsächlich genießt.
Doch ich möchte nicht unfair klingen. Die meiste Komponisten „moderner Klassik“ stecken in einer Zwickmühle. Sie dürfen die schon ausgebildeten Stilistiken nicht zitieren, da sonst der Vorwurf erhoben wird, sie seien romantisch-verbrämt, gefühlsduselig oder kopierten ganz einfach oder stählen sogar. Der einzige Ausweg aus dem Dilemma besteht in der Komposition neuer und oft radikaler Klangwelten – und bitte denken Sie daran, dass sogar die Zwölftonmusik mittlerweile ein alter Hut ist und schon als romantisch eingestuft wird. Und so schreiben junge Komponisten Musik, die sich niemand anhören kann, oder in einem nostalgischen Anflug Symphonien im Stil von Brahms. Und worin liegt da noch der Sinn? Die Klassik ist also eine Einbahnstraße, und genau an dem Punkt setzt Popmusik an, da sie die Möglichkeit zur Kreativität bietet.
Doch nicht nur das! Viele klassische Komponisten sind offensichtlich „populär“ gewesen. Schubert zum Beispiel schrieb Popmusik, da die einfachen Menschen seine Stücke mit viel Freude sangen. Sogar ein Beethoven komponierte für kleinere Ensembles. Natürlich betrachten wir diese Größen mir Ehrfurcht, denn sie legten das Fundament für die grundlegende musikalische Kultur der westlichen Welt. Wäre Bach noch am Leben, dann ginge er – und da bin ich mir ganz sicher – genauso mit der Musik um, wie wir es heutzutage machen. Er war vornehmlich ein Arbeiter und Handwerker, dem in seinem Leben nicht die Anerkennung zuteilwurde, die er verdient hätte. Er arbeitete in allen Belangen sehr hart und reiste sogar Hunderte von Meilen zu Händel, um den berühmten Mann kennenzulernen, von dem er so viel gehört hatte und der zur oberen Gesellschaftsschicht Londons zählte, ja sogar ein Freund des Königs war. (Der arme, alte Bach verpasste ihn leider um einen Tag.) Bach lebte sorgenfrei, doch niemals luxuriös, was nicht überraschte, denn er musste zwanzig Kinder von seinen beiden Frauen durchfüttern. Es gab also keine andere Wahl, als hart zu arbeiten, einen Chor zu leiten, Orgel zu spielen und Musik für seinen Mäzen zu komponieren, den Herzog von „wo-auch-immer“, der gerade regierte.
Beispielsweise konnte der Herzog aus heiterem Himmel einen Auftrag erteilen: „Ich brauche eine Kantate für Sonntag in einer Woche, denn die Tante meiner Frau feiert ihren Geburtstag.“
Bach antwortete möglicherweise: „Die Komposition eines solchen Stückes erfordert einiges an Zeit, Eure Hoheit.“
Doch ein Aufschub lag im Bereich des Undenkbaren, denn die unvermeidliche Antwort hätte gelautet: „Das tut mir leid, Johann, aber ich brauche sie für den Tag, und du willst doch nächste Woche auch etwas zu essen haben, nicht wahr?“
Bach ging also nach Hause und dachte sich: „Gütiger Himmel! Was soll ich denn jetzt schreiben? Ah, da fällt mir schon was ein. Da war doch so eine nette Melodie in dem Stück für das Streichquartett, die ich vor drei Monaten komponiert habe. Ich kann sie für die Sopranstimme nutzen!“ Bach hat sich tatsächlich das eigene Material „geschnappt“, es neu arrangiert und dann womöglich zufrieden gedacht: „Das reicht! Ihm wird niemals auffallen, dass ich die Passage schon geschrieben habe.“
Und wenn er seinem Herzog die Kantate präsentierte, war es so sicher wie das Amen in der Kirche, dass seine Durchlaucht den Trick nicht erkannte und von den Melodien ganz und gar entzückt war. „Großartig. Du hast es wieder einmal geschafft, Johann. Beeindruckend.“
Bach komponierte wie am Fließband, schrieb wie ein heutiger Drehbuchautor, der von einer Deadline getrieben wird – und nur Gott weiß, wie viele fixe Termine ihn bedrängten. Eins ist sicher: Ob Bach in der heutigen Zeit regelmäßig in der Hitparade auftauchen würde oder nicht – er ließe nichts unversucht, um sein Material ständig in veränderter Form auszulegen. Allerdings stände er der Punkmusic abgeneigt gegenüber, denn er war ein musikalisch empfindender Mensch, was im Gegensatz zu dem Stil steht, den ich eher als separat einzuordnendes Phänomen bezeichne.
Natürlich arbeiten Komponisten in der Moderne im „klassischen Stil“ und sind auch erfolgreich, wofür es aber bestimmte Gründe gibt. Zum Beispiel möchte ich Chatschaturjan nennen, der erst vor einigen Jahren gestorben ist, nach einem Leben, das er der Komposition äußerst populärer „klassischer Musik“ widmete. Ich definiere seine Musik als „klassisch“, da er bevorzugt Symphonien schrieb und zudem für ein Orchester und keine Rockgruppe. Der wohl wichtigste Aspekt der sogenannten klassischen Ausrichtung bestand in der Entwicklung elektronischer Komponenten in der modernen Musik durch den Westen, die in Russland als dekadent und bourgeois verschrien waren. In dem Land gibt es nur wenige Rockbands, die aber höchstens Kopien unserer Gruppen sind. Aus diesem Grund, also der Originalität von zum Beispiel britischer Musik, ist die Nachfrage nach westlichen Schallplatten hinter dem Eisernen Vorhang so groß. Musiker, die in Russland eine professionelle Laufbahn anstreben, werden sich keinesfalls der Moderne zuwenden, sondern in die Fußstapfen von Tschaikowsky, Borodin und vergleichbaren Urhebern treten. Ein neuer Chatschaturjan, gesetzt dem Fall, er hat das nötige Talent, wird also Symphonien komponieren und Musik für das Ballett verfassen.
Das ist nicht zu kritisieren, denn in dem Land herrscht eine große Nachfrage bezüglich dieser Stilistiken. Im Westen sehen sich große Orchester dem Druck wirtschaftlicher Gesetze ausgeliefert. Niemand kann sich auf normalem Wege ein Orchester zur Umsetzung seiner oder ihrer Musik leisten. Komponisten erhalten natürlich Aufträge, doch das Medium für den großen Orchester-Stil ist unweigerlich die Filmmusik. Es ist eine unverkennbare Tatsache, dass ein Komponist, der ausschließlich Symphonien schreibt, sich mit den unerbittlichen Marktgesetzen auseinandersetzen muss. Eine Antwort auf solch eine Bestrebung würde lauten: „Sie schreiben nur Symphonien? Na, dann mal viel Glück! Sie werden sie niemals aufgeführt hören.“ Der beste Beweis der Theorie ist Havergal Brian, der als Urheber eines enorm großen Werkes gilt, von dem nur wenige Symphonien von einem Orchester umgesetzt wurden.
Diese Beschränkungen sind auch bei Musikaufnahmen zu beobachten.
Als ich meine Tätigkeit für die EMI aufnahm, bestand die Arbeit überwiegend in der Aufnahme klassischer Musik. Doch erst durch die Verlagerung ins kreative Popsegment lohnte sich der Job und wurde darüber hinaus hochinteressant. Es ist gut möglich, dass sich in einhundert Jahren niemand mehr an meinen Namen erinnert, aber ich bin mir sicher, dass ich als Aufnahmeleiter einer weiteren Fassung von Beethovens Fünfter völlig in Vergessenheit gerate. Es wurden schon so viele Mitschnitte dieser und vergleichbarer Arbeiten gemacht, dass sich kein Weg mehr eröffnet, neue Elemente oder Variationen beizusteuern.
Es gibt keinen einzigen klassischen Künstler, der auch nur annähernd Musik in dem Umfang schafft, der bei Popmusikern zur Normalität gehört.
Ein Großteil der Popmusik ist unweigerlich mit dem Arrangieren und Orchestrieren verknüpft – und das sind schwer zu erlernende Fähigkeiten. Der älterer Herr, der mich in Guildhall unterrichtete, erteilte mir für gewöhnlich Hausaufgaben: „Nun, ich möchte, dass Sie sich bis zur nächsten Woche den zweiten Satz von Beethovens Großer Sonate für das Hammerklavier zu Gemüte führen und die Passage für ein Symphonieorchester notieren.“ Ich verbrachte gefühlte Jahre mit der Aufgabe, die komplexe Passage für ein Orchester auszunotieren, doch konnte ich sie niemals hören und wusste somit nicht, wie sie letztendlich klang. Doch mein Lehrer griff auf einen großen Erfahrungsschatz zurück, sah sich die Noten an und riet mir: „Oh ja, sehr gut. Mir gefällt die Arbeit. Doch ich würde das Fagott nicht auf die Drei setzen. Dadurch wirkt das gesamte Klangbild im Bassbereich zu voluminös.“ Er erklärte mir, was ich machen und was ich vermeiden sollte, doch da ich es niemals hörte, konnte ich seine Ratschläge nicht im ganzen Umfang aufnehmen. Heute bin ich in der Lage, solche Partituren mit meinem „inneren Ohr“ zu hören, doch damals war es mir schlichtweg unmöglich.
Ich hatte zwar schon meine eigenen Stücke für das Klavier geschrieben und gespielt, doch die Erfahrung lässt sich schwerlich auf komplexere Zusammenhänge übertragen. Meine Kompositionen entstanden durch eine Art intuitiver Spielerei. In dem Fall übernehmen die Finger das Komponieren, wodurch das Ergebnis einer ständigen Kontrolle unterliegt. Ich kann mich stundenlang vor einen Flügel setzen und spiele kein konkretes Stück, sondern lasse den Fingern freien Lauf. Das lässt sich mit dem automatischen Schreiben vergleichen, denn die Finger suchen sich ihren Weg. Doch es ist weit entfernt vom bewussten Komponieren.
Die Orchestrierung, die von der reinen Komposition zu unterscheiden ist, setzt einen bewussten Gedankenprozess voraus. Durch eine geschickte Orchestrierung werden die schon bestehenden Noten und Melodien sozusagen belebt, ihnen wird eine Farbe gegeben. Voraussetzung für diese Kunstform ist die nötige Erfahrung. Bestimmte Instrumentensätze bilden ein eher klar umrissenes Klangbild, doch wenn man sie nur leicht modifiziert, entsteht dabei ein vollkommen unterschiedliches Klangerlebnis. Es gibt keine Ausbildung, durch die man eine „richtige“ Methodik erlernen kann, die automatisch für immer und ewig gilt und demzufolge umgesetzt wird. Natürlich bestehen bestimme Grundregeln, denen man folgt, um nicht direkt in eine musikalische Fallgrube zu tappen, doch um das Handwerkszeug des Orchestrierens zu erlernen, sind konkrete Erfahrungen unabdingbar. Die Komposition ist eine bewusste Verschmelzung einer Melodie mit den entsprechenden Harmonien, egal ob sie später von einem Synthesizer oder einem 100-köpfigen Orchester gespielt wird. Die Grundkomponenten ändern sich nicht. Durch die Orchestrierung wird die Musik belebt. Die Rezeption des Publikums hinsichtlich der zugrunde liegende Melodielinie ändert sich fundamental, wird entweder die eine oder eine andere Klangfarbe ausgewählt.
Die Tatsache wurde mir nachdrücklich bei meiner Arbeit mit den Beatles bewusst. Zu Beginn gab es viele Hörer, die wegen der großen Lautstärke ihre Stücke nicht angemessen schätzen konnten. Sie ordneten die Beatles als eine laute und abstoßende Band ein, vergleichbar mit dem Publikum, das Punk ablehnt (allerdings ist das im Fall dieses Genres eher berechtigt). Damals hörte ein Mann mittleren Alters ihre Musik und meinte dazu: „Mein lieber Junge, was ist das für ein Krach!“ Daraufhin achtete er weder auf die Musik als Ganzes noch auf die Harmonien oder den Text.
Erst als sie bekannter wurden und Künstler wie Mantovani orchestrierte Versionen der Songs mit einlullenden und süßlichen Klängen einspielten, sagte dieselbe Person mittleren Alters: „Oh, das ist aber ein schönes Stück. Das sind doch die Beatles, nicht wahr? Sie schreiben hervorragende Musik!“ Diese Person hörte exakt die gleichen Stücke, die gleichen Harmonien und die gleichen Melodiebögen – aber auf eine Art arrangiert, die der Auffassungsgabe eines durchschnittlichen Mannes mittleren Alters mit einem dementsprechenden Hörempfinden entspricht.
Im Verlauf meiner Arbeit mit der Band beschränkte sich der Schaffensprozess nicht nur auf Stücke und Harmonien. Wir entwickelten uns zu einem Kompositionsteam, einem kreativen Team, das musikalische Bilder malt. Zuvor und zu dem Zeitpunkt gab es keine vergleichbaren Künstler. Ich möchte mich nicht überheblich ausdrücken und die Resultate als Äquivalent zu Bachs Messe in h-Moll bezeichnen, doch zumindest basierten sie auf einer ungestümen Kreativität, waren nicht steril und keine Reproduktionen älterer Werke.
Manchmal möchte ich die Orchestrierung mit einer Einkleidung vergleichen. Nimmt man zum Beispiel ein Streichquartett von Beethoven, das manche als staubtrocken empfinden, kann das Stück durch neue Kleidung vollständig verwandelt werden. Es ist immer noch die gleiche Musik, doch nun erfreuen sich die Zuhörer daran. Und genau das geschieht alle paar Jahre: Ein Arrangeur verkleidet eine Komposition der Klassik – und siehe da, sie steht an der Spitze der Hitparade.
In den Orchestrierungsseminaren in Guildhall musste ich die gegensätzliche Methode erlernen – und zwar eine Komposition, die für ein Orchester geschrieben wurde, auf die eingeschränkte Tastatur eines Klaviers zu übertragen. Natürlich haben das schon viele bekannte Komponisten gemacht. Rachmaninow übertrug Mussorgskys Bilder einer Ausstellung auf das Klavier, und seitdem gehört es zu den berühmten Stücken des Repertoires für das Instrument.
Mich verblüffte Ravel, ein Mann, bei dem wir sofort an üppige Orchester denken. Er war ein erstklassiger Pianist und schrieb – mit der Ausnahme seines Klavierkonzerts, soviel ich weiß – seine Stücke zuerst auf dem Klavier. Danach orchestrierte er sie, was mir recht kurios erscheint. Allerdings behandelte Ravel, einer der größten Arrangeure aller Zeiten und zugleich der Musiker, den ich am meisten schätze, all seine Kompositionen mit einer außergewöhnlichen Herangehensweise.
Jeder Künstler entwickelt eine spezielle Arbeitsweise, ähnlich den Meistern der Orchestrierung wie Debussy und Tschaikowsky (Letzterer vermittelte seinem Orchester das Wissen durch Beschreibungen), und im 20. Jahrhundert Strawinski, der von der Pieke auf gelernt hatte, wie man mit einem so großen Klangensemble umgeht.
Die Orchestrierung hat sich mittlerweile zu einer ausgefeilten Kunstform entwickelt, speziell in der Welt des Films, wo man vielen Meistern des Fachs begegnet. Zu meiner Anfangszeit klimperte ich ein kleines Stückchen auf dem Piano und dachte: „Das könnte sich auf einer Klarinette ganz nett anhören.“ Wenn ich heutzutage eine Filmmusik schreibe und mich mit einer bestimmten Passage auseinandersetze, denke ich in größeren Zusammenhängen: „Vielleicht könnte ich hier einen dreckigen Posaunenklang einsetzen. Möglicherweise benötige ich an der Stelle keine Streicher, sondern nur ein eher perkussives Element.“ Ich tendiere dazu, die Orchestrierung ähnlich der Komposition eines Gemäldes zu sehen. Ein Künstler kann eine brillante Skizze mit scharf umrissenen Kohlelinien entwerfen – zum Beispiel Picasso, der die schönsten Zeichnungen schuf. Durch die Orchestrierung hingegen malt man in die freien Flächen subtile Farben, wodurch dem Ganzen eine beinahe dreidimensionale Form verliehen wird.
Schon kurze Zeit nachdem ich Guildhall verlassen hatte, manifestierte sich bei mir ein deutliches mentales Bild, wie denn ein Klanggemälde aussieht. Ich musste viel schreiben und befand mich in der glücklichen Lage, die Umsetzung meiner Arbeit bei Orchestern zu hören. Doch auch mit viel Erfahrung kann sich niemand absolut sicher sein, wie das Resultat seiner Arbeit klingt. Man mag eine gute Idee mit seinem „inneren Ohr“ hören, doch kann allerhöchstens Vermutungen über den tatsächlichen Sound anstellen. Und so lernt man Risiken einzugehen, Risiken, die durch Imagination geboren werden – den Eckpfeiler jeder guten Orchestrierung.
Doch über all die Dinge wusste ich nicht viel, als ich mir meinen alten Militärmantel von der Marine überwarf und mit dem Fahrrad in die Abbey Road zum Einstellungsgespräch mit Oscar Preuss fuhr.