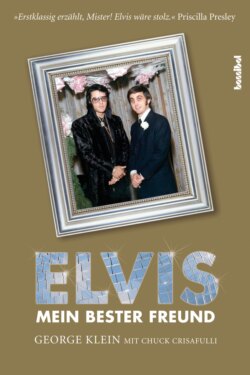Читать книгу Elvis - Mein bester Freund - George Klein - Страница 9
ОглавлениеIn den Anfangstagen des Rock’n’Roll existierte »Roadie« noch nicht als Wort oder gar als eigenständiger Beruf. Wenn Elvis auf Tournee ging (und er tourte zwischen seinen Filmen wie verrückt), nahm er ein paar Typen mit, die er kannte und denen er vertraute – Typen, die als Fahrer für ihn arbeiteten, sich um Instrumente und Gepäck kümmerten und ihm notfalls auch ein wenig Personenschutz bieten konnten. Anfangs war Red West die Ein-Mann-Bühnenmannschaft für Elvis, Scotty und Bill. Ich kannte Red noch aus der Humes, wo ich eine Zeitlang in der Jugendliga mit ihm Baseball gespielt hatte. In einem Punkt hatte er sich nicht verändert: Er war einer der härtesten Jungs im Norden von Memphis, wenn nicht in ganz Tennessee. Andererseits konnte er einen aber auch mit seinem Scharfsinn und seinem ausgezeichneten musikalischen Verständnis überraschen. Elvis und er waren sehr eng miteinander befreundet.
Im Jahre 1957 war Elvis der erste Rock’n’Roll-Superstar der Welt, und mittlerweile kamen wesentlich mehr Leute mit auf eine Tournee. In seinem Cousin Gene Smith hatte er eine Art »rechte Hand« gefunden. Elvis und Gene waren sich stets sehr nahegestanden – so nahe, dass sie zusammen eine eigene Privatsprache entwickelt hatten, die außer ihnen praktisch keiner verstand. Zwar konnte man Gene nicht unbedingt als klug bezeichnen, aber er war lustig, unkompliziert und eines jener Originale, mit denen sich Elvis immer gerne umgab. Vor allem aber war er hundertprozentig loyal gegenüber Elvis, den er immer »Cuz« nannte.
Zu Elvis’ Gefolge gehörte auch ein kräftiger Typ namens Arthur Hooton, dessen Mutter mit Frau Presley im Saint Joseph-Krankenhaus in Memphis zusammengearbeitet hatte. Arthur war ein ziemlich imposanter Bodyguard, denn er war über 1,85 Meter groß und muss dabei gut 150 Kilo gewogen haben. Er war jedoch freundlich, gutherzig und, verglichen mit jemandem wie Red West, im Grunde seines Herzens ein ziemlich friedlicher Genosse. Ich glaube sogar, Elvis hätte eher zugeschlagen als Arthur. Aber Arthur hatte noch andere Qualitäten: Er war nicht auf den Kopf gefallen und stand voll und ganz zu Elvis. Auf ihn konnte man stets zählen. Dann war da noch Cliff Gleaves, ein Teilzeit-DJ aus Jackson, Tennessee. Auch er gehörte zu Elvis’ engsten Vertrauten und war ebenfalls ein »Reisebegleiter«. Unter den Typen aus Memphis stach Cliff durch seine schicke Kleidung und seine Sprachgewandtheit heraus. Er war jemand, der wie ein Hochstapler aus allem, was er tat, eine großartige Abenteuergeschichte spinnen konnte. Man konnte nie ganz sicher sein, wie viel an Cliffs spannenden, unerhörten Geschichten tatsächlich wahr war, aber es machte immer Spaß, ihm zuzuhören.
Cliff war nach den Dreharbeiten zu Loving You in Los Angeles geblieben, um zu sehen, ob er dort eine eigene Schauspielkarriere auf die Beine stellen könnte (wenngleich er feststellen musste, dass sich die Türen Hollywoods nicht ganz so leicht auftaten, wenn Elvis nicht mit dabei war). Red West war zur Marineinfanterie eingezogen worden und stand nicht zur Verfügung. Elvis brauchte also tatsächlich jemanden, der ihm aushalf, so nett und großzügig es auch gewesen sein mochte, mir eine Stelle als »Reisebegleiter« anzubieten. Ich war froh und stolz, dass ich dieser Jemand sein konnte.
Freilich gab es noch eine andere wichtige Person in Elvis’ Welt, mit der jeder, der diese Welt betrat, zurechtkommen musste: Colonel Tom Parker. Parker war eine undurchsichtige Gestalt – niemand wusste genau, woher er seinen Dienstgrad eigentlich hatte. Sein bisheriges Tätigkeitsfeld umfasste verschiedene Jobs auf den Rummelplätzen des Südens sowie Promotion- und Management-Aufgaben für eine Reihe von Country-Musikern. Auf den Tipp eines seiner Talentsucher hin hatte Parker Elvis ein paar Auftritte im Vorprogramm des Country-Stars Hank Snow verschafft, der damals Geschäftspartner des Colonels war. Als Parker erfuhr, dass die Zuschauer immer noch nach Elvis schrieen, wenn Snow als Star des Abends die Bühne betrat, spürte er, dass hier offenbar etwas Besonderes im Gange war. Ganz zu Anfang war Elvis von seinem Gitarristen Scotty Moore gemanagt worden, dann unterschrieb er bei einem DJ aus Memphis namens Bob Neal. Als Elvis im Laufe des Jahres 1955 immer populärer wurde, kümmerte sich Colonel Parker zunehmend um seine Auftritte, weil er ihn als Klienten gewinnen wollte.
Frau Presley konnte den Colonel nicht leiden, aber sie und ihr Mann mochten Hank Snow. Nach ein paar persönlichen Besuchen von Snow waren die Presleys denn auch überzeugt, dass ein Vertrag mit Parker und Snow ein wichtiger Schritt in der Karriere ihres Sohnes sei. Die fertig aufgesetzten Verträge lauteten jedoch ausschließlich auf den Namen des Colonels. Hank Snow erzählte mir Jahre später, dass er während einer Tournee von der Vertragsunterzeichnung erfahren habe. Als er sich danach wieder mit dem Colonel traf, wollte er ihm gratulieren: »Hey, wir haben uns diesen Presley geschnappt.« Die Antwort des Colonels war: »Was meinst du mit ›wir‹, Hank?« Snow war ausgebootet worden, und das war das Ende seiner Geschäftsbeziehungen zu Colonel Parker.
Der Colonel war ein typischer Showman alter Schule – ein großartiger Promoter, Organisator und Drahtzieher. Er selbst besaß keinerlei künstlerische Begabung und konnte einen erfolgversprechenden Künstler oder einen potentiellen Hit nicht selbst erkennen – aber er wusste, wie man den Eintrittskarten- und Schallplattenverkauf ankurbelte und die Aufmerksamkeit auf die Dinge lenkte, die er an den Mann oder die Frau bringen wollte. So, wie Elvis als Künstler wegweisend war, war Colonel Parker als Manager des ersten Rock’n’Roll-Superstars der Welt wegweisend. Vieles, was er damals tat, war brillant: Als Elvis sagte, er wolle in Kinofilmen mitspielen, begann der Colonel, bei seinen Konzerten Fragebögen an die Fans zu verteilen. Darauf fanden sich Fragen wie: »Möchten Sie Elvis in einem Spielfilm sehen?« oder: »Wie oft würden sie ins Kino gehen, um einen Spielfilm mit Elvis zu sehen?« Er packte Hunderte dieser Bögen zu Bündeln zusammen und schickte sie an den Hollywood-Filmproduzenten Hal Wallis (Casablanca). Durch diese clevere Idee wurde Elvis zu Probeaufnahmen eingeladen, und Wallis produzierte später viele von Elvis’ Filmen.
Colonel Parker war zwar unumstritten ein Meister, wenn es darum ging, Elvis Geld und Aufmerksamkeit zu verschaffen, doch ging er dabei auch ausgesprochen rücksichtslos vor. Er war ein großer Mann, der sich trotz seines finanziellen Erfolges fast wie ein Landstreicher kleidete, und der unfreundlichste Mensch, dem ich je begegnet war – er schien einen schon anzuschreien, wenn er nur »guten Morgen« sagte. Ob er nun ein »echter« Colonel war oder nicht, schien keine Rolle zu spielen – wenn er einen Raum betrat, übernahm er sofort das Kommando. Es war offenkundig, dass er nicht sonderlich viel von den Typen hielt, die mit Elvis reisten, und er bemühte sich, dass er so wenig wie möglich mit ihnen zu tun hatte. Mich beäugte er etwas weniger misstrauisch – ich glaube, er hielt mich für einigermaßen auf Draht, weil ich einen College-Abschluss und eine eigene Karriere beim Radio vorzuweisen hatte. Als ich die Welt von Elvis Presley zum ersten Mal betrat, war der Colonel aus meiner Sicht jedoch mehr eine Naturgewalt, mit der man rechnen musste, als eine Person, die ich kennenlernen wollte.
Als ich meiner Mutter erzählte, dass ich mit Elvis auf Tournee gehen würde, gab sie mir ohne zu zögern ihren Segen. Sie hatte meine Karriere beim Radio immer unterstützt, obwohl ich nicht sicher bin, ob sie verstand, worin der Reiz meiner heißgeliebten Rock’n’Roll-Platten tatsächlich lag (oder warum sich manch andere Mutter über einige dieser Platten derart aufregte). Ich weiß auch nicht, ob sie den ganzen Trubel um Elvis begriff, doch wusste sie, dass sich mir durch ihn eine ganze Welt neuer Möglichkeiten auftun könnte.
Meine Karriere als Rock’n’Roll-Reisebegleiter nahm in Chicago ihren Anfang, der ersten Station auf Elvis’ Frühlingstournee. Gene Smith, Arthur Hooton und ich reisten mit Elvis, während die Band – Scotty, Bill, der Schlagzeuger D.J. Fontana und die Gesangsgruppe The Jordanaires – getrennt von uns fuhren. Ich hatte übrigens dann doch ein wenig mehr zu tun, als nur Zeit mit Elvis zu verbringen – zu meinen Aufgaben gehörte es, den neuen Blattgoldanzug zu transportieren, den Colonel Parker bei dem berühmten »Cowboyschneider« Nudie Cohen in Auftrag gegeben hatte. Der Trick war, dass ich ihn in einen ganz normal aussehenden Anzugschoner steckte, damit er keine besondere Aufmerksamkeit erregte, wenn ich ihn vom Zug zum Auto, zum Hotel oder zum Theater trug. Für jedermann sah es so aus, als befänden sich meine eigenen Kleider in dem Sack und kein Anzug aus Gold im Wert von 5000 Dollar. Trotzdem machte es mich stets sehr nervös, dieses Ding herumzutragen, und ich war jedes Mal froh, wenn ich ihn Elvis übergeben konnte. (Ein paar Mal jedoch wurde ich vor der Show von Elvis getrennt und konnte mir beim Sicherheitspersonal nur dadurch Zugang zur Garderobe verschaffen, indem ich den Reißverschluss des Sacks ein wenig öffnete und ein Stückchen seines goldenen Anzuges hervorschimmern ließ.)
Auf dem Weg zum Konzert im Chicagoer International Amphitheater bekam ich einen ersten Vorgeschmack davon, wie verrückt das Leben auf Tournee sein konnte. Der Colonel hatte arrangiert, dass Elvis und ich in zwei nicht gekennzeichneten Wagen der Chicagoer Polizei zum Konzertsaal gefahren wurden. An einer Straßenkreuzung hielt der Fahrer, und der Wagen kam etwa 30 Zentimeter auf dem Fußgängerüberweg zum Stehen. Ein wie ein Saufbruder wirkender Typ, der gerade die Straße überquerte, war darüber so erbost, dass er auf die Motorhaube schlug und schrie: »Fahrt eure verdammte Karre zurück!«
Ehe man sich’s versah, war der Beamte auf dem Beifahrersitz auch schon ausgestiegen und hatte seine Waffe auf den Saufbruder gerichtet. »Mach, dass du wegkommst, du Wichser, oder ich blase dir dein gottverdammtes Gehirn weg«, knurrte er. Der Säufer stammelte ein paar Worte der Entschuldigung und torkelte davon. Elvis und ich sahen uns auf dem Rücksitz nur schweigend an. Ganz ruhig stieg der Polizist zurück ins Auto, drehte sich zu uns um und sagte: »Elvis, wenn Sie nicht dabei gewesen wären, hätte ich ihn erschossen. Aber wir hatten leider keine Zeit, ihn umzupusten, weil wir es rechtzeitig zum Konzert schaffen müssen.« Wir erfuhren nie, ob das nun ein Witz sein sollte oder nicht, aber wir bekamen den Eindruck, dass in Chicago ziemlich raue Sitten herrschten.
Trotzdem gelang es Elvis natürlich, sein Publikum zu begeistern. Ich hatte in Memphis schon häufig erlebt, wie eine Halle bei Rock’n’Roll-Konzerten kochte, aber auf die Hysterie, die losbrach, als er an jenem Abend in seinem Goldanzug die Bühne betrat, war ich nicht vorbereitet. Das gesamte Gebäude schien zu erzittern, und obwohl die Hausbeleuchtung ausgeschaltet war, wurde es durch das Blitzlichtgewitter im Saal plötzlich taghell. Diese Lichtblitze glitzerten auf Elvis’ goldenem Anzug wie ein Stroboskop, ein wirklich phantastischer Anblick. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass sich die Stimmung im Saal noch steigern könnte. Außerdem fragte ich mich, wie Elvis wohl damit fertig wurde, im Zentrum von alledem zu stehen – selbst an meinem Platz neben der Bühne war ich so nervös und aufgeregt, dass mir beinahe übel wurde.
Sobald die Musik begann, stieg der Energiepegel aber sogar noch. Die Band war in Höchstform und spielte, als gehörte ihr der ganze Schuppen. Ich hatte Elvis schon zuvor bei Konzerten erlebt, aber ihn von der Seite der Bühne aus zu beobachten, war so, als sähe ich ihn zum ersten Mal. Er ging auf der Bühne vollkommen aus sich heraus, behielt dabei jedoch stets die volle Kontrolle – jede seiner Bewegungen und Gesten war perfekt auf die Musik abgestimmt und diente ausschließlich dazu, die Wirkung seiner Gesangsdarbietung zu verstärken. Ich hatte ihn bislang bei grandiosen Heimspielen gesehen, doch das hier war etwas vollkommen anderes – es war einfach toll.
Auf der Bühne ging es dermaßen wild zu, und das Geschrei des Publikums war so laut, dass ich mir, offen gestanden, nicht vorstellen konnte, wie die Band sich selbst noch gut genug hören konnte, um exakt zusammenzuspielen – sie benutzten damals noch sehr kleine Verstärker und hatten noch keine Bühnenmonitore. Jahre später fragte ich D.J. Fontana danach, und er sagte: »Wir waren wahrscheinlich die erste Band, die von einem Arsch dirigiert wurde. Wenn wir nichts mehr hören konnten, beobachteten wir einfach Elvis’ Hintern und orientierten uns an ihm.«
Elvis’ Hinterteil war an jenem Abend in Gold gekleidet. Der Goldplättchen-Stoff hielt einer typischen Elvis-Darbietung jedoch kaum stand. Bei einigen seiner dramatischeren Bühnenbewegungen lösten sich immer wieder Teile des Besatzes. Nach der Show beklagte sich Colonel Parker bei Elvis in der für ihn typischen Sorge darum, was unterm Strich herauskam: »Elvis, jedes Mal, wenn du dich auf die Knie fallen lässt, kostet uns das fünfzig Dollar.« Er schlug vor, Elvis solle es in diesen Hosen etwas ruhiger angehen lassen und beim nächsten Mal nicht so wild herumhüpfen. Das war jedoch gerade so, als bitte man einen Hurrikan stillzusitzen. Nach ein paar weiteren Konzerten mit solch kostenintensiven Bewegungen trennte sich Elvis schließlich von seinen goldenen Hosen und trug nur noch das goldene Jackett zu einer schwarzen Tuchhose.
Nach dem Konzert in Chicago rannten Elvis, Gene, Arthur und ich an der Union Station den Bahnsteig entlang, um den Spätzug nach St. Louis zu erwischen, als wir bemerkten, dass uns einige Typen verfolgten. Das jagte uns einen gewaltigen Schrecken ein, denn Elvis hatte schon häufig Ärger mit eifersüchtigen Kerlen gehabt. Einmal saß ich bei ihm im Auto, als ein Typ ans Fahrerfenster herantrat, Elvis um ein Autogramm bat und dann nach ihm schlug (der Schlag ging zwar daneben, traf aber das Mädchen, das Elvis an jenem Abend ausführte). Wir versuchten daher, noch ein bisschen schneller zu rennen, um den Zug zu erreichen. Da hörten wir, wie eine Stimme rief: »Elvis! Humes High, Abschlussklasse 1953! Albert Teague, Ed Leek und Bobby Bland!«
Wir blieben wie angewurzelt stehen – das waren unsere alten Klassenkameraden. Die Jungs holten uns ein und erzählten uns wenige Augenblicke, bevor wir den Zug besteigen mussten, dass sie nach der Schule allesamt nach Chicago gezogen seien. Sie hatten gehört, dass Elvis in der Stadt gastierte, hatten das Konzert besucht und dann beschlossen, uns abzupassen, was ihnen nun auch gelungen war. Ed Leek ließ Elvis wissen, dass er noch einen wertvollen Gegenstand besaß, den Elvis ihm einmal gegeben hatte – eine Azetatpressung von »My Happiness«, dem allerersten Song, den Elvis beim Memphis Recording Service aufgenommen hatte. Es war eine Aufnahme, für die er noch hatte bezahlen müssen. Elvis hatte Ed die Platte geliehen, damit dieser sie zu Hause seiner Großmutter vorspielen konnte, und sie nie zurückverlangt.
»Behalte sie«, sagte Elvis. »Bewahr sie für mich auf.«
Damit bestieg er den Zug, verließ die Stadt und sah keinen dieser Jungs jemals wieder (Ed Leek allerdings hielt die Azetatpressung in Ehren – ein Stück Musikgeschichte, das Sam Phillips einmal »die Mona Lisa der Aufnahmen« nannte).
In St. Louis bekam ich einen weiteren Eindruck von der Verrücktheit des Rock’n’Roll. Dort wohnten wir in einer Hotelsuite mit drei nebeneinanderliegenden Zimmern – eines für Arthur und mich, eines für Gene und Elvis und dazwischen eines als Aufenthaltsraum. Am Nachmittag vor dem Konzert betraten Gene und ich den Fahrstuhl in der Eingangshalle, als sich eine sehr forsche Reporterin und ein Fotograf zu uns gesellten.
»Welches Zimmer hat Elvis?«, fragte die Dame.
»Keine Ahnung«, entgegnete Gene.
»Sind Sie nicht sein Cousin?« Sie hatte ihre Hausaufgaben gemacht.
»Hm, ja«, sagte Gene.
»Also, welches Zimmer hat er?«
»Weiß nicht.«
»Hier sind fünfzig Dollar für Sie.«
»Elvis hat Zimmer 730«, sagte Gene.
Gene war jedoch ein bisschen durchtriebener, als man auf den ersten Blick vermutete. Er hatte das Geld genommen und ihnen einfach meine Zimmernummer gegeben. Ein paar Minuten später klopfte es also an meiner Tür. Es waren wieder die Reporterin und der Fotograf.
»Wo ist Elvis?«, fragte sie, während sie sich ins Zimmer drängte. Der Fotograf begann, eine Aufnahme nach der anderen zu schießen.
»Hier jedenfalls nicht – und jetzt raus aus meinem Zimmer«, schrie ich.
Die Reporterin sah sich noch ein wenig um, und der Fotograf machte Bilder von meiner Wäsche, doch bald wurde ihnen klar, dass sie Elvis nicht antreffen würden. Sie machten sich davon, schimpfend, weil wir sie um 50 Dollar geprellt hatten.
An jenem Abend im Kiel Auditorium bereiteten wir uns gerade auf das Konzert vor, als ein Bursche vom Sicherheitsdienst hinter die Bühne kam, der nach »George Klein« suchte. Ich gab mich zu erkennen, und er sagte, am Eingang sei jemand, der mich suche. Ich konnte mir nicht denken, wer in St. Louis nach mir fragen sollte, aber ich folgte dem Sicherheitsmann bis zum Eingang. Dort stand tatsächlich dieser große Marinesoldat, der Elvis nach unserem Erlebnis auf der Main Street in Memphis vor Gericht gebracht hatte. Er hatte ein Grinsen im Gesicht und einen Arm um seine Frau gelegt.
»Hallo, Sir«, sagte er. »Erinnern Sie sich an mich?«
»Äh – ja, das tue ich.«
»Nun, besteht die Chance, dass Herr Presley uns ins Konzert hineinlässt?«
»Warum lassen Sie mich das nicht rasch mit Elvis und dem Colonel abklären«, sagte ich zu ihm und ging wieder zurück in den Backstage-Bereich. Als ich Elvis berichtete, wer da stand und um Freikarten bat, explodierte er förmlich.
»Was??«, schrie er so laut, dass ich einen Satz machte. »Der kann mich mal!!«
»Äh, was soll ich ihm denn nun sagen, Elvis?«
»Geh einfach nicht mehr zurück, und sag ihm gar nichts. Lass ihn einfach mit seiner Frau, um die er sich ja solche Sorgen macht, da stehen.«
Elvis war von Natur aus ein netter Bursche, der sich sehr bemühte, auch unter Stress stets freundlich zu bleiben. Aber auch er hatte seine Grenzen, und wenn er wütend wurde, verwandelte er sich in einen kampfeslustigen Tiger, mit dem man sich besser nicht anlegte.
Meine Hauptaufgabe auf der Tournee sollte es sein, Elvis Gesellschaft zu leisten und Konversation mit ihm zu machen, aber ich stellte sehr schnell fest, dass für beides in Wahrheit kaum Zeit blieb. Da Elvis auf früheren Tourneen ein paar kritische Landungen miterlebt hatte, wollte Frau Presley nicht, dass ihr Sohn mit dem Flugzeug von Stadt zu Stadt flog. Und wenn Frau Presley etwas sagte, war ihr Wort zumindest für Elvis Gesetz. In einer Zeit, als man noch keinen Tourbus mieten konnte, reisten wir daher mit der Eisenbahn, in Limousinen und Cadillacs. Wir erreichten eine Stadt, checkten im Hotel ein, gingen zum Konzertsaal, absolvierten den Auftritt, schmissen eine Party im Hotel, verließen die Stadt – und dann begann das Ganze wieder von vorn. Manchmal beklebten wir die Wagenfenster einer Limousine mit Zeitungspapier, um den Rücksitz soweit zu verdunkeln, dass sich Elvis ausstrecken und ein wenig schlafen konnte. Es gab kaum einen Augenblick Freizeit, und ich gewöhnte mich daran, die Städte an ihren Hotelhintereingängen und den Gassen hinter den Konzerthallen zu erkennen.
Den Bandmitgliedern machte es nichts aus zu fliegen, was einer der Gründe dafür war, dass wir getrennt reisten. Doch selbst, wenn wir in eine Stadt kamen, stiegen sie in einem anderen Hotel ab als wir. Das erschien mir doch ein wenig seltsam, weil zwischen Elvis und seinen Musikern eine echte Freundschaft bestand. Anfangs hielt ich es für eine von Colonel Parkers Ideen, doch sowohl Scotty als auch D.J. beteuerten, sie selbst hätten um getrennte Quartiere gebeten. Erstens hielt ihnen das den Colonel vom Leib. Zweitens bedeutete es aber auch, dass die Bandmitglieder in ihrem Hotel immer die großen Stars waren. Wenn Elvis dabei war, waren sie nur Begleitmusiker. Ich erinnere mich auch, dass Scotty sagte, nach seinem Geschmack werde in Elvis’ Hotel nicht ordentlich genug auf die Pauke gehauen.
»Glaub mir, GK«, sagte er. »Unsere Situation ist eine ganz andere. Wir lassen am besten einfach alles so, wie es ist.«
Im weiteren Verlauf der Tournee flogen die Städte, Züge, Limousinen, Hotels, Konzerte und Partys nur so an uns vorüber. In Fort Wayne trat Elvis in einer Hockey-Arena auf –etwas für uns derart Fremdes, dass uns der Wachdienst erklären musste, wofür die hohen Wände am Spielfeldrand gut seien. In Detroit legte Elvis einen neuen Umgang mit der Presse an den Tag: Entgegen all meinen guten Ratschlägen als Reisebegleiter ließ er sich mit einer hübschen jungen UPI-Reporterin ein (der Name dieser Reporterin, die später eine renommierte Restaurant-Kritikerin wurde, war Gael Greene). In Buffalo im Bundesstaat New York erhielten wir unsere erste Bombendrohung – ein weiterer neuer Begriff für uns –, beendeten das Konzert jedoch, ohne dass irgendetwas in die Luft flog. In Toronto sah ein Mountie Elvis und mich belustigt an, als wir ihn fragten, wer denn die Dame auf dem großen Bild sei, das in den Maple Leaf Gardens hing.
»Das ist die Königin von England, Sir«, entgegnete er.
Naja, wir hatten eben noch nie ein Bild von ihr gesehen.
Ich sollte noch eine weitere Pflicht erwähnen, die mir auf Tournee mit Elvis oblag. Er sagte, ich sei der »beste Redner« der Gruppe – ein Titel, der neben Gene Smith und Arthur Hooton nicht schwer zu verteidigen war. Als bester Redner jedoch musste ich auf Elvis’ Wunsch hin in der Pause ins Publikum gehen, die hübschesten Mädchen ausfindig machen und sie zu einer Party in unserem Hotel einladen.
Das war ein Teil meines Jobs, den ich in vollen Zügen genoss. Abend für Abend war es das gleiche Spiel: Ich ging auf eine Gruppe hübscher Mädchen zu und sagte, »Na, wie geht’s?« Sie sahen mich an, als wäre ich verrückt. »Ich gehöre zu Elvis Presley, und wir wollen nach der Show noch ein bisschen im Hotel feiern. Wenn ihr in der Empfangshalle auf mich wartet, nehme ich euch mit nach oben zur Party.« Sie hielten mich immer noch verrückt. Damals hatten wir noch nicht diese großen laminierten Backstage-Pässe, die man um den Hals trägt. Wir hatten nur ein kleines rotes oder goldenes Band, auf dem »Elvis Presley Show« stand und das man an Hemd oder Jackett befestigte. Ich zeigte den Mädchen mein Band und sagte: »Augenblick noch – schaut mal her. Ich gehöre zu Elvis Presley.«
Die übliche Antwort lautete: »Jeder könnte sich so was besorgen. Hau ab!«
Dann griff ich auf meine Geheimwaffe zurück. Ich zog meine Brieftasche und nahm ein paar Fotos heraus, die Elvis und mich gemeinsam zeigten.
»Na gut, dann seht euch das mal an.«
Dann sagten die hübschen Mädchen: »Mensch, das bist ja du. Mit Elvis!!«
»Genau. Wie ich schon sagte – kommt nach dem Konzert ins Hotel, und ich hole euch dann in der Empfangshalle ab.«
Abend für Abend warteten diese hübschen Mädchen auf mich in der Hotellobby. Ich führte sie hinauf zu Elvis’ Zimmer. Dort stieg dann die Party – jene Art von Party, bei der es meistens ein wenig wilder und ausschweifender zuging. Wir tranken nicht nur Pepsi und sangen gemeinsam Lieder …
Selbst unterwegs dachten wir oft an Mädchen. Ich erinnere mich noch an eine Zugfahrt, bei der unser Schlafwagenabteil neben dem einer sehr attraktiven Frau lag. Die Abteile in diesem Zug waren durch bewegliche Wände voneinander getrennt, so dass zwischen dem Fußboden und der Wand ein guter Zentimeter Platz war. Der gute alte Cousin Gene kam auf eine, wie er dachte, ganz schlaue Idee: Er nahm ein Buttermesser, polierte es, hielt es in einem bestimmten Winkel unter den schmalen Spalt und behauptete, er könne der Frau nun beim An- und Ausziehen zusehen. Also lagen wir schließlich alle auf dem Boden unseres kleinen Schlafabteils. Ehrlich gesagt, konnte ich überhaupt nichts sehen. Aber ich versuchte es, und Elvis ebenfalls.
»Kannst du was sehen, Cuz?«, fragte Gene, als Elvis sein Glück versuchte.
»Ich sehe ein Buttermesser«, sagte Elvis.
Das letzte Konzert der Tour fand in Philadelphia statt. Dort wurde Elvis zu einer Art unfreiwilliger Zielscheibe. Während des Auftritts wollte er gerade »Don’t Be Cruel« anstimmen, als ein Kerl in einem Trenchcoat ein Ei auf die Bühne warf. Das Ei verfehlte Elvis zwar, traf stattdessen aber die Gitarrensaiten von Scotty Moore und erzeugte durch seinen Verstärker einen äußerst komischen Klang. Der Eierwerfer machte kehrt und versuchte davonzulaufen, kam aber nicht besonders weit: Die jungen Mädchen im Publikum schlugen ihn mit Handtaschen und Fäusten und allem, was ihnen gerade in die Finger kam.
Am folgenden Tag erfuhren wir, dass der Eierwerfer ein College-Schüler war, der kurz vor dem Rauswurf durch die Schulleitung stand. Außerdem wollte auch die Polizei Anklage gegen ihn erheben. Beide Stellen fragten Elvis, wie er vorgehen wolle.
»Das ist nur so ein verdammter College-Halbstarker«, sagte er zu uns. »Der Junge wollte der Kerl sein, der ein Ei auf Elvis Presley wirft. Da werde ich keine Anklage erheben.«
Obendrein wies er den Colonel an, mit der College-Leitung zu reden, denn er wollte nicht, dass man den Jungen der Schule verwies. Wieder einmal war ich verblüfft, wie es Elvis fast immer gelang, höflich und fair zu bleiben – ganz egal, was auf ihn zukam, und seien es Eier.
Freilich schlummerte unter der Oberfläche ein leicht reizbarer Charakter. Als wir nach der Tournee wieder zurück in Memphis waren und ein wenig Zeit hatten, bis Elvis wieder nach Hollywood abreiste, bekam er Besuch von Yvonne Lime, einem Starlet, mit dem er sich während der Dreharbeiten zu Loving You getroffen hatte. Elvis wollte sie ein bisschen in Memphis herumführen und einen Abstecher nach Graceland machen, das von den Presleys gerade renoviert wurde. Eines Tages beschloss Elvis, Yvonne zu einem typischen Südstaaten-Freizeitsport mitzunehmen – auf die Schlangenjagd. Auch Arthur Hooton und ich waren mit von der Partie. Wir fuhren zu einem etwa 15 Meilen südlich von Graceland gelegenen See jenseits der Staatsgrenze zu Mississippi. Es war ein wunderschöner Frühlingstag, und wir hatten richtig viel Spaß. Elvis hatte ein Gewehr dabei und übernahm das Jagen allein, so dass Arthur und ich etwas Zeit mit Yvonne verbrachten. Bei unserem Spaziergang durch den dichten Wald, der den See umgab, verloren wir einander immer wieder aus den Augen. Irgendwann tauchte Arthur plötzlich hinter Yvonne auf und umarmte sie spielerisch. Sie erschrak, kreischte kurz auf und brach dann in schallendes Gelächter aus. Arthur hatte jedoch nicht gesehen, dass sich Elvis ihnen von hinten genähert hatte.
Auf einmal hatte Elvis seine Waffe an Arthurs Kopf und sagte: »Wenn du das noch einmal machst, blase ich dir deine verdammte Birne weg!«
Ich hatte ihn noch nie so reden hören, nicht mit jemandem, den er gut kannte. Arthur war ein gutherziger Kerl und hatte sich bei der kleinen Umarmung nichts gedacht. Auf gar keinen Fall wollte er Elvis’ Mädchen ernsthaft den Hof machen.
»Elvis …«, begann ich und versuchte, die Lage zu entschärfen.
»Halt den Mund«, knurrte er.
Ich stand da und scharrte mit den Füßen, Yvonne war sprachlos, und Arthur begann sich so heftig zu entschuldigen, dass er den Tränen nahe war. Schließlich ließ Elvis von ihm ab und senkte die Waffe, doch seine gute Laune kehrte nicht mehr zurück. Der Rest des Tages war höchst unerfreulich, und der Weg zurück nach Memphis erschien unerträglich lang.
Das war das erste Mal, dass ich Elvis in wirklich schlechter Stimmung erlebte. Ich glaube, es traf mich hart, weil ich so viel Zeit mit ihm verbracht und gesehen hatte, wie er Erstaunliches leistete und viele verrückte Situationen mit Bravour meisterte. Nun tat er etwas Niederträchtiges, das nur bewies, dass auch er ein ganz normaler Mensch war, aber für mich war es wie ein Schock. Es gab keine Entschuldigung dafür, Arthur derart Angst einzujagen. Ich stellte fest, dass wir Elvis zwar als außergewöhnlichen Menschen betrachteten, er sich selbst jedoch nicht so sah. Er liebte den Ruhm und das Geld, die ihm seine Karriere einbrachten. Aber tief in seinem Innern war er immer noch der Typ, der von den anderen, beliebteren Jungs an der Humes High gehänselt worden war.
Ein paar Monate später war ich an einem Abend im April wieder am Audubon Drive. Es war kurz vor unserer Abreise nach Kalifornien, wo Elvis mit den Dreharbeiten zu seinem nächsten Film beginnen wollte, der den Arbeitstitel Jailhouse Kid trug. An jenem Abend bekam Elvis Besuch von Freddy Bienstock, seinem Verbindungsmann zum Musikverlag Hill and Range, welcher Elvis regelmäßig mit neuen Songs für seine Aufnahmen versorgte. Freddy hatte einen Stapel Azetatplatten mit Demo-Songs dabei, die möglicherweise in dem neuen Film Verwendung finden könnten. Später erfuhr ich, dass die Produzenten die Stellen in Elvis’ Filmskripts kennzeichneten, an denen Songs platziert werden sollten. Die Skripts wurden dann an eine Reihe von Songschreibern verschickt, die sich etwas auszudenken versuchten, das zu den Szenen passte und für Elvis geeignet war. Unter anderem hatte Freddy Demos mit verschiedenen Versionen der heißesten Rock’n’Roll-Nummer des gesamten Films dabei: »Jailhouse Rock«.
Ich saß mit Elvis zusammen, während er einige der Demos auf seinem Plattenspieler anhörte. Bei den ersten paar Songs nickte er zwar, doch nichts davon begeisterte ihn wirklich. Dann legte er eine Platte mit einer Nummer von Mike Stoller und Jerry Leiber auf, zwei der gefragtesten jungen Songschreiber der damaligen Zeit. Selbst als Demoversion riss uns der Song vom Hocker.
»Verdammt, Elvis«, sagte ich. »Little Richard würde seinen rechten Arm für so etwas geben.«
»Ja, aber er kriegt es nicht«, sagte Elvis. »Ich werde das Ding aufnehmen.«
Während Elvis’ Tournee war für Kameradschaft nicht viel Zeit geblieben. Doch als Elvis, Gene, Arthur und ich an der Central Station in Memphis den Zug Richtung Westküste bestiegen, war das eine völlig andere Sache. Der Trip sollte drei volle Tage dauern. Diesmal ließ Elvis mich an Stelle von Gene in seinem Abteil reisen. Er hatte eine ganz besondere Aufgabe für mich im Sinn – er wollte gemeinsam mit mir an seinem Skript zu Jailhouse Kid arbeiten.
Es ist wichtig zu erwähnen, wie hart Elvis an allem arbeitete, auch an seinem Profil als Schauspieler. Er war als Star bekannt genug, dass man es ihm verziehen hätte, wenn er faul oder schwierig gewesen wäre, und ich glaube, dass Hollywood zunächst auch nichts anderes von ihm erwartete. Doch von Beginn der Dreharbeiten zu Love Me Tender an achtete Elvis stets darauf, dass er sein Skript in- und auswendig kannte. Er erschien immer pünktlich und gut vorbereitet am Set.
Als die Reise begann, las ich Elvis also die Texte sämtlicher anderer Figuren in dem Film vor, damit er seinen Part lernen konnte. (Als ich entdeckte, dass es in dem Film auch die Rolle eines Diskjockeys gab, dachte ich, dass ich sie übernehmen könnte, doch die Rolle ging schließlich an den Schauspieler Dean Jones.) Es war das erste Mal seit längerer Zeit, dass ich allein mit Elvis Zeit verbrachte. Wir saßen uns in dem engen Schlafwagenabteil gegenüber und arbeiteten an dem Skript. Wenn wir fertig waren, entspannte sich Elvis und unterhielt sich mit mir auf einer viel persönlicheren Ebene als bisher. In nur wenigen Jahren hatte sich in seinem Leben so viel verändert, dass er wahrscheinlich einfach froh war, mit jemandem, dem er vertrauen konnte, offen über dieses und jenes zu sprechen.
»Weißt du, warum ich meine Haare färbe, GK?«, fragte er, als er das Skript weglegte.
»Warum, Elvis?«
»Die blonden Typen machen es in Hollywood nicht lange«, sagte er. »Die Kerle mit dunklem Haar und dunklerem Aussehen – Clark Gable, Tony Curtis, Brando – haben bessere Karrierechancen.«
Elvis erzählte mir, dass man in der Maske bei Paramount sein Haar gefärbt hatte, um seine blauen Augen besser zur Geltung zu bringen. Er hatte um einen möglichst dunklen Ton gebeten, und war mit dem Ergebnis so zufrieden gewesen, dass er diesen Look nicht nur auf der Leinwand beibehielt – er begann, sein Haar nun regelmäßig zu färben.
Am zweiten Abend der Reise ging ich mit Elvis wieder das Skript durch. Wir gelangten zu einer der Schlüsselszenen zwischen Elvis’ Rolle, Vince Everett, und Vinces ehemaligem Knastkumpel und jetzigem Rivalen Hunk Houghton, im Film dargestellt von Mickey Shaughnessy. Ich hatte gerade eine von Hunks heftigeren Passagen gelesen und wartete auf Elvis’ Antwort. Er blickte jedoch nur aus dem Zugfenster, wo die Lichter an uns vorbeirasten, und ließ langsam sein Manuskript sinken.
»Ich frage mich, was sie jetzt wohl denken, GK«, sagte er leise.
»Wer, Elvis?«
»Die ganzen Typen, die mich abgelehnt haben und mir weismachen wollten, ich tauge zu gar nichts. Diese ganzen Leute, die immer sagten, ich hätte es nicht drauf und würde nie etwas aus mir machen.«
»Du hast eine ganze Menge durchstehen müssen, bevor du dorthin gelangt bist, wo du jetzt bist, Elvis.«
Er blickte mich mit einem dünnen Lächeln durchdringend an. »Eddie Bond, Mann. Eddie Bond.«
Bond war ein Country-Diskjockey aus Memphis, der nebenberuflich in einer Country-Band spielte. Im Jahre 1954 hatte seine Band einen Sänger gesucht, und Elvis hatte sich um den Posten beworben.
»Er sagte zu mir: ›Du bringst es einfach nicht‹«, sagte Elvis. »Hat mir fast das Herz gebrochen.«
Elvis fuhr fort und erzählte, wie er mit Scotty und Bill in der Grand Ole Opry aufgetreten war. Er hatte sich dieses Konzert so sehr gewünscht, dass Sam Phillips ihm schließlich geholfen hatte, den Auftritt zu organisieren. Sie spielten »Blue Moon Of Kentucky«, und das Publikum applaudierte höflich. Hinterher teilte Jim Denny, der langjährige Talentmanager der Opry, Elvis mit, er glaube einfach nicht, dass Elvis der richtige Künstler für diese legendäre Bühne sei.
»Der gleiche Dreck«, sagte Elvis. »Er sagte, ich solle lieber weiter Laster fahren. Und wir dachten schon, wir seien auf einem guten Weg. Das hat mich ganz schön umgehauen.«
Er erzählte mir von einem entmutigenden Vorspiel für die Fernsehshow von Arthur Godfrey – einer Sendung, die 1955 ein echtes Karrieresprungbrett war. Dort hatte man über ihn und die Band nur gekichert, und sie hatten Godfrey nicht einmal persönlich getroffen. Man sagte Elvis, er solle nicht auf einen Anruf warten; falls er es in die Sendung geschafft habe, werde ein Brief geschickt. Elvis sagte, er sei einen Monat lang jedes Mal wütend und traurig geworden, wenn die Post kam und keine Nachricht von der Show für ihn dabei war.
Wir redeten und redeten und redeten noch ein bisschen mehr. Elvis ließ uns von Gene und Arthur etwas zum Abendessen bringen, und wir redeten weiter. Ich berichtete ihm von den Höhen und Tiefen meiner Karriere beim Radio, erzählte ihm Geschichten von Dewey Phillips und noch einige sehr persönliche Dinge über mich selbst, die ich, soweit ich weiß, noch nie mit jemandem geteilt hatte. Er erzählte mir mehr und mehr darüber, was ihm alles widerfahren war – und das war keinesfalls nur negativ. So erfuhr ich, dass es nach einem seiner Auftritte in der Ed Sullivan Show an der Tür seiner Garderobe geklopft habe. Er öffnete, und dort stand ein sinnliches Starlet aus Europa, das ihn an Stellen küsste, wo er noch nie geküsst worden war.
»Ich weiß nicht, wie man das nennt, was sie tat«, sagte Elvis. »Aber ich wehrte mich nicht dagegen.«
Als wir uns wieder einer etwas ernsthafteren Diskussion über unsere Karrieren zuwandten, erzählte er mir, er sei besonders stolz darauf, dass er bei seinem Wechsel von Sun zu RCA seinen gemeinsam mit Sam Phillips entwickelten Stil verteidigt habe.
»Sam gab mir den besten Rat, den ich je bekam«, sagte Elvis. »Er sagte: ›Was immer du tust und wo immer du auch hingehst, lass sie nicht deinen Stil verändern.‹ Er sagte, wenn ich nach Nashville ginge, müsse ich mich vor den Country-Typen in Acht nehmen, weil sie meine Musik hassten und nichts mit mir anzufangen wüssten. Sam sagte: ›Lass dich von ihnen nicht in eine Country-Schublade stecken. Ich werde nicht da sein, und der Colonel wir nicht begreifen, wovon ich hier rede. Du musst deinen Stil schon selbst verteidigen.‹ Er hatte Recht.«
Elvis fuhr fort und erzählte, dass die Band bei der ersten Session in Nashville mit Chet Atkins zusammengearbeitet habe – einem legendären Country-Gitarristen, der auch als Plattenproduzent tätig war. Als sich die Band aufgewärmt hatte und die erste Nummer anstimmte, wandte sich Chet Atkins an Scotty Moore und gab ihm ein paar freundliche Tipps zu seinem Gitarrenspiel. Scotty fühlte sich geschmeichelt, weil ihm »Mr. Guitar« sozusagen eine Privatstunde gab. Atkins Tipps waren bestimmt gut, aber Elvis erinnerte sich an das, was Sam ihm eingebläut hatte.
»Ich dachte nur: ›Scheiße, da ist sie schon, die Schublade.‹ Ich musste meinen ganzen Mut zusammennehmen, aber ich tat es.«
»Was denn, Elvis?«
»Ich ging hin zu ihm und sagte: ›Herr Atkins, wir schätzen Ihren Rat, aber wir haben unseren eigenen Stil, und daher wäre es mir lieber, wenn Sie unserem Gitarristen nicht sagten, wie er spielen soll.‹«
»Was geschah dann?«
»Nun, ich weiß, dass Atkins ein bisschen eingeschnappt war, weil ich sah, wie sich die Haare in seinem Nacken aufstellten«, lachte Elvis. »Aber ich musste es tun. Ich musste mich wehren. Es fiel mir nicht unbedingt leicht, aber ich musste es einfach tun. Meine Karriere stand auf dem Spiel.«
»Hast du Chet Atkins seither wiedergesehen?
»Ja, aber wir reden nicht viel miteinander«, antwortete Elvis. »Wir nicken uns meistens nur zu.«
Elvis und ich unterhielten uns die ganze Nacht hindurch. Ich erinnere mich noch, dass er mir sagte, er hasse Streicher auf Rock’n’Roll-Platten und sei nicht gerade glücklich darüber, dass Marty Robbins »That’s All Right« aufnahm, nachdem er es ihm in der Garderobe der Grand Ole Opry beigebracht habe. Er sprach über seine Liebe zur Gospelmusik, und wir tauschten Erinnerungen an die Tage auf den Memphis Fairgrounds aus.
Irgendwann auf der Zugfahrt nach Hollywood ergab sich zwischen mir und Elvis eine neue Beziehungsebene. Ich hatte ihn stets als hoffnungsvollen Star betrachtet, mit dem ich zufällig befreundet war. Jetzt kam es mir umgekehrt vor: Der beste Freund, den ich je hatte, war zufällig Elvis Presley.