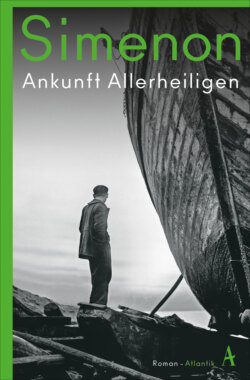Читать книгу Ankunft Allerheiligen - Georges Simenon - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
4
ОглавлениеSie gingen in der Abenddämmerung, die von fahlen Lichtern durchsetzt war, am Quai entlang, seine Tante Éloi und er. Gérardines Aufregung glich der einer Mutter am ersten Schultag ihres Sohnes. Seit dem Mittag konnte sie nicht mehr stillsitzen. Sie hatte die beiden Dienstmädchen mit ihren Töchtern in das Haus am Quai des Ursulines vorausgeschickt. Und danach fiel ihr jede Stunde noch etwas ein, sie telefonierte mit einem Lieferanten oder schickte den Laufburschen zu einer Besorgung.
»Es wäre so viel einfacher gewesen, mein armer Gilles, wenn Sie bei uns wohnen würden!«
Die beiden überquerten einen Kanal, der ins Hafenbecken mündete. Ein friedlicher, sehr breiter Quai mit kleinen runden Pflastersteinen nahm hier seinen Anfang, und vor dem Laden eines Weingroßhändlers waren dutzendweise Fässer nebeneinandergereiht.
Es war der Quai des Ursulines, wo Gilles von nun an wohnen sollte. Und diese düsteren Umrisse im Halbdunkel waren die Cars Mauvoisin, die man auch die »Grünen Busse« nannte und die einer nach dem andern alle Dörfer der Gegend anfuhren.
Leute standen da, mit Paketen oder Körben beladen. Gepäckstücke wurden auf den Wagendächern aufgetürmt. Alles geschah in einem merkwürdigen Halbschatten, denn der Quai war nicht beleuchtet, und man erkannte kaum die gelblichen Scheinwerfer der Autobusse; umso deutlicher sah man ihr rotes Rücklicht, das von weitem an die Glut einer riesigen Zigarre erinnerte.
Es war feucht und kalt; Tante Éloi fürchtete, dieses Treiben in der klammen Kühle mache einen unangenehmen Eindruck auf Gilles.
»Sie werden sich nicht um die Busse zu kümmern brauchen … Das Geschäft läuft gewissermaßen von selbst … Da ist ein Geschäftsführer, so ein richtiger Antreiber … So was braucht man, um diese Leute auf Trab zu halten …«
Ein riesiges Gebäude direkt am Quai. Es war eine ehemalige Kirche. Die Tür stand weit offen, und das Innere diente den Mauvoisin-Bussen als Bahnhof. Rechts, in einem verglasten Verschlag, Fahrkartenschalter. Darin ein Mann mittleren Alters mit Ärmelschonern und dichten Augenbrauen, unter denen sich gutmütige, furchtsame Augen versteckten.
Überall Kisten, Fässer, Landwirtschaftsgeräte, die je nach dem Bestimmungsort an dem einen oder anderen Pfeiler der ehemaligen Kirche standen, Motoren, die man anzuwerfen versuchte, zwei Lampen nur, mit grellem Licht, ohne Lampenschirm, die von dem früher heiligen Gewölbe herabhingen, Rauch, Benzingeruch und schließlich ein Mann auf kurzen Beinen, der Geschäftsführer, von dem Madame Éloi gesprochen hatte, der anstelle des linken Arms einen künstlichen hatte, der in einem harten Eisenhaken endete.
»Es ist besser, wenn Plantel Sie einander vorstellt. Gehen wir ins Haus …«
War es das ehemalige Bischofspalais? Gleich hinter der zu einem Autobusbahnhof umgebauten Kirche geriet man in völlige Dunkelheit. Das sehr alte Haus hatte zwei Flügel, einen gepflasterten Vorhof und ein Gittertor.
»Mauvoisin hat es nur gekauft, weil es dem Grafen gehörte, bei dem er angefangen hat …«
»Als was?«, fragte Gilles.
»Als Chauffeur … Es wird genügend böse Zungen geben, die Sie daran erinnern werden …«
Man sah Licht in den Fenstern im zweiten Stock, doch nur gedämpft. Gérardine betätigte ein feines Glöckchen wie ein Klosterglöckchen, und sie warteten lange, ohne dass jemand öffnen kam. Endlich öffnete eine kleine Alte ein Stück die Tür und wartete, ohne ein Wort zu sagen.
Sie grüßte weder Gilles noch Gérardine. Diese drehte selber den Lichtschalter im Flur an, während die Alte verschwand, kaum hatte sie die Tür wieder zugemacht.
»Sowie Bob aus Paris zurück ist, wird er sich mit Ihnen darum kümmern, das Haus in Ordnung zu bringen … Er hat viel Geschmack … Mauvoisin lebte nicht wie andere Leute …«
Sie öffnete einige Türen. Die riesigen Zimmer waren seit langem nicht mehr geheizt worden und stockten. Mauvoisin hatte das Haus eingerichtet gekauft und sich nicht die Mühe gemacht, auch nur ein Nippes oder ein Bild zu verrücken.
Der Salon hätte als Tanzsaal dienen können: goldfarbene Sessel entlang den Wänden und an der Decke ein Kristallkronleuchter, der bei jedem Schritt klirrte.
»Es muss alles neu gemacht werden …«, seufzte Gérardine. »Gehen wir hinauf …«
Auch im ersten Stock gab es viel Bric-à-brac, herrschte Durcheinander. Was machte es Octave Mauvoisin schon aus, da er nur im zweiten Stock wohnte?
»Seid ihr da, Kinder?«
Louise zeigte sich im Kopftuch auf dem Treppenabsatz, denn die beiden Töchter Gérardines hatten den Dienstmädchen, die sie von zu Hause mitgebracht hatten, beim Reinemachen geholfen.
Noch einen Augenblick, und Gilles wäre endlich allein! Es kribbelte ihm in den Fingerspitzen. Schwindel hatte ihn erfasst. Er bekam nichts mehr mit.
War es nicht seltsam, dass Mauvoisin, der reiche Mauvoisin, wie man den Busbesitzer nannte, sich in diesem Palais eine Kleine-Leute-Wohnung eingerichtet hatte? Es hieß, er habe die Möbel seiner Eltern mitgebracht. Im Esszimmer standen ein runder Tisch, ein Buffet im Henri-III-Stil und lederbespannte Stühle mit dicken Messingnägeln.
Als Frau, die das Inspizieren gewohnt war, stellte Madame Éloi fest, dass alles in Ordnung war und dass man die Blumen, die sie hatte herschicken lassen, auch wirklich in Vasen gestellt hatte.
»Seid ihr fertig, Kinder? Sehen wir uns das Schlafzimmer an …«
Es war das Schlafzimmer des Onkels. Früher war es das Schlafzimmer seiner Eltern in Nieul-sur-Mer gewesen. Ein Bauernbett aus Mahagoni. Ein durchgesessener Sessel. An der Wand zwei Bilder in ovalen Rahmen, ein alter Mann und eine alte Frau mit einer Haube, und Gilles war überrascht, als er sah, dass sein Großvater untersetzt und kräftig war, mit der mächtigen Kinnlade eines Holzfällers.
»Ich glaube, mein armer Gilles, wir werden …«
Sie vollendete ihren Satz nicht, tupfte sich die Augen mit ihrem Taschentuch, als müsste sie ihren Neffen furchtbaren Gefahren aussetzen.
»Kommt, Kinder … Morgen früh werde ich vorbeikommen, um nach dem Rechten zu sehen.«
Ein Kuss wie ein Schnabelhieb auf Gilles’ Wangen.
Er war endlich allein, in einem Haus, das von nun an seines war!
Er war allein, hatte einen Kloß im Hals, und das Einzige, was ihn beruhigte, war das Klappern der Teller und Bestecke im Esszimmer nebenan, die beim Tischdecken aneinanderstießen.
Als er den dunklen Samtvorhang beiseiteschob, sah Gilles den düsteren Quai, einige Gaslaternen, eine hellere Dunstglocke dort, wo das Stadtzentrum lag, und schließlich, ganz in der Nähe, am Ende des linken Flügels des Hauses, auf demselben Stockwerk, wie er war, ein schwach erleuchtetes Fenster. Dort hielt sich seine Tante auf, die er noch nicht gesehen hatte.
Er wusste nicht, wie spät es war. Es kam ihm nicht in den Sinn, auf die Uhr zu schauen. Das Zimmer seines Onkels beeindruckte ihn. War es nicht seltsam, dass niemand ihm ein Bild dieses Onkels gezeigt hatte? Er wusste nicht, wie er sich Octave Mauvoisin vorstellen sollte. War er groß und ein wenig melancholisch wie Gilles’ Vater? Oder glich er eher dem handfesten Greis, dessen Foto über dem Bett hing?
Als die Alte, die ihm den unhöflichen Empfang bereitet hatte, gegen sieben Uhr an die Tür klopfte, erhielt sie nicht gleich Antwort. Die Stimme Gilles’ kam aus einem anderen Zimmer, hinter der Verbindungstür.
»Herein …«
Erstaunt trat sie näher, mit forschendem Blick, die Hände in die Seiten gestützt.
»Kommen Sie herein, Madame Rinquet … Man hat mir gesagt, dass Sie Madame Rinquet heißen … Sie sehen … Ich bin umgezogen … Ich habe dieses kleinere Zimmer entdeckt, und ich werde mich hier wohler fühlen …«
Sie bekundete weder Zustimmung noch Ablehnung. Sie begnügte sich damit zu sagen:
»Sie sind hier der Herr … Ich bin gekommen, um Sie zu fragen, um wie viel Uhr Sie das Abendessen serviert haben wollen …«
»Um wie viel Uhr bringen Sie es gewöhnlich auf den Tisch?«
»Um halb acht …«
»Na schön, es gibt keinen Grund, das zu ändern …«
Er hätte ihr gerne Fragen zu seinem Onkel gestellt, zu seiner Tante, aber er begriff, dass es noch zu früh war für vertrauliche Fragen.
»Dann werde ich Madame Bescheid sagen …«
Um fünf vor halb acht stand er im Esszimmer, erstaunt über seine eigene Aufregung. Es war warm. Die Einrichtung war heimelig. Gute Düfte kamen aus der Küche, wo man Madame Rinquet in ihren Filzpantoffeln hin und her schlurfen hörte.
Ein leichtes Knarren hinten im Flur, kaum vernehmbar, und doch zuckte Gilles zusammen und sah in Richtung Tür. Er beobachtete, wie sich der Türknauf bewegte. Die Tür ging auf.
Es wäre ihm wirklich schwergefallen, den Eindruck zu analysieren, den seine Tante auf ihn machte. Sie glich in nichts dem, was er sich vorgestellt hatte. Als sie hereinkam, waren ihre Blicke sich begegnet, doch sie hatte sogleich die Augen niedergeschlagen und anstelle eines Grußes lebhaft den Kopf geneigt.
Dann hatte sie auf die Gedecke gesehen, als wollte sie sich vergewissern, dass sich ihr Platz nicht geändert hatte. Sie hatte ihren Serviettenring wiedererkannt und war bei ihrem Stuhl stehen geblieben.
Auch er wagte nicht, sich hinzusetzen, und die Situation wäre lächerlich geworden, wenn nicht Madame Rinquet hereingekommen wäre mit einer dampfenden Suppenschüssel aus schwerem weißem Steingut.
Hatte Gilles guten Tag gesagt? Er konnte sich nicht mehr erinnern. Seine Lippen hatten sich jedenfalls bewegt. Er hatte sich in seinem Zimmer lange gefragt, ob er »Madame« oder »Tante« sagen solle.
Sie nahm sehr wenig Suppe. Er wagte es nicht, sich mehr zu nehmen oder das Brot zu verlangen, das zu weit weg von ihm stand und das sie ihm schließlich reichte.
Was ihn vielleicht am meisten erstaunte, war die Tatsache, dass sie so klein, so zierlich und so jung war. Nie zuvor hatte eine Frau einen so zerbrechlichen Eindruck auf ihn gemacht. Sie erinnerte ihn an einen Vogel, der kaum den Ast berührt, auf dem er sich niederlässt.
Ausgesprochen feine Züge, zarte Haut, durchschimmernd wie chinesisches Porzellan, blaue Augen und feine Fältchen an den Lidern. Allein diese Lider deuteten darauf hin, dass sie auf die dreißig zuging.
Er spürte, dass sie sich beobachtet fühlte und es sie Überwindung kostete, so zu essen. Also schaute er anderswohin, und bald war es Colettes Blick, der sich immer wieder schüchtern, flüchtig auf ihm niederließ.
Die ganze Mahlzeit verlief, ohne dass ein Wort gesprochen wurde. Am Ende hatte Gilles einen hochroten Kopf. Er hatte sich eine kleine Rede zurechtgelegt, doch er tat sich damit genauso schwer wie mit den ersten Neujahrsglückwünschen, die er als Dreijähriger seinen Eltern aufgesagt hatte.
»Madame … Tante … Ich möchte Sie bitten, dass … meinetwegen … die Dinge sich im Haus nicht ändern … Ich bitte Sie um Entschuldigung, dass ich Sie …«
Sie hatte die Stirn gerunzelt. Mit leicht geneigtem Kopf – er hatte schon bemerkt, dass es eine Gewohnheit bei ihr war, wie bei Frauen, die viel gelitten haben – murmelte sie:
»Sie sind hier zu Hause, nicht wahr?«
Sie stand auf. Sie ließ einige Sekunden verstreichen, aus reiner Höflichkeit.
Dann verabschiedete sie sich mit einem Kopfnicken.
»Guten Abend, Monsieur …«
Er hätte sie gerne zurückgehalten. Den ganzen Abend über machte er sich Vorwürfe, dass er es nicht getan hatte. Er hatte das Gefühl, dass einige Worte, eine Gebärde genügt hätten …
Ohne ihn weiter zu beachten, räumte Madame Rinquet ab. Allerdings sagte sie zu ihm:
»Wenn Sie ausgehen sollten, nehmen Sie den Hausschlüssel mit, der am Eingang hängt. Das Gittertor wird nie abgeschlossen …«
Er hatte an diesem Abend den Eindruck, dass die Atmosphäre im Haus so drückend war, dass die kleinsten Bewegungen Wogen schlugen. Auch die Stille bedrückte ihn. Er hatte Madame Rinquet in die Mansarde hinaufgehen hören, wo sie sicherlich schlief. Sie war eine Zeitlang über seinem Kopf hin und her gegangen, dann hörte er das Quietschen einer Sprungfedermatratze.
Aber im hintersten Fenster des linken Flügels brannte immer noch Licht. Der Quai des Ursulines war menschenleer.
Wenn sich ein Passant hierherverirrte, hörte man noch lange seine Schritte hallen, dann irgendwo das Geräusch einer Tür, die auf- und wieder zuging.
Gilles hatte angefangen, sich auszuziehen. Auf eine Kommode hatte er wie gewöhnlich die Gegenstände gelegt, die er aus seinen Taschen nahm, und er hatte eine Weile den kleinen, flachen Schlüssel befühlt, den Notar Hervineau ihm mit feierlicher Geste überreicht hatte.
Was nutzte dieser Schlüssel, wenn er das Geheimwort nicht kannte, um den Tresor zu öffnen, der so unauffällig wie möglich in die Wand rechts vom Bett eingelassen war, über dem Nachttisch.
Er öffnete den Schrank, um einen Schlafanzug herauszuholen, zuckte zusammen, weil er das Geräusch eines Autos gehört hatte, das ganz in der Nähe des Hauses plötzlich verstummte.
Er stürzte ans Fenster, schob den Vorhang beiseite. Tatsächlich hatte ein Auto etwa fünfzig Meter weiter am Kanal gehalten. Die Scheinwerfer brannten noch, doch gleich erloschen sie, dann wurde die Wagentür zugeschlagen, und ein Mann ging schnell auf das Gittertor zu. Er öffnete es, durchquerte den Hof.
Gilles lief an die Tür. Der lange Flur lag im Dunkeln, es dauerte nicht lange, bis das Licht anging, während sich eine weibliche Silhouette zur Treppe begab.
Weshalb erregte er sich so? Hatte man ihm nicht gesagt, dass Colette seit Jahren einen Geliebten hatte und dass ihr Mann es wusste?
Es half nichts, er war ganz durcheinander, und nun löschte er das Licht in seinem Zimmer, um sich nicht zu verraten, und blieb im Türrahmen auf der Lauer.
Er hörte ganz deutlich, dass der Schlüssel, auf den Madame Rinquet ihn hingewiesen hatte, vom Nagel genommen und vorsichtig die Eingangstür aufgeschlossen wurde.
Dann herrschte Stille. Was taten sie dort unten? Lagen sie einander in den Armen?
Jetzt gingen sie hinauf. Der Teppich im Treppenhaus erstickte das Geräusch ihrer Schritte. Tante Colette erschien als Erste, die Hand des Mannes haltend, der ihr folgte, und sie warf einen Blick in Gilles’ Richtung, den sie nicht sehen konnte.
Die beiden Liebenden drehten ihm den Rücken zu und verschwanden schließlich im Flur des linken Flügels.
Er war viel zu aufgeregt, um sich zu besinnen. Wieso nur schlich er mit bloßen Füßen zur Tür seiner Tante? Er wusste, dass das Paar im Zimmer war. Was ging ihn das überhaupt an? Unter der Tür drang Licht hervor, und das Gemurmel, das man hörte, glich dem Geflüster, wie man es in der Nähe eines Beichtstuhls vernimmt.
Ich werde schlafen gehen …, nahm er sich vor.
Und doch blieb er, beunruhigt von dem Gedanken, dass er von einer Sekunde zur andern überrascht werden könnte.
Die Müdigkeit war schließlich stärker. Er hatte versucht, die Schläge der Kirchturmuhr von Saint-Sauveur zu zählen. Elf? Zwölf? Er war sich nicht sicher.
Er ging in sein Zimmer zurück, übermüdet, missgelaunt, von einer unerklärlichen Unruhe ergriffen, und warf sich auf sein Bett.
Er schlief nicht sofort ein. So wie früher, als er noch ein Kind war, zogen die Eindrücke des Tages an ihm vorüber, ja, sogar andere Bilder, das junge Mädchen und der junge Mann mit dem gelben Regenmantel, die kräftigen Beine Jajas und ihre schwarzen Wollstrümpfe, die von roten Schnüren gehalten wurden, seine Tante Éloi, die ihn ins Internat zu bringen schien …
Er war plötzlich traurig. Er hatte das Gefühl, dass er den Boden unter den Füßen verloren hatte und nun haltlos in einem unbekannten Universum trieb.
Das letzte Bild, das an seiner Netzhaut vorüberglitt, war das eines Clowns, dem er früher einmal in einem Zirkus in Ungarn begegnet war und der, wenn er für die Manege geschminkt war, ganz erstaunlich Notar Hervineau glich, bis hin zu der sarkastischen Stimme.
Er glaubte sich zunächst in einem Reich zwischen Traum und Wirklichkeit. Warum auch sollte man an seiner Tür lauschen, wo er doch allein war und schlief?
Er scheuchte das Bild des Clowns zurück und versuchte, dessen Stimme nicht mehr zu hören, um besser die leisen Geräusche, so leise wie das Trippeln einer Maus, wahrnehmen zu können.
Und plötzlich schnürte sich ihm die Kehle zusammen. Er war hellwach. Er hatte das Gefühl, dass ganz in seiner Nähe ein Mensch war. Etwas hatte sich bewegt, auf dem Marmor der Kommode hatte er das Kratzen eines Gegenstandes gehört.
Er hatte nie einen Revolver besessen. Er hatte Angst. Schweißgebadet in den Laken, fragte er sich, wo doch gleich der Lichtschalter war. Es gelang ihm nicht, sich daran zu erinnern.
Und überhaupt, was sollte er schon tun, wenn es ein Dieb war? Es war niemand im Haus, der ihm hätte zu Hilfe eilen können. Man konnte ihn in aller Ruhe umbringen … Er stellte sich einen langen Erstickungstod vor …
Er war sicher, absolut sicher, dass er nicht träumte, dass eine Tür aufgegangen war, wahrscheinlich diejenige zum Schlafzimmer seines Onkels.
Da war es um seine Vernunft geschehen. Er führte sich auf, als müsste er einen Angriff abwehren. Seine Arme, die in die Luft schlugen, trafen auf ein Hindernis, und es brach ein lautes Getöse aus.
Dabei war es nur die kleine opalfarbene Nachttischlampe, die seine Tante Éloi ihm von zu Hause mitgebracht hatte, weil er gesagt hatte, sie sei hübsch.
Der Lärm machte ihm eine solche Angst, dass er hochfuhr. Er sah einen Lichtschein unter der Tür.
Er vergaß jegliche Vorsicht. Er hatte zu große Angst. Er war von einem dunklen Wissensdrang besessen. Er ging auf die Tür zu und warf einen Stuhl um. Unwillkürlich rief er, weil er sich am Knie weh getan hatte:
»Au …«
Er war sicher, absolut sicher, dass er nicht träumte. Und dass genau in dem Augenblick, in dem er die Tür zum Zimmer seines Onkels öffnete, in diesem Zimmer noch Licht brannte, war ein Beweis dafür. Doch es verlosch sofort, und er hatte keine Zeit, etwas zu sehen. In der Dunkelheit hörte er Schritte und wie jemand gegen etwas stieß. Eine andere Tür, diejenige, die zum Flur führte, wurde heftig geschlossen.
Er verlor Zeit. Er sah nichts. Er war mit den Örtlichkeiten nicht vertraut genug, um sich im Dunkeln zurechtzufinden.
Als er den Flur erreichte, war niemand mehr da, aber dass die Lampen noch brannten, war der Beweis dafür, dass er sich nicht geirrt hatte.
»Wer ist da?«, fragte er, doch seine Stimme verhallte im Leeren.
Keine Antwort. Kein Geräusch.
»Wer ist da?«
Er ging mit großen Schritten zum linken Flügel hinüber. Er lauschte an der Tür seiner Tante. Er wagte nicht anzuklopfen.
Als er zurückging, enttäuscht, ängstlich, kam Madame Rinquet, die einen schwarzen Mantel übergeworfen hatte, aber barfuß war, die Treppe von der Mansarde herunter.
»Was ist los?«, erkundigte sie sich.
»Ich weiß nicht … Ich glaubte, ein Geräusch zu hören …«
Sie machte in Gilles’ Zimmer Licht, sah die Nachttischlampe in Scherben daliegen, den umgeworfenen Stuhl.
»Ich glaube, den Lärm haben Sie selbst gemacht … Schlafwandeln Sie öfter?«
Er antwortete nicht sofort. Mit aufgerissenen Augen starrte er auf die Kommode, wo von den Gegenständen, die er am Abend aus seinen Taschen geholt hatte, der Tresorschlüssel fehlte.
Deshalb stammelte er:
»Ich weiß nicht …«
»Soll ich Ihnen einen heißen Kräutertee machen?«
»Nein … danke …«
»Sind Sie jetzt beruhigt? … Kann ich wieder raufgehen, um mich hinzulegen? …«
Es gelang ihm, flüchtig zu lächeln.
»Ja … Ich bitte Sie um Verzeihung …«
Kaum war sie weg, lief er ans Fenster. Das Auto stand immer noch da, mit ausgeschalteten Scheinwerfern. Der Mann hatte das Haus offenbar noch nicht verlassen. In irgendeinem Winkel, vielleicht in Colettes Zimmer, wartete er wohl, bis Gilles eingeschlafen war.
»Immerhin liegt noch ein anderer Schlüssel bei der Banque de France …«, hörte er sich mit halblauter Stimme sagen.
Dann sagte er mehrmals hintereinander:
»Warum? … Warum? … Warum? …«
Er war genauso durcheinander wie an dem Abend, an dem er betrunken gewesen war. Seine Augenlider brannten. Er konnte nur mit Mühe die Tränen zurückhalten.
»Ich werde so lange am Fenster bleiben wie nötig! … Ich werde ihn sehen! … Ich werde es herausbekommen! …«
Doch er sah nichts, denn er wurde am Morgen in seinem Bett wach, in das er sich, trunken von Schlaf, geschleppt hatte.
Die ersten Morgenbusse des Transportunternehmens Mauvoisin fuhren aus der ehemaligen Kirche am Quai des Ursulines, doch das Auto des Unbekannten war verschwunden.