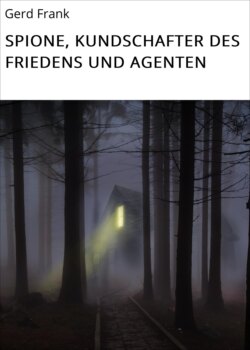Читать книгу SPIONE, KUNDSCHAFTER DES FRIEDENS UND AGENTEN - Gerd Frank - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
DIE SCHÖNE SPIONIN (MATA HARI)
ОглавлениеDie niederländische Tänzerin Margaretha Geertruida Zelle, die später unter dem Künstlernamen Mata Hari (1) weltberühmt geworden ist, wurde am 7. August 1876 in Leeuwarden geboren. In den Jahren ihrer Ehe trug sie auch die Namen Marguerite Campbell und Gretha MacLeod. Ihr Tarnname während ihrer Tätigkeit für den deutschen Geheimdienst war H-21.
Die Frau war vor und während des Ersten Weltkrieges als exotische Nackttänzerin aufgetreten, hatte den Ruf einer exzentrischen Künstlerin und wird als bekannteste Spionin aller Zeiten betrachtet. Am 25. Juli 1917 wurde 'Mata Hari' aufgrund von Doppelspionage und Hochverrat von einem französischen Militärgericht zum Tode verurteilt und am 15. Oktober 1917 in Vincennes hingerichtet.
Margaretha Zelle hatte noch drei jüngere Brüder und wurde in ihrer Kindheit nur Greet gerufen, was ihr allerdings nicht sonderlich gefallen haben soll (2) . Zunächst ging sie in die Leeuwarder Gemeindeschule, dann ab September 1890 recht unregelmäßig und mit geringem Erfolg in die 'Middelbare Meisjes School'.
Der Vater betrieb ein Hutgeschäft und war als Prahlhans und Verschwender bekannt. Er ließ sich gerne als 'Baron' titulieren, obgleich er von keiner adeligen Familie abstammte. Auch bei der Tochter scheint dieser Wunsch ausgeprägt gewesen zu sein; sie beantragte nämlich im Jahre 1908 beim Kabinett der Königin eine Änderung ihres Familiennamens Zelle-MacLeod in "van Zelle van Ahlden", was jedoch abgelehnt wurde. Auch ein zweites Gesuch, diesmal an die Königin selbst gerichtet, wurde nicht genehmigt. (3)
Als Margarethas Vater durch Börsenspekulationen Wohlstand erwarb, kaufte er ein altes Patrizierhaus; die verwöhnte Tochter bekam zu ihrem sechsten Geburtstag eine Kutsche, welche von Ziegen gezogen wurde. Die Leute erinnerten sich noch viele Jahre später an das "kleine Mädchen mit der dunklen Haut, den mandelförmigen Augen und dem schwarzen Haar auf dem Leiterwägelchen“ (4), das wie eine orientalische Prinzessin ausgesehen habe.
Ebenso schnell wie er reich geworden war, verarmte der Vater wieder: Aufgrund von diesmal verlustreichen Börsenspekulationen wurde er insolvent und musste das repräsentative Domizil aufgeben und eine simple Stadtwohnung mieten. Die Ehe der Eltern wurde nur deshalb nicht geschieden, weil die Mutter plötzlich an Tuberkulose verstarb. (5) Margarethas Vater verzog nach Amsterdam, wo er als Handelsreisender arbeitete und erneut heiratete.
Die Großmutter mütterlicherseits nahm die Kinder in Pflege; Margaretha kam ins Haus ihres Patenonkels, der mit einer Schwester ihres Vaters verheiratet war. Nach seinem Wunsch sollte die junge Frau zur Kindergärtnerin ausgebildet werden, was ihr jedoch nicht sonderlich zusagte. Sie brach die Ausbildung schnell ab und ging dann nach Den Haag. Dort weckte eine Zeitungsanzeige ihr Interesse: „Officier met verlof uit Indië (6) zoekt meisje met lief karakter met het doel een huwelijk aan te gaan“ (Offizier, auf Urlaub aus Indonesien, sucht junge Frau mit liebenswürdigem Charakter zur Eheschließung) stand da in den 'Nieuws van den Dag' (Tagesnachrichten). Der Kolonialoffizier Campbell Rudolph MacLeod hatte sie aufgegeben; mit rund 20 Jahren, die er älter als Margaretha war, litt er an Rheuma und hatte Diabetes. Damit war er nicht gerade der ideale Ehepartner für die ehrgeizige junge Frau, dennoch fühlte sie sich von seinem weltmännischen Auftreten positiv angesprochen und so heiratete die Neunzehnjährige im Juli 1895 den Offizier. Das Paar zog nach Amsterdam, die Flitterwochen verbrachten die beiden in Wiesbaden. Sohn Norman John wurde - als Siebenmonatskind - im Januar 1896 geboren.
Schon bald darauf kam es zu Konflikten. Die Schwägerinnen verstanden sich überhaupt nicht, auch in der Ehe selbst gab es häufig Streitereien, weil Margaretha mit ihrer häuslichen Situation nicht sonderlich zufrieden war. Im Mai 1897 reiste das Paar nach Batavia (7) in Java, wo MacLeod stationiert war. Er wurde noch im gleichen Jahr zum Major befördert und nach Malang versetzt; dort wurde im Mai 1898 Töchterchen Luisa Jeanne (8) geboren wurde.
Dieser Ort wurde während der Kolonialzeit als 'Côte d'Azur Indonesiens', weil er zahlreiche Vergnügungs- und Arbeitsmöglichkeiten bot. Dort blühte Margaretha sichtlich auf; bald beteiligte sie sich auch am kulturellen Leben. Als 1898 anlässlich der Feiern zur Thronbesteigung Königin Wilhelminas das Schauspiel "Die Kreuzfahrer" von August von Kotzebue aufgeführt wurde, durfte Margaretha die Rolle der Königin spielen - dies war das erste Mal, dass sie in der Öffentlichkeit auftrat. (9)
Im März des darauffolgenden Jahres wurde MacLeod nach Medan auf Sumatra versetzt und so wurde das Ehepaar zunächst für etwa sieben Monate voneinander getrennt. MacLeod war seit dem ersten Auftritt seiner Gattin recht eifersüchtig geworden; zudem störte ihn ihr überaus sorgloser Umgang mit dem Haushaltsgeld, weshalb er sie häufig zu mehr Sparsamkeit ermahnte. Das Paar entfremdete sich immer mehr, die persönlichen Spannungen nahmen zu. (10)
Im Juni 1899 starb der kleine Norman an den Folgen einer Vergiftung: Eine Hausangestellte der Familie gab noch auf dem Sterbebett zu, dass sie ihm Gift ins Essen gemischt hatte, weil sie sich damit für die frühere Bestrafung ihres Liebhabers durch MacLeod rächen wollte. Das Töchterchen entging dem gleichen Schicksal nur deshalb, weil beizeiten ein Arzt geholt worden war.
Als der Major im Herbst 1900 nach 28 Dienstjahren in den Ruhestand versetzt wurde, zog die Familie nach Sindanglaya; Margaretha wollte allerdings unbedingt nach Europa zurückkehren. MacLeod wollte davon nichts wissen, weil ihm klar war, dass seine Ruhestandsbezüge dort für ein angemessenes Leben nicht ausreichen würden, weshalb die Eheprobleme immer gravierender wurden. Als das Paar 1902 dann doch in die Niederlande zurückkehrte, kam es schon bald zu einer offiziellen "Trennung von Tisch und Bett" und der Ehemann wurde zu monatlichen Unterhaltszahlungen von 100 Gulden verurteilt. Tochter Non wurde zwar der Mutter zugesprochen, verblieb jedoch einvernehmlich bei ihrem Vater, der sich inzwischen in Velp niedergelassen und ein zweites Mal geheiratet hatte.
Aufgrund von Nacktaufnahmen, welche sie für einen Bildhauer hatte anfertigen lassen und die aus bislang ungeklärten Gründen an 'Sammler' verkauft und somit öffentlich bekannt wurden, wurde Mata Hari schließlich 1906 'schuldig' geschieden.
Weil MacLeod seinen Unterhaltspflichten nicht nachkam, war Margaretha gezwungen, für ihren Lebensunterhalt selbst zu sorgen. So ging sie zunächst nach Paris, um dort als Mannequin zu arbeiten, was aber nicht klappte. Auch verschiedene Versuche, als Modell für Maler zu arbeiten, schlugen fehl.
Da sie in den Jahren 1903 bis 1905 auf die Idee gekommen war, einen raffinierten Schleiertanz zu kreieren, verstand sie es nun geschickt, Legenden einer indischen Tempeltänzerin in die Welt zu setzen. Für das Paris der Belle Époque war eine indische Bajadere exotisch und geheimnisvoll, vor allem aber unerhört neuartig. Somit war es kein Wunder, dass die Geschichte und der Tanz Mata Haris, die die Kunst der erotischen Entkleidung perfekt beherrschte, das reiche und gelangweilte Publikum ungewöhnlich faszinierten.
So schrieb beispielsweise der Journalist Marcel Lami im 'Courrier français' (11): "Eine große, dunkle Gestalt schwebt herein. Kräftig, braun, heißblütig. Ihr dunkler Teint, ihre vollen Lippen und glänzenden Augen zeugen von weit entfernten Landen, von sengender Sonne und tropischem Regen. Sie wiegt sich unter den Schleiern, die sie zugleich verhüllen und enthüllen. (...) Das Schauspiel lässt sich mit nichts vergleichen, was wir je gesehen haben. Ihre Brüste heben sich schmachtend, die Augen glänzen feucht. Die Hände recken sich und sinken wieder herab, als seien sie erschlafft vor Sonne und Hitze. (...) Ihr weltlicher Tanz ist ein Gebet; die Wollust wird zur Anbetung. Was sie erfleht, können wir nur ahnen. (...) Der schöne Leib fleht, windet sich und gibt sich hin: es ist gleichsam die Auflösung des Begehrens im Begehren."
Margaretha behauptete von nun an, aus Südindien - von der Küste von Malabar - zu stammen. Ihre Familie bestehe aus Mitgliedern der oberen Kaste der Brahmanen und sie sei in einer unterirdischen Halle des Gottes Shiva aufgewachsen, wo man sie von klein auf in rituellen Tempeltänzen unterrichtet habe, die sie dann zu Ehren des Gottes jeden Tag getanzt habe. Darüber hinaus erfand sie eine Geschichte: Ein bildschöner, junger britischer Offizier habe sie bei einem dieser Tänze gesehen, sich unsterblich in sie verliebt, sie entführt und dann geheiratet. Sie habe ihm einen Sohn geboren, den eine Dienerin später grundlos vergiftet habe. Nach indischem Brauch habe sie danach diese Dienerin eigenhändig erdrosselt... (12) Alle diese Legenden wurden erst sehr viel später als Lügengebilde entlarvt; zunächst begann ein einzigartiger Siegeszug als gefeierte und begnadete Tänzerin.
So trat sie auf den Soirées des Bankiers Rothschild auf oder präsentierte sich bei der Theaterschaupielerin Cécile Sorel oder bei Gaston Menier, dem Erben der Schokoladendynastie Menier; pro Abend soll sie damals etwa 10000 französische Francs verdient und in den teuersten Hotels der Stadt logiert haben. Die Szenen, in denen sie nahezu unbekleidet tanzte, waren Sensation und Skandal zugleich.
Obwohl verschiedene Tänzerinnen ihre 'Tempeltänze' nachahmten, hielt das Interesse an Mata Hari ungebrochen an: Große Varietés boten ihr Engagements an, ihr Bild wurde auf Postkarten, Zigarettenschachteln und Keksdosen verewigt und schließlich kam es auch zu Auslandsauftritten - etwa in Spanien, Monaco, Deutschland oder Österreich. Auch in der Alpenrepublik feierte sie Triumphe. So hieß es im 'Neuen Wiener Journal' vom 15. Dezember 1906 unter anderem: "Isadora Duncan ist tot, es lebe Mata Hari! Die Barfußtänzerin ist vieux jeu, die Künstlerin up to date zeigt mehr (...) Unter dem Schleier trägt die schöne Tänzerin auf dem Oberkörper einen Brustschmuck und einen Goldgürtel, sonst nichts. Die Kühnheit des Kostüms bildet eine kleine Sensation. (...) Das, was die Künstlerin im Tanze verrät, ist reinste Kunst (...)."
Als immer mehr Tänzerinnen ihre Tänze kopierten, kam es zwar zu einem Karrierebruch, dennoch blieb sie auch weiterhin ein geschätztes Mitglied der Pariser Gesellschaft und trat immer wieder in privaten Salons der italienischen Oberschicht und diversen Theatern auf. Weil es jedoch immer wieder zu größeren Eklats aufgrund von Mata Haris überzogenen Ansprüchen kam, wandten sich viele Manager und Regisseure enttäuscht von ihr ab.
Etwa um die gleiche Zeit versuchte Mata Hari, Kontakte zu ihrer Tochter Non wiederherzustellen, doch auch damit hatte sie keinen Erfolg. Der Ex-Ehemann sandte alle ihre Briefe ungeöffnet wieder zurück. Als der Erste Weltkrieg ausbrach, verließ sie Deutschland und kehrte nach Den Haag zurück, wo sie zunächst ein kleines Haus mietete (ihren Villenhaushalt in Neuilly bei Paris löste sie gleichzeitig auf).
Weil Mata Hari im Lauf ihrer Karriere als Tänzerin immer wieder einmal mit Persönlichkeiten aus Politik und Gesellschaft Kontakt gehabt hatte, ergab es sich, dass ihr Carl H. Cramer, der deutsche Konsul in Amsterdam, im Frühjahr 1916 ein finanziell verlockendes Angebot machte - wenn sie sich bereit erkläre, 'Deutschland gewisse Informationen zukommen zu lassen' (13).
In einem 14teiligen Erfahrungsbericht des deutschen Generalmajors a.D. Friedrich Gempp über den deutschen militärischen Nachrichtendienst im Ersten Weltkrieg, der etwa um die Mitte der 1970er Jahre aus den USA nach Deutschland gelangte und der inzwischen im Freiburger Militärarchiv einsehbar ist, waren u.a. auch Informationen der Abteilung IIIb über eine gewisse 'Agentin H-21' enthalten, bei der es sich um Mata Hari gehandelt hat.
Aus ihnen geht hervor, dass Mata Hari im Spätherbst 1915 in den Dienst des deutschen Geheimdienstes getreten war. Walter Nicolai, der damalige Chef der Abteilung IIIb, hatte Mata Hari nach Köln kommen lassen, wo beschlossen wurde, sie zur Agentin ausbilden zu lassen. Der ihr zugewiesene Führungsoffizier Major Roepell habe ihr dann auf langen Spaziergängen das Agenten-Einmaleins beigebracht, ein Experte mit ihr 'chemisches Schreiben' geübt. Hauptaufgabe Mata Haris sei es gewesen, die Offensivpläne des Gegners herauszubekommen, Reisen durch militärisch interessante Gebiete Frankreichs zu unternehmen und ständigen Kontakt mit der deutschen Agentenzentrale in Madrid zu halten.
George Ladoux vom Deuxième Bureau, der zweiten Abteilung des französischen Auslandsnachrichtendienstes, wurde bereits um die Mitte des Jahres 1915 auf Mata Hari aufmerksam; zuvor war sie bereits auch dem britischen Secret Intelligence Service aufgefallen. Weil die Verdachtsmomente für eine Festnahme indes nicht ausreichten, stellte Ladoux der Tänzerin im Dezember 1916 bewusst eine Falle. Er ließ ihr die Namen von sechs belgischen Agenten zukommen, die sie demnächst aufsuchen sollte. Fünf dieser sechs Männer wurden verdächtigt, irreführende Meldungen zu liefern, der sechste arbeitete nachweislich für Frankreich und Deutschland. Zwei Wochen nach Abreise Mata Haris wurde dieser Mann von den Deutschen erschossen, während die anderen fünf unbehelligt blieben. Daraus folgerte Ladoux, dass Mata Hari die Namen der Spione den deutschen Militärbehörden verraten haben musste. Als sie aus Spanien wieder nach Frankreich zurückkehrte, wurde sie am Morgen des 13. Februar 1917 von Polizeikommissar Priolet festgenommen und Hauptmann Pierre Bouchardon, dem Untersuchungs- richter des Kriegsgerichts, vorgeführt, anschließend als Untersuchungshäftling in das Frauengefängnis Saint-Lazare verbracht.
Fünf Monate später war die Anklageschrift fertiggestellt; am 24. Juli 1917 begann im Pariser Justizpalast der Prozess unter Vorsitz des Richters Lieutenant-Colonel Albert Ernest Somprou und sechs Beisitzern, der nur eineinhalb Tage dauerte. Auch George Ladoux war anwesend, denn der Richter hatte seine Anwesend für nötig befunden, 'um einzelne Punkte zu klären und bedarfsweise auszusagen'. (14)
Die Verteidigung Mata Haris übernahm der Jurist Eduard Clunet, der bei seiner Verteidigung vor allem auf emotionsgeladene Reden setzte, um die Frau als Opfer der Umstände und eine in finanzielle Not geratene Künstlerin darzustellen. Doch er hatte keinen Erfolg damit, denn das französische Militärgericht befand Mata Hari der Spionage für Deutschland und somit des Hochverrats und der Unterstützung des Feindes für schuldig.
Obwohl es keine eindeutigen Beweise für 'Spionage' gab, wurde Mata Hari am 25. Juli 1917 wegen Doppelspionage und Hochverrats von den Militärrichtern zum Tode verurteilt. Untersuchungsrichter Bouchardon führte zum Beispiel vor Gericht an: "....Sprachkenntnisse, zahllose Verbindungen, beachtliche Intelligenz und angeborene oder erworbene Sittenlosigkeit haben nur dazu beigetragen, sie verdächtig zu machen. Ohne Skrupel und daran gewöhnt, sich der Männer zu bedienen, ist sie der Typ einer Frau, die zur Spionin prädestiniert ist...." (15)
Am 15. Oktober 1917 wurde Margaretha Geertruida Zelle um 6.15 Uhr morgens in den Befestigungsanlagen von Schloss Vincennes bei Paris von einem zwölfköpfigen Hinrichtungskommando erschossen (von der abgefeuerten Salve traf angeblich nur ein einziger Schuss tödlich, dieser allerdings direkt ins Herz). Ein Unteroffizier gab ihr aus kurzer Distanz zusätzlich einen Gnadenschuss in den Kopf.
Die letzten Worte Mata Haris sollen gelautet haben: "Der Tod ist nichts, auch das Leben nicht, was das betrifft. Zu sterben, zu schlafen, ins Nichts zu verschwinden, was macht das schon? Alles nur Illusion!" (16)
Weil sich niemand fand, der die Kosten für eine 'normale' Beerdigung übernommen hätte, wurde der Körper Mata Haris der Medizinischen Fakultät der Pariser Sorbonne zur Verfügung gestellt. Merkwürdigerweise ist der präparierte Kopf in den 1950er Jahren aus dem Pariser Autonomie-Museum, wo er ausgestellt war, verschwunden.
Bereits kurz nach ihrem Tod wurde Mata Hari zu einem Mythos stilisiert: Sie galt als Verkörperung einer Kurtisane oder wurde als Femme fatale gesehen. Ihre Lebensgeschichte war bislang Stoff für über 250 Bücher und ein gutes Dutzend Filme. Dennoch ist die Quellenlage insgesamt relativ dünn. Feststeht nachwievor, dass die umfangreiche Literatur nur mit größter Vorsicht zu benutzen ist.
Ein im Herbst 2001 durch ihre Geburtsstadt Leeuwarden und die Mata Hari Foundation beim französischen Justizministerium eingereichter Revisionsantrag ihres Prozesses mit über 1000 Dokumentationsseiten, mit dem bewiesen werden sollte, dass Mata Hari das Opfer eines Justizmordes geworden war, wurde – wie bereits zwei vorhergegangene Anträge – zurückgewiesen. Die Mitglieder der Arbeitsgruppe waren zu dem Schluss gekommen: "Mata Hari war keine geborene Spionin. Man hat sie für die antideutsche Kriegskampagne benutzt. Sie war lediglich eine Frau, die das Leben genießen wollte und die nicht begriffen hatte, daß mit dem Krieg nichts sein würde wie zuvor." (17)
Eine grundsätzlich andere Beurteilung der Geschehnisse und Beweise konnte auch nach Öffnung der französischen Gerichtsakten im Jahr 2017 nicht gewonnen werden.
___________________________________________________________________(1) Malayisch "Sonne"; die Worte bedeuten "Auge des Tages".
(2) Wagenaar, Sam: „Der erste wahre Bericht über die legendäre Spionin.“ Bergisch-
Gladbach 1985 (S. 46).
(3) „Briefwisseling naamswijziging Mata Hari ontdekt.“ (Fries Museum)
(4) „Sie nannte sich Mata Hari.“ Memento vom 24.12.2007. In: „Internet Archive“. Tagesspiegel vom 7.10.2007.
(5) Am 9. Mai 1891.
(6) Mit „Indië“ ist nicht „Indien“, sondern „Indonesien“ gemeint.
(7) Die Stadt heißt aktuell Jakarta; sie gehörte damals zur Kolonie Niederländisch-Indien.
(8) Sie wurde Non genannt. Der malayische Name bedeutet "Mädchen".
9) Huisman, Marijke: „Mata Hari (1876-1917), de levende legende.“ Hilversum 1998
(S. 11/12) sowie Wencker-Wildberg, Friedrich: „Mata Hari-Roman ihres Lebens.“ Augsburg 2004 (S. 34).
(10) Wagenaar, a.a.O., S. 67 sowie Huisman, a.a.O., S. 13. Huisman erhielt Einblick ins Archiv der Mata Hari-Stiftung, das Teile der Korrespondenz der Eheleute enthält.
(11) Kupferman a.a.O., S. 23.
(12) Vgl. Kupferman, Fred: „Mata Hari: songes et mensonges“ (Träume und Lügen). Berlin 1999 (S. 23). --- Außerdem: Riess, Curt. „Prozesse, die unsere Welt bewegten“. Augsburg 1999 (S. 240).
(13) Cramer soll ihr die Summe von 20000 Francs geboten haben. Mata Hari habe das Geld angenommen, jedoch nie eine entsprechende Gegenleistung erbracht.
(14) Riess, a.a.O.
(15) Wagenaar, a.a.O., S. 446.
(16) Bisbort, Alain. „Famous Last Words.“ Portland/Oregon (USA) 2001.
(17) Balmer, Rudolf. „Mata Hari: Doppelagentin und Propagandaopfer“. In: Frankreich-Informationsdienst vom 16.10.2001.
================================================================