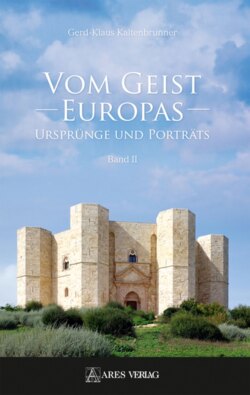Читать книгу Vom Geist Europas - Gerd-Klaus Kaltenbrunner - Страница 11
V.
ОглавлениеDas Römertum kennt — anders als die Griechen — keine Göttermythen so wie es auch keine kosmogonischen Mythen kennt. Die römischen Götter zeigen sich nicht in jener plastischen Rundheit und sinnfälligen Evidenz wie die homerischen Olympier. Sie haben im Grunde keine Geschichte, sie vollbringen keine Taten und ihnen widerfahren keine Abenteuer.
Das Römertum kennt — anders als die Christen — keine Dogmen, kein Credo, keine verbindlichen Glaubensbekenntnisse, keine Lutherschen Thesen, keine Confessio Augustana, keinen Syllabus und keinen Antimodernisteneid. Es kennt, genau betrachtet, keine Orthodoxie, keine rechte und angeblich alleinseligmachende Lehre, und deshalb auch keine Ketzerprozesse, keine Inquisition und keinen theologischen Fanatismus.
Das Römertum kennt — anders als die Moderne — keine vom profanen Alltag und den Erfordernissen potenter Staatlichkeit abgetrennte oder ihnen gar zuwiderlaufende Religion. Religion ist kein Reservat schwärmerischer Gefühle, kein Asyl mystischer Erleuchtungen, keine exterritoriale Enklave gewissensbedingter geheimer Vorbehalte gegenüber dem, was weltlich nottut.
Das Römertum kennt — wieder im Unterschied zum Christentum, als dieses noch mächtig war — keinen Glaubenszwang, keinen Begriff vergleichbar dem der „Gedankensünde” und keine Unduldsamkeit gegenüber Meinungen über transzendente Dinge. Römische Religiosität ist — anders als die in mancherlei rivalisierende Schulen zersplitterte griechische Philosophie — grundsätzlich tolerant, liberal und unfanatisch.
Das Römertum kann hinsichtlich noch so abweichender Lehrmeinungen und philosophischer Theorien großzügig sein, weil seine Religion wesentlich keine Lehre, sondern ein Tun ist: keine Orthodoxie, sondern eine Orthopraxis. Römische Religion enthält sich, von einigen Rudimenten abgesehen, aller Aussagen über Weltschöpfung, Erlösung, Unsterblichkeit der Seele oder Auferstehung von den Toten. Weil sie keine Dogmen kennt, reizt sie auch nicht zu intellektuellem Widerspruch, Sektierertum oder „Entmythologisierung”. Sie kennt deshalb keine Häretiker und Märtyrer, die wegen abweichender theoretischer Überzeugungen von den Priestern des Staatskultes verfolgt werden. Erst das Judentum, vor allem aber das Christentum mit seinem absoluten Ausschließlichkeitsanspruch veränderte die Situation.
Das Römertum kennt — abermals im Gegensatz zum Christentum — keine Trennung zwischen „geistlicher” und „weltlicher”, zwischen „kirchlicher” und „politischer” Gewalt. Es kennt deshalb keinen „Klerikalismus”, keine Priesterherrschaft. Die römischen Priester bilden keine eigene Kaste. Sie sind kein Staat im Staate, keine Agentur einer ausländischen Macht, keine Fünfte Kolonne, die im Ernstfall die staatsbürgerliche Treuepflicht zugunsten der Loyalität gegenüber einem anderen Souverän verweigern könnte, sei dieser Souverän nun ein Prophet, Guru oder auch das eigene unüberprüfbare Gewissen. Die Priester Roms sind grundsätzlich Beamte gleich den Konsuln und anderen Magistraten. Sie genießen zwar einige Privilegien, übernehmen dafür aber etliche schwerwiegende Pflichten.
Ich erinnere in diesem Zusammenhang an die mit drakonischen Strafandrohungen abgestützte Verpflichtung der Vestalinnen zu dreißigjähriger klösterlicher Keuschheit. Desgleichen erwähne ich die vielen Tabuvorschriften, denen die Priester mancher Einzelgötter unterworfen waren. Insbesondere der Flamen Dialis, der sich dem Jupiterkult zu widmen hatte und dem Pontifikalkollegium angehörte, war in seinem alltäglichen Leben von derart strengen Sakralgeboten eingeschränkt, daß sein Posten trotz aller Ehrenvorrechte einmal fünfundsiebzig Jahre frei blieb, weil sich niemand um eine derart beschwerliche Stelle bewerben wollte. Die Priester waren hohe Beamte im Staate, ihnen unterstand die Administration der kultischen Belange, die bürokratische Erfassung und Verwaltung des Götterwesens. Aber die höchste Verantwortung für die Wahrung der pax deorum, den ordnungsgemäßen Frieden mit den Göttern, lag nicht bei den Priestern, sondern bei den gewählten Beamten und Hoheitsträgern des römischen Volkes. Die Priester fungierten weniger als selbsternannte Mittler zwischen Gott und Mensch, Diesseits und Jenseits, Offenbarung und irdischem Gesetz; sie waren Kultsachverständige, Experten für religiöse Altertümer und Fachmänner für Zeremonien, Riten und ehrwürdige Bräuche, die die Konsuln und andern Inhaber staatlicher Gewalt zu beraten hatten. Die Priester sind nicht bevollmächtigt, nach eigenem Ermessen die Götter anzurufen. Zwar muß jeder wichtige Staatsakt durch Einholung eines Auspiziums vorbereitet werden, aber der Konsul ist an die priesterliche Auslegung des Vorzeichens nicht gebunden. Den Auguren stand somit nur die Rolle hoher Berater, nicht aber die einer dem Staate gegenüberstehenden Gewalt zu. Sie hatten auch nicht die Zukunft vorherzusagen, sondern bloß anhand bestimmter Zeichen die ihnen von den Beamten vorgelegte Frage zu beantworten, ob die Götter ein bestimmtes Unternehmen billigen.