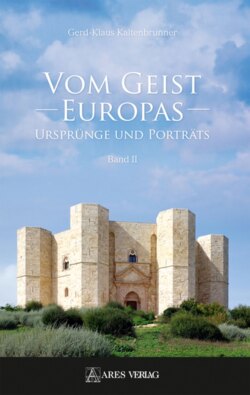Читать книгу Vom Geist Europas - Gerd-Klaus Kaltenbrunner - Страница 13
VII.
ОглавлениеCicero ist recht eigentlich der Stammvater, Lieblingsheilige und Schutzpatron aller europäischen Humanisten. Er ist der erste große Humanist in des Wortes doppelter Bedeutung. Cicero hat uns beispielhaft vorgelebt, was Freude an griechischer Bildung bedeutet. Und er hat uns nicht nur das Wort humanitas hinterlassen, sondern auch die Gestalt des im weiteren Sinne humanen, humanisierten und humanistischen Menschen eingeprägt: den homo humanus. Er gleicht weit mehr dem kultivierten Gentleman als dem sich selbst verleugnenden Heiligen. Er hat das Grobe, Plumpe und Dumpfe angeborener Roheit nach Möglichkeit überwunden, ohne deshalb das Maß des Irdischen überschreiten zu wollen. Er hat seine Anlagen zu Güte, Nachsicht und Milde zum Erblühen gebracht, ohne deshalb die Fähigkeit zu entschiedener Härte verloren zu haben. Er ist großmütig, hat Geschmack an schönen Dingen und Sinn für überlegene Ironie wie für lächelnde Weisheit. Er ist überlieferungsfrommer Skeptiker, weil er die Erkenntnismöglichkeiten des Menschen nicht überschätzt. Er ist nicht rechthaberisch, starrköpfig und rücksichtslos, aber auch kein schwächlicher Waschlappen. Gelassenheit, ja sogar ein Hauch von schwermütiger Resignation sind gestattet, nicht aber weinerliche Weichlichkeit. Extreme sind ihm fremd. Auf manche Fragen gibt er bisweilen mehrere Antworten. Zumindest weiß er, daß mehr als eine möglich ist, wenngleich er aus Klugheit manche verschweigt. Er schätzt in maßvoller Weise die Wonnen der Welt, aber er behält die Götter im Blick. Er verliert sie sogar dann nicht aus dem Auge, wenn ihre Sternbilder hinter dämmernden Wolken des Zweifels geschwunden sind.
Ein solcher Mensch war Cicero. Ein Gentleman-Philosoph. Ein Humanist. Der Genius und Augur aller späteren Humanisten. Ein Mann für alle Jahreszeiten. Bereits Augustus, der doch Ciceros Ermordung nicht verhindern konnte oder wollte, vermochte sich seinem Zauber nicht zu entziehen. Plutarch berichtet darüber folgende Anekdote:
„Wie ich erfahren habe, kam Cäsar Augustus viele Jahre später einmal zu einem seiner Enkel ins Zimmer. Dieser hatte gerade eine Schrift Ciceros in der Hand und versteckte sie erschrocken in der Toga. Augustus bemerkte dies, ließ sich das Buch geben und las im Stehen lange Zeit darin. Dann gab er es dem jungen Mann zurück und sagte: ‚Er war ein Meister des Wortes, mein Kind, ein Meister des Wortes und ein wahrer Freund seines Vaterlandes’.”
Die Männer, die ihn später geschätzt und geliebt haben, zählen zu den sympathischsten Gestalten des Abendlandes. Ich nenne einige aufs Geratewohl: Plinius der Ältere, Quintilian und Boëthius, dann Petrarca, Boccaccio, Erasmus von Rotterdam, Montaigne, Hume, Voltaire, Wieland und den Fürsten de Ligne. Erasmus bekannte: „Der heiligen Schrift kommt zwar der erste Platz zu, dennoch finde ich des öfteren bei den alten Heiden, ja sogar bei den Dichtern Gedanken, die so rein, so heilig, so göttlich gesagt oder geschrieben sind, daß ich mir die Überzeugung nicht versagen kann, eine Art göttlicher Kraft habe sie inspiriert.” Das erinnert fast wörtlich an die im vorgehenden zitierte Stelle in Ciceros „De natura deorum”: „Es hat also niemals einen bedeutenden Mann ohne Anhauch eines göttlichen Geistes gegeben.” Erasmus fährt fort: „So gibt es viele Heilige, die nicht in unserem Kalender stehen. Ich will hier vor meinen Freunden meine Neigung nicht verhehlen: Ich kann die Bücher Ciceros über das Alter, über die Freundschaft, über die Pflichten und die Tuskulanischen Gespräche nicht lesen, ohne von Zeit zu Zeit das Buch zu küssen und mich zu verneigen vor seinem heiligen, ganz von göttlichem Odem erfüllten Herzen.” Voltaire trat einem Angriff auf Cicero mit den Worten entgegen, „daß seine ‚Tusculanen’ und ‚De natura deorum’ die beiden schönsten Werke sind, welche die menschliche Weisheit jemals verfaßt hat; daß sein Traktat ‚De officiis’ das nützlichste Handbuch der Moral ist, das wir besitzen.” Wieland begann in hohem Alter sämtliche Briefe Ciceros ins Deutsche zu übersetzen, um sich aus der „fürchterlich einengenden Gegenwart” der Napoleonischen Kriege in eine sowohl angenehme als auch nützliche Arbeit zu flüchten, die ihm nach Vollendung das Recht gebe zu hoffen, „die letzten Jahre oder Tage meines Lebens nicht ohne alles Verdienst um meine geliebten Sprachgenossen zugebracht zu haben.” Der Fürst Charles Joseph de Ligne bekannte: „O Cicero, ich liebe dich weit mehr dort, wo du mich lehrst, der Welt zu entsagen, mir selbst zu genügen, als wo du eifernd redend gegen Größere auftrittst. Catilina war ein Verbrecher, aber er hätte ein Held sein können. Aber wie viel verdanke ich dir doch, o Cicero! Du stehst mir bei in meiner Liebe zur Literatur, die der Trost meiner alten Tage, Gefährte meiner Arbeiten und an meinem Zufluchtsort meine Gesellschaft sein wird.” Als der italienische Jesuit, Handschriftenexperte, Präfekt der päpstlichen Bibliothek und spätere Kardinal Angelo Mai um 1820 große Teile des bis dahin verschollenen Werks „De re publica” aufgefunden hatte, widmete ihm der Dichter Giacomo Leopardi die hymnischen Verse (Übersetzung von Hanno Helbling):
… Welch ein Auferstehen!
Mit einem Mal erschlossen sich aufs neue
die alten Blätter; so hat uns nun lang
die Klosterheimlichkeit
den Schutz für Großes, Heiliges versehen:
für unsrer Ahnen Wort. Ob solche Treue
das Schicksal dir verlieh, erlauchter Mann?
Ob dir das Schicksal sie nicht nehmen kann?
Gewiß, nicht ohne hohen Rat der Götter
geschieht es, daß zur Stunde
der tiefsten, heillosen Vergessenheit
der Bann gebrochen wird durch neue Kunde
von unsern Vätern. Siehe, noch verzeiht
der Himmel uns, und immer noch umsorgen
die Genien das Land…
… Du, im Entdecken Meister
fahr fort; die Toten wecke,
da die Lebendigen schlummern, und das leise,
vergangne Raunen mach zum Heldenchor,
daß endlich diese träge Zeit sich rühre,
zur Tat sich rüste — oder Scham verspüre.
(1988)