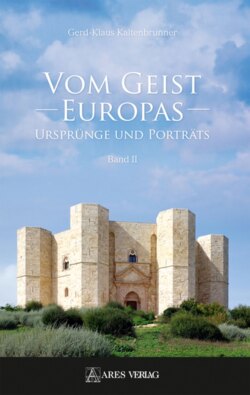Читать книгу Vom Geist Europas - Gerd-Klaus Kaltenbrunner - Страница 6
Sokrates Das schöne Wagnis, den Tod vom Leben her zu verstehen
ОглавлениеSokrates allein, der uns glauben lassen könnte, daß der Mensch gottähnlich sei, predigte Philosophie; alle anderen predigten nur ihre beschränkten Systeme. Er lehrte die Menschen, daß Philosophie in jedem gesunden Kopfe, in jedem reinen Herzen wohne, und daß sie die Quelle einer allgemeinen und unzerstörbaren Glückseligkeit sei.
Frans Hemsterhuis (1721 - 1790)
Von dem geistreichen Amerikaner Emerson stammen die Worte: „Aus Platon kommen alle Dinge, die noch heute geschrieben und unter denkenden Menschen besprochen werden.” Der britische Logiker, Mathematiker und Kosmologe Whitehead stimmte in diesen Hymnus ein, als er augenzwinkernd die gesamte europäische Philosophie eine Abfolge von Fußnoten zu den Platonischen Dialogen nannte. Dies gilt auch für Systeme, Bewegungen und Schulen, die in allgemeinen nicht zum „Platonismus” gerechnet werden. Ohne Platon keine Augustinus, kein Eckhart, kein Erasmus, kein Galilei, kein Rousseau, kein Kant, kein Schiller, kein Schopenhauer, kein Solowjow, kein Kardinal Newman, kein Heisenberg und auch kein Sigmund Freud. Der Sokrates-Schüler Platon war und ist Quelle, Vorbild und Archetyp auch dort, wo Wege gebahnt werden, die aus dem Bereich griechischer Metaphysik hinausführen sollen. Gibt es im Werk des Anti-Platonikers Nietzsche einen wesentlichen Gedanken, für den sich bei Platon keine Entsprechung aufweisen ließe? Sogar für den „Übermenschen”, den „Willen zur Macht” und die „Ewige Wiederkehr” lassen sich Pendants in den Dialogen des Griechen leicht finden. Vielleicht kann man sogar die Titelgestalt von „Also sprach Zarathustra” als einen trunkenen Sokrates mit antiplatonischer Maske begreifen. Wieviel bewußter, wieviel verschwiegener Platonismus steckt doch im antipositivistischen Affekt der „Frankfurter Schule”, vor allem in den Lehren Herbert Marcuses, oder auch — am andern Ende des geistespolitischen Spektrums — im Ganzheitsdenken Othmar Spanns!
Jeder von uns hat schon von Platon gehört, wohl auch irgendeinmal von „platonischer Liebe” geredet, häufiger freilich von irgendwelchen „Ideen” — damit einen der Grundbegriffe des Philosophen gedankenlos im Munde führend. Nachdenklichere ahnen höchstwahrscheinlich auch, daß sich hinter dem Namen Platon ein riesiger Erdteil verbirgt, ja ein ganzer Kosmos von Einsichten, Eingebungen und Grundsätzen, und daß es sich wohl lohnte, ihn zu erkunden und aus seinen Schätzen zu schöpfen. Haben nicht sogar noch in allerjüngster Gegenwart Georg Picht, Carl Friedrich von Weizsäcker, Günter Rohrmoser und der leider viel zu wenig als eigenständiger Sozialphilosoph gewürdigte Österreicher Ernst Karl Winter eindringlichst daran erinnert, daß hier, trotz jahrtausendelangen Abbaus, unerhörte Vorräte lagern, die planmäßig zu erschließen uns weiterbringen würde?
Platon zu lesen, gibt es somit manche Gründe. Ein letzter sei noch genannt, weil er die Brücke zu dem Band bildet, dessen Anschaffung und Lektüre hier empfohlen werden soll: Es gibt, vertrauenswürdigen Berichten zufolge, nach wie vor Männer und Frauen unter uns, die auf die Frage, mit welchem Autor man die letzten Stunden am besten bestehen könne, als einzigen Platon nennen. Welches seiner Werke aber könnte dafür angemessener sein als der Dialog „Phaidon”, in dem auch der sterbende Schriftsteller Charles Sealsfield geblättert hat? „Lest den ‚Phaidon’!” sagte noch in der ersten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts ein Philosoph zu den Seinen, als er das Zeitliche segnete; und ein anderer zu sich selbst: „Ja, mit Sokrates muß es gehen.”
„Phaidon” — das Werk ist benannt nach einem der Lieblingsschüler des Sokrates. Er war zugegen, als der Meister im Jahre 399 vor Beginn der christlichen Zeitrechnung gelassen den Giftbecher leerte. Es war an einem frühen Abend; der Sonnenuntergang nahte zwar bereits, doch lag noch Licht auf den Bergen. Vorher aber hatte sich Sokrates gründlich gebadet, um „den Frauen keine Umstände zu machen, die Leiche zu waschen”. Als ihn der Vollstreckungsbeamte daran erinnerte, daß nun die Stunde des Abschieds gekommen sei, weinte er — nicht aber der Todeskandidat. Welcher Scharfrichter oder Kerkermeister kann zartfühlender sein als dieser namenlose Mann, der zum Verurteilten sagte: „Ich habe dich kennengelernt als den edelsten, sanftmütigsten und besten Menschen von allen, die jemals hierher gekommen sind, und auch jetzt weiß ich sicher, daß du mir nicht zürnst — denn du kennst die Schuldigen.”
Wenn man dies im „Phaidon” liest, denkt man unwillkürlich an die Hinrichtung eines anderen Unschuldigen, von der es im Lukas-Evangelium heißt: „Als der Hauptmann dies gesehen hatte, pries er Gott und sagte: Wahrlich, dieser Mensch war gerecht!” Dem Leser bleibe es überlassen, weitere Parallelen zu entdecken zwischen dem letzten Freundesgespräch des Sokrates, das Platons „Phaidon” überliefert, und den Abschiedsreden Jesu, wie sie die Johannes-Passion festhält. Es gibt deren mehrere, nur eine einzige Ähnlichkeit sei noch kurz erwähnt: das Unverständnis der Jünger, der griechischen wie der galiläischen. Mit einem Unterton bitterer Ironie sagt Sokrates, er hoffe, für seine ihm lauschenden Freunde überzeugender gewesen zu sein, als bei seiner Verteidigung für die ihm feindlichen Richter. Am Ende muß er illusionslos erkennen, daß trotz menschlicher Nähe und geistiger Anteilnahme nicht einmal der engste Kreis ihm vorbehaltlos zu folgen vermag. Damit vergleiche man das wehmütige Wort beim letzten Abendmahl: „So lange Zeit bin ich bei euch, und du hast mich nicht erkannt, Philippus?”
Diese Andeutungen mögen genügen, um den Rang des Platonischen Dialogs „Phaidon” zu kennzeichnen. Keineswegs soll der Sohn der Phainarete mit dem Sohn Marias, der seinem „Daimonion” getreulich folgende Sokrates mit dem menschgewordenen Gotteswort gleichgestellt werden. Nicht nur theologische Gründe verbieten ein derartiges Unterfangen, sondern schon ein von allen dogmatischen Rücksichten unbeeinflußter biographisch-physiognomischer Takt. Sokrates wurde nicht gefoltert und nicht gekreuzigt. Während der ans Marterholz genagelte Jesus seine Verlassenheit hinausschrie, behielt Sokrates bis zuletzt seine philosophische Ruhe und empfahl mit hintergründiger Heiterkeit, dem heilkundigen Gott Asklepios einen Hahn zu opfern. Üblicherweise tat man dies zum Dank für eine Genesung. Nietzsche unterstellte, daß der sterbende Sokrates damit angedeutet habe, das Leben als solches sei eine Krankheit, der Tod aber die gründlichste Kur. Das ist jedoch falsch. Nietzsches polemische Behauptung läßt sich gerade durch eine aufmerksame Lektüre des „Phaidon” (und der meisterlichen Einführung von Barbara Zehnpfennig zur jüngsten Ausgabe) entkräften.
Keiner Gleichsetzung von Sokrates und Jesus soll hiermit das Wort geredet sein, sondern bloß einer — wie der Fachausdruck lautet—„typologischen” Vergleichung. Diese aber hat ein langes und ehrwürdiges Herkommen. Sie reicht von dem frühchristlichen Apologeten und Märtyrer Justinus, der vor seiner Bekehrung Platoniker gewesen war, bis zu dem protestantischen „Magus in Norden”, Johann Georg Hamann aus Königsberg, dem Verfasser „Sokratischer Denkwürdigkeiten”, und dem rheinländischen Katholiken Ernst von Lasaulx, der als Sproß vom Stamme Schellings, Görres’ und Baaders in Würzburg und München lehrte. Sogar den erst 1974 verstorbenen kulturkonservativen Außenseiter Gerhard Nebel muß man diesem Chor zurechnen. Sie alle stimmen darin mit Theodor Haecker überein, daß es ein „adventistisches Heidentum” gab, zu dem neben Cicero, Seneca und Vergil auch Heraklit, Pythagoras und insbesondere Sokrates gehören. Mit Hamann sind sie davon überzeugt, „daß wir die Wolke dieser Zeugen nicht verachten sollen, daß sie der Himmel zu seinen Boten und Dolmetschern salbte, und zu eben dem Beruf unter ihrem Geschlecht einweihte, den die Propheten unter den Juden hatten.”
Man kann oft hören, daß Griechentum und Christentum, Jerusalem und Athen, attische Philosophie und biblischer Prophetismus zu den bleibenden Grundlagen europäischer Kultur gehören. Wenn diese fast zum geflügelten Wort gewordene Aussage keine unverbindliche Floskel sein soll, dann müßte wenigstens eine geistige Elite sich dazu aufraffen, neben dem „Gastmahl” und der „Politeia” auch Platons „Phaidon” zu lesen.
Der „Phaidon” findet sich selbstverständlich in allen deutschen Platon-Ausgaben. Deren berühmteste ist immer noch die Schleiermacher’sche. Die Patina, die seit längerem darüber liegt, verleiht ihr zwar einen gewissen nostalgischen Reiz, erschwert aber streckenweise das Verständnis des ursprünglichen Sinns. Moderner ist die Edition von Otto Apelt aus den zwanziger Jahren, die der Felix Meiner Verlag in anerkennenswerter Weise vor kurzem als wohlfeilen Reprint neu auf den Markt gebracht hat. Am wenigsten kostet wohl die kartonierte Einzelausgabe des Reclam Verlags.
Die allerjüngste Edition aber sei den anspruchsvolleren Platon-Lesern und Sokrates-Neugierigen ans Herz gelegt. Sie sei hier am meisten empfohlen — nicht weil sie der neueste Versuch einer „Phaidon”-Übertragung ist, sondern aufgrund ihrer qualitativen Vorzüge. Erstens enthält sie sowohl den griechischen Urtext als auch den deutschen Wortlaut. Zweitens zeichnet sich die Übersetzung — bis auf zwei oder drei Ausdrücke, bei denen man vielleicht eine andere Formulierung bevorzugen könnte — ebenso durch treffsichere Genauigkeit wie durch ansprechende Eleganz aus. Drittens ist hervorzuheben, daß die Übersetzerin Barbara Zehnpfennig eine mehr als dreißig Seiten umfassende Einleitung geschrieben hat, die mit energischen Strichen einige weitverbreitete Sokrates-Bilder gründlich berichtigt. Viertens hat sie dem Text weitere dreißig Seiten mit Anmerkungen beigefügt, die den Leser nicht nur über biographische und geistesgeschichtliche Details, mythologische Anspielungen und Dichterzitate gediegen unterrichten, sondern auch die philosophischen Grundaussagen des Dialogs sorgfältig freilegen. Und fünftens ließ sie sich’s nicht nehmen, den Band mit umfangreicher Bibliographie und gründlichem Register der Eigennamen wie Begriffe (griechisch und deutsch!) zu versehen. Dies sei ausdrücklich hervorgehoben, weil inzwischen sogar namhafte Verlage solche für wissenschaftliche Arbeit unerläßlichen Dienstleistungen entweder schludrig oder überhaupt nicht erbringen. Alles in allem kann man ohne Überteibung sagen, daß die jüngste Ausgabe des Meiner Verlags preiswert ist und es dem Käufer leichtmacht.
Das Lesen kann und will sie ihm natürlich nicht ersparen. Warum aber soll man Platon und ausgerechnet den „Phaidon” lesen, der ja, anders als das „Symposion”, so etwas wie eine philosophische Henkersmahlzeit darstellt? Um diese Frage zu beantworten, könnte ich auf das zu Beginn Gesagte zurückgreifen und mich auf viele autoritative Eideshelfer stützen. Whitehead und Emerson bilden ja nur die sprichwörtliche Spitze des Eisberges europäischer Platon-Begeisterung. Ich könnte von „Phaidon” als einem der großen Bücher der Weltliteratur sprechen, ihm kanonischen Rang bescheinigen, ihn als philosophischen Evergreen erweisen. Aber dies wäre nichts Neues, das hat man vielleicht schon zu oft getan. Der Deutsche, der Mitteleuorpäer des Jahres 1991 zeigt wenig Gewogenheit, abendländisch-kulturkonservativ tönenden Empfehlungen zu trauen. Der fernsehende, zeitunglesende und mit gräßlichen Tagesnachrichten gemästete Normalverbraucher, der, wie bekannt, das Gros unserer kritischen Intellektuellen stellt, wittert nichts als drohende Langeweile, wenn ihm jemand die Lektüre Platons oder auch Franz von Baaders zumutet. Deshalb sei nicht viel Zeit und Raum damit verschwendet, um zu beweisen, warum man eine fast zweieinhalb Jahrtausende alte Schrift mit Gewinn lesen kann. Was will es einem abgestumpftem Geschlecht schon besagen, daß die heiligen drei Könige durch einen Stern, der heilige Paulus durch einen Blitz, der heilige Augustinus aber durch ein Buch berufen wurde, durch den wunderbaren Weckruf: „Tolle, lege”, „Nimm und lies!” Warum noch lesen, außer um sich zu „informieren” oder um etwas zu „erleben” oder um „gebildet” zu scheinen?
Aber gibt es nicht noch ein ganz anderes, wenngleich seltenes, ein im wahrsten Sinne des Wortes „erlesenstes” Lesen? Die allermeisten Bücher lesen wir, wie gesagt, um uns zu unterrichten oder um uns zu unterhalten. Einige Titel aber sind rarer als Inkunabeln aus der Offizin des Aldus Manutius, weniger verbreitet sogar als Papyrusrollen aus Nag Hammadi oder Pergamente der Merowingerzeit. Es sind dies Bücher, die mit den andern eigentlich nur den Namen gemeinsam haben. Umgekehrt als die üblichen Bücher lesen nicht wir sie, sondern sie lesen uns. Es sind königliche oder, wie man in der vorchristlichen Antike anstandslos gesagt hätte, göttliche Bücher, die nicht nur von uns gelesen werden, sondern die in uns lesen und uns überhaupt erst zu Lesern anspruchsvollster Art werden lassen. Es ergeht uns in der Begegnung mit Büchern dieser kostbarsten Art ähnlich wie dem Dichter vor dem archaischen Standbild des Apollon: „… denn da ist keine Stelle, die dich nicht sieht. Du mußt dein Leben ändern.” Man fühlt die einsetzende Verwandlung bisweilen sofort, meistens jedoch erst im Laufe der Lektüre. Möglicherweise ist es anfänglich bloß ein diagonales Lesen, dann wird es ein Schmökern, hin und wieder regt sich sogar halb belustigter, halb entrüsteter Widerwille: War Sokrates womöglich doch ein Verrückter? Wie kann ein reifer Mann seine letzte Stunde damit vergeuden, daß er begriffsstutzigen Jüngern Argumente für die Unsterblichkeit der Seele unterbreitet? Was soll die Darlegung der Ideenlehre und der Anamnesistheorie angesichts des Schierlingsbechers? Es sind dies naheliegende Einwände, und ich gestehe, daß sich auch mir solche spöttischen Fragen aufgedrängt haben.
Aber dann kommt alles ganz anders. Man versinkt und wird zugleich getragen. Man kommt sich selbst abhanden, entgleitet der eigenen Gewöhnlichkeit, schämt sich der vorlaut geäußerten Beanstandungen, wird demütig und ineins erhoben, beschwingt und leicht wie selten zuvor. Eben habe ich noch zu lesen geglaubt; mich hier und da über das Protokoll eines antiken Abschiedsgesprächs sogar lustig gemacht; mir desgleichen manches wiederholt, was seit Nietzsches Tagen kleinlich, herablassend, empört oder denunziatorisch dem alten Platon angekreidet worden ist. Schließlich hat der aufgeklärte Leser schon in jungen Tagen etliche Lektionen von Karl R. Popper, Ernst Topitsch und einigen andern Entlarvern der „philosophia perennis” erhalten. Das stimmt, und ich gebe auch heute noch zu, daß manches davon durchaus bedenkenswert ist. Insbesondere das, was der leider nur Verfassungsjuristen, Staatsrechtlern und Rechtstheoretikern bekannte Hans Kelsen (1881 - 1973) dem Platon am Zeuge geflickt hat, ist nicht auf die leichte Achsel zu nehmen. Dies alles sei zugegeben und auch an dieser Stelle mit Bedacht festgehalten. Aber im Vergleich zu den Augenblicken der Verwandlung, die dem hingerissenen „Phaidon”-Leser widerfuhr, hat solche Kritik plötzlich weniger Gewicht als früher. Eingangs bewunderte er vor allem die dialektische Wendigkeit des unermüdlichen Debatters Sokrates, der seine halb pythagoreisch, halb materialistisch infizierten Gesprächsteilnehmer wahrlich „unter-redet”, mit seinen logisch-axiomatischen Netzen und feingesponnenen Unterscheidungen niederringt Alsbald hörte diese Art von Bewunderung zwar nicht auf, doch wurde sie übertroffen von einem tiefer greifenden Erstaunen, jenem Erstaunen, das Sokrates selbst in einem anderen Dialog als Ursprung des Philosophierens bezeichnet hat.
Staunend begann der die „Phaidon”-Übersetzung von Barbara Zehnpfennig Lesende aufzuhorchen und zu horchen und nochmals zu horchen. Er lauschte dem Sokrates, während abendliches Sonnenlicht auf den Bergen rings um Athen lag. Luther soll gesagt haben, er würde auch dann noch ein Bäumchen pflanzen, wenn in der nächsten Stunde die Welt unterginge. Nun, Sokrates hatte einmal freimütig bekannt (horribile dictu!), daß ihm Bäume nicht sehr viel zu sagen hätten. Er pflanzte stattdessen Gedankenkeime in die Intelligenz Athens, vor allem aber jätete er kräftig das Unkraut der Gedankenlosigkeit aus. Bildung bestand für ihn nicht darin, möglichst viel zu wissen. Bildung heißt zuallererst: zu wissen, wovon man selber spricht und was man ständig stillschweigend voraussetzt, ohne es bewiesen zu haben, vielleicht auch ohne es jemals zu können.
Wunderbar sind die im Zusammenhang damit dargelegten Gedanken über die geistverderbende „Misologie” — was im Griechischen sowohl Rede- und Wortfeindschaft als auch Sinn- und Vernunftfeindschaft bedeutet. Wer dieser Geisteskrankheit, die jede sachbezogene Erörterung von vornherein verhindert, soweit wie möglich entgehen will, muß sich an Sokrates’ von ihm selbst bis zum letzten Atemzug vorgelebte Lebensregel halten: Bevor du den „logoi” — den Worten und Sinngehalten — Widersprüche unterstellst, suche diese in dir; wenn dir etwas unverständlich erscheint, dann sage nicht voreilig, daß es absurd sei, sondern gib vorerst einmal deinem eigenen Unverstand die Schuld. Wer dies einmal sich zu Herzen genommen hat, wird kaum behaupten wollen, daß das — von wenigen Schriften abgesehen — bei Platon durchgängig von Sokrates geübte Verfahren dialogischer Wahrheitssuche bloß ein artistischer Kniff sei. Sokratische Dialogik erscheint dann nicht als etwas Äußerliches, Zufälliges und Formales, sondern als Wesenszug der Philosophie dieses seltsamen Mannes, der — ähnlich wie Buddha, Pythagoras und Jesus — nur mündlich gelehrt, aber kein einziges Buch geschrieben hat. Das dialogische Vorgehen, in dem ein Menschlich-Allgemeines sich bis zu hellster Weißglut läutert, bringt Hölderlins schöner Vers auf die kürzeste Formel: „Seit ein Gespräch wir sind und hören voneinander.” Sokrates, der, wie Christus und Dionysos, bei Hölderlin immer wieder anwesend ist, manchmal namentlich ungenannt, aber bildkräftig beschworen:
Die ewigen Götter sind
Voll Lebens allzeit; bis in den Tod
Kann aber ein Mensch auch
Im Gedächtnis doch das Beste behalten,
Und dann erlebt er das Höchste.
Nur hat ein jeder sein Maß.
Denn schwer ist zu tragen
Das Unglück, aber schwerer das Glück.
Ein Weiser aber vermocht es
Vom Mittag bis in die Mitternacht,
Und bis der Morgen erglänzte,
Beim Gastmahl helle zu bleiben.
Diesem Sokrates horchte ich zu, wie einer Stimme, die zu mir spricht Mit einem Male verstand ich, was das skandalöse Wort bedeuten könne, daß die rechten Philosophen „nichts anderes betreiben als zu sterben.” Ich ahnte, was Sokrates wohl meint, wenn er, mythische Bilder aufgreifend, von den Läuterungsverfahren in der Unterwelt und von den „reinen Wohnungen” der Seligen spricht. Und unversehens kam mir wieder der Titel eines Buches von Herbert Keßler in den Sinn, das er dem in Bammental bei Heidelberg lebenden Betriebswirtschaftslehrer und Ordnungstheoretiker Walter Thoms in sokratischer Verbundenheit gewidmet hat: „Das schöne Wagnis” … Von diesem spricht nämlich der das irdische Leben halb feierlich, halb ironisch verabschiedende Sokrates. Nachdem er von Tempeln erzählt hat, in denen statt der Götterbilder wirkliche Gottheiten gegenwärtig, und von „schöneren Wohnungen”, die nach dem Tode den wahren Philosophen zugedacht seien, fügt er hinzu: „Schon um dessentwillen muß man alles tun, um an Trefflichkeit und Vernunft im Leben Anteil zu haben. Denn schön ist der Preis und die Hoffnung groß. Allerdings fest zu behaupten, daß sich das so verhält, wie ich es vorgetragen habe, gehört sich nicht für einen vernünftigen Menschen. Daß es jedoch diese oder eine ähnliche Bewandtnis haben muß mit unseren Seelen und ihren Wohnungen, da doch die Seele offenbar todlos ist, das scheint sich mir zu gehören und wert zu wagen, daß man glaube, es verhalte sich so — denn schön ist das Wagnis; und man muß sich damit wie mit Beschwörungen selbst heilen …”
Es ist auch ein schönes Wagnis, den uralten und immer wieder neuen, durch kundige Übersetzung erfrischend verjüngten, aber nirgendwo billig aktualisierten „Phaidon” zu lesen. Einer von dem hellenistischen Dichter Kallimachos festgehaltenen Legende zufolge hat sich einer der allerersten Leser dieses Platonischen Dialogs das Leben genommen, indem er ausrief: „Sonne, leb wohl!” Nun, er hat offenbar des Sokrates eigene Warnung überlesen, daß man nicht davonlaufen solle, da wir Menschen nicht uns selbst gehören, sondern den Göttern. Gewiß, Philosophie ist Sterbenlernen, Einübung in die ars moriendi, wie Sokrates mehrmals herausfordernd erklärt, wobei man ihn sich freilich nicht griesgrämig, sondern lächelnd vorstellen muß. Philosophie ist Sterbenlernen, das richtige Leben aber eines der Philosophie. Das bedeutet aber keineswegs Vorbereitung auf den Selbstmord als zerebraler Dauerauftrag. Es bedeutet auch nicht „Sein zum Tode” im Stil Martin Heideggers oder Weltflucht nach Art einer gnostizistisch verdrehten Asketik. Eher darf man dabei schon an „Euthanasie” im ursprünglichen und schuldlosen Wortverstand denken: an leichten Tod, der dankbar, gelassen oder auch neugierig empfangen wird, nachdem für den Grabstein zwei Inschriften erdacht worden sind — für die Vorderseite: „Einmal und nie wieder!”, für die Rückseite: „Nun geht’s erst richtig los!” Sowenig das apollinische Gebot „Erkenne dich selbst!” eine Aufforderung zu hypochondrischem auf der Lauer Liegen vor der Höhle des eigenen Befindens enthält, sowenig ist platonisch vermittelte Sokratik morbide Verliebtheit in den Tod. Sie ist, wie keinem genauen Leser entgehen kann, weniger eine abgesonderte Lehre mit genau festgesetzten Inhalten, denn eine kritische Methode, bereits angebotene Erklärungsversuche durch vernünftige Unterredung zu prüfen, zu ordnen und zu begründen. Und Philosophie als Einübung ins Sterben ist dann bloß eine drastische Formel für das, was die unaufgebbare Voraussetzung geistiger Kultur ist. Sie ist der Inbegriff eines von triebhaftem Zwang losgelösten, zur zuchtvollen Beherrschung (nicht Ausrottung) der unteren Mächte fähigen Lebens. Sie ist tätige Kontemplation, asketische Humanität, Aufbruch ins Wesentliche oder, wie man noch zu Goethes Zeit zu sagen wagte, die Bestimmung des Menschen, sofern er sich nicht damit begnügen will (und er kann es eigentlich gar nicht), bloß eine zoologische Spezies zu sein.
Sokrates, wie ihn Platons „Phaidon” zeichnet, verkörpert zum ersten Male in der uns bekannten Geschichte ein Menschentum, das einerseits vom heiligen Ernst unablässiger Wahrheitssuche, andrerseits von einer bis zuletzt sieghaften Heiterkeit erfüllt ist — wobei diese als zarteste und zugleich unbezwingbare Blüte philosophischer Anstrengung erscheint. Freudigen Ausdruck findet in ihr die lebensgeprüfte Erfahrung dessen, der jenseits der Angst steht, weil er einer gründenden Wahrheit gewiß ist, die, auch wenn das Schlimmste geschieht, von keiner Bosheit und Lüge getrübt zu werden vermag. Der in dieser Wahrheit gründende Märtyrer darf sagen: „Morior, ergo sum”, „Ich sterbe, also bin ich” — denn das, was sterben kann, ist gar nicht das im Gleichnis des „Ich” gemeinte Eine, Unversehrbare und Ewige. Was absterbend vergeht, ist nicht „Ich” und bin ich nicht. Tod bedeutet nicht Untergang, sondern Freilegung des ideenhaften Prinzips in uns. Wer den „Phaidon” aufmerksam liest, wird sich davon überzeugen können, daß Philosophieren in sokratisch-platonischem Stil, entgegen modernistischen Vorurteilen, nicht das geringste mit Weltverachtung, Leibfeindschaft und Todesdienst zu tun hat. Es nimmt allerdings, unabhängig von konfessioneller Bindung, das biblische Wort sehr ernst, das Luther so übersetzt hat: „Und was nutz hette der Mensch / ob er die gantze Welt gewünne / Und verlüre sich selbs / oder beschediget sich selbs?” (Lukas 9, 25) Solche Übereinstimmung gibt zu denken, wie bereits im vorangehenden angedeutet. Auch wenn es eine neuere Theologie nicht wahrhaben will, halte ich daran fest, daß Christentum und Platonismus, ungeachtet der verschiedenen Ebenen, nicht bloß durch einen absonderlichen Zufall jahrhundertelang Verbündete waren. Dies gilt keineswegs nur für die von griechisch-byzantinischem Geisteserbe durchsäuerte Welt der Ostkirche, sondern auch für den römisch-germanisch-keltisch geprägten „Westen”. Das beweisen Augustinus, Boethius, Johannes Scotus Eriugena, Anselm von Canterbury (der aus Aosta stammt), Pico della Mirandola, Leibniz, Novalis, Friedrich Schlegel, Maine de Biran, Othmar Spann, Amadeo Silva-Tarouca, Louis Lavelle, Michele Federico Sciacca und viele andere.
Doch kehren wir zurück zu Sokrates’ Testament „Phaidon”, diesem Buch, dem das Vorrecht zukommt, in uns zu lesen, uns zu prüfen und — im glücklichsten Falle — uns zu guten Lesern zu bilden! Man kann oft hören, daß Philosophie wirklichkeitsfremd sei. Doch dies trifft nur in oberflächlichstem Sinne zu. Ist das menschliche Herz, weil es tief unter unserer Haut schlägt, deshalb ein lebensferner und überflüssiger Körperteil? Dem durch „Phaidon”-Lektüre zum besinnlichen, zum andächtigdankbaren Leser gewordenen Zeitgenossen wird die Antwort nicht schwerfallen: Platons Philosophie ist mitsamt ihrem sokratischen Herzen keine überlebte Philosophie des Todes, sondern eine lebenbildende Philosophie des Lebens, welche Schlußfolgerung auch die „Phaidon”-Herausgeberin Barbara Zehnpfennig zieht: „Denn die Suche nach der Erkenntnis der Form ist nicht Verachtung des Stoffs; sie ist Ausdruck des Willens, den Stoff zu verstehen. Das Streben nach Vernunft ist nicht Verachtung des Körpers; es ist Ausdruck des Willens, mit dem Körper und dem Körperlichen vernünftig umzugehen. Vernunft ist aber das Transcendens schlechthin, die Ewigkeit in der Zeit. So ist das vernünftige Dasein … ein ‚Sein zum Leben’, das das Leben nicht vom Tod, sondern den Tod vom Leben her versteht.”
(1991)