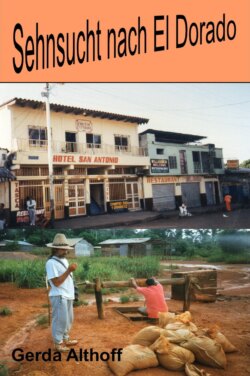Читать книгу Sehnsucht nach El Dorado - Gerda Althoff - Страница 7
Kapitel 5
ОглавлениеDer zehnstündige Flug verlief außergewöhnlich ruhig und so waren wir alle bester Laune, als wir in Caracas bei dreißig Grad Außentemperatur aus dem Flieger stiegen. Sogar bei Ruth war ein leichtes, zufriedenes Lächeln im Gesicht zu erkennen. Wir landeten pünktlich auf die Minute in Venezuelas Hauptstadt und meine Aufgabe war es jetzt, ein geeignetes Transportmittel zu finden, das uns zu unserem Hotel nach Macuto brachte. Ein normales Taxi war natürlich zu klein für uns sechs, deshalb musste ich nach einem Minibus Ausschau halten. Vor einem Flughafen natürlich gar kein Problem, wichtig war nur, einen fairen Preis auszuhandeln. Wie fast überall auf der Welt, wurden auch hier Touristen als Freiwild betrachtet, die man hemmungslos ausnehmen wollte. Wenn man aber den Eindruck erwecken konnte, dass man zwar Ausländer ist, aber die ortsüblichen Preise kennt, war es keine große Sache, die auch zu bekommen. Ich hatte einige Übung darin, verhandelte kurz mit dem Fahrer eines blauen Minibusses und eine halbe Stunde später erreichten wir das „Hotel Alamo“, direkt an der Küste gelegen und nur durch eine Straße vom Meer getrennt.
„Ganz schön schwül, gibt bestimmt noch Regen“, meinte Horst und starrte, wie zur Unterstreichung seiner Vermutung, demonstrativ in den mit Wolken verhangenen Himmel.
„Da kannst du Recht haben“, stimmte ich ihm zu.
„Lasst uns erst einchecken, ein bisschen frisch machen und dann treffen wir uns hier wieder zu einem ersten kleinen Erkundungsgang, bevor es tatsächlich noch anfängt zu regnen“, schlug ich vor.
Ohne Widerspruch trabten die fünf hinter mir her, Richtung Rezeption. Die Zimmerverteilung war klar. Die beiden Ehepaare je ein Doppelzimmer, Ruth und ich teilten uns ebenfalls eins.
Eine halbe Stunde später trafen wir uns vor dem Eingang des Hotels wieder, um Macuto, diesen kleinen, unscheinbaren Badeort vor der Küste Caracas, etwas näher zu betrachten. Inzwischen begann es langsam zu dämmern und es würde kaum zehn Minuten dauern, bis die Dunkelheit uns vollends erfasste. Hier in der Nähe des Äquators vollzog sich der Wechsel vom Tag zur Nacht innerhalb von Minuten. Für einen kleinen Spaziergang reichte es aber allemal und außerdem war ja die Straße, die am Strand entlang führte, beleuchtet. Wie Horst schon vorausgeahnt hatte, begann es zu regnen, kaum dass wir uns hundert Meter vom Hotel entfernt hatten.
„Das war aber ein kurzer Spaziergang“, sagte Gudrun enttäuscht.
„Okay, gehen wir ins Hotel zurück und trinken einen Schluck. Morgen früh werden wir das nachholen“, versprach ich ihr.
Sie akzeptierte meinen Vorschlag bereitwillig, wie auch die anderen und wir beeilten uns zum Hotel zurückzukommen, denn der Regen wurde immer heftiger. Aus dem Drink wurde aber letztendlich auch nichts, allgemeine Müdigkeit machte sich plötzlich breit. Kein Wunder, denn in Deutschland war es bereits drei Uhr morgens.
„Holen wir morgen alles nach. Und jetzt schlaft gut, ich muss zugeben, ich bin auch hundemüde. Komm Ruth, gehen wir in die Koje, damit wir morgen fit für neue Taten sind.“
„Welche Zimmernummer haben wir noch mal?“ wollte Ruth wissen.
„Die gleiche wie vorhin, Nummer sieben“, ich dachte mir nichts weiter dabei, als ich das sagte, aber ein Blick in Ruths Gesicht zeigte mir, dass es falsch war.
„Entschuldigung, war nicht böse gemeint“, versuchte ich meinen Fauxpas wieder gutzumachen. Wie ich schon vorher bemerkt hatte, war sie äußerst sensibel und der Stress des langen Fluges und die Zeitverschiebung besorgten ihr Übriges. Ich durfte einfach nicht so locker und unbedacht mit meinen Worten umgehen.
„Schon gut“, murmelte sie.
Die nächsten viereinhalb Wochen würden wir Tag und Nacht zusammen verbringen und ich machte mir ernsthaft Gedanken, ob es mit ihr gut gehen würde. Aus Erfahrung wusste ich, dass eine einzelne Person die ganze Gruppe vergiften kann und das musste ich unter allen Umständen verhindern. Diese Reise sollte für alle das Abenteuer ihres Lebens werden, an das sie immer gerne zurück denken sollten.
Als ich im Bett lag und über den weiteren geplanten Ablauf nachdachte, fragte ich mich, ob ich mir da nicht zu viel zugemutet hatte. Solche Gedanken halfen mir jetzt aber nicht, ein Zurück gab es zu diesem Zeitpunkt längst nicht mehr.
Ruth schlief bereits und schnarchte leise vor sich hin.
Ich spielte im Geist sämtliche Katastrophen durch, die meiner Meinung nach in den kommenden Wochen passieren konnten und das waren nicht wenige. Das grenzt schon an Masochismus war mein letzter Gedanke, bevor ich endlich einschlief.
Die Nacht verlief unruhig, ich wachte schweißgebadet auf und mein Herz klopfte wie wild. Schlaftrunken wankte ich ins Badezimmer, wischte mir den Schweiß aus dem Gesicht und riskierte einen Blick in den Spiegel, was ich besser hätte bleiben lassen sollen. Was ich da sah war furchterregend, ich schien um mindestens zehn Jahre gealtert. Die Augen eingefallen und die Haut grau und faltig. Schnell fuhr ich mir mit dem kalten Waschlappen durchs Gesicht und beeilte mich, wieder ins Bett zu kommen. Seltsamerweise schlief ich schnell wieder ein und wachte erst durch den Lärm auf, den Ruth im Bad veranstaltete. Es raschelte und klapperte und als etwas klirrend auf den Boden fiel, war ich vollends wach. Ich rieb mir die Augen und sah auf die Uhr. Noch keine sechs Uhr, Ruth war ja wohl wahnsinnig, so früh aufzustehen!
„Ruth, weißt du eigentlich wie spät es ist!“
"Es ist kurz vor sechs." antwortete sie ohne jedes Schuldbewusstsein.
„Ich bin gleich fertig, dann kannst du ins Bad", fügte sie noch hinzu.
Das sollte keine Frage, sondern eine Beschwerde sein, aber Ruth sah das wohl anders. Es brodelte in mir und gerne hätte ich ihr gesagt, wie ich darüber dachte, aber ich riss mich zusammen. Ich musste noch mehr als vier Wochen mit ihr auskommen und sie hatte in den letzten Tagen schon mehrfach bewiesen, wie empfindlich sie war. Es wäre bestimmt nicht gut, wenn unsere Reise schon zu Beginn durch solche Lappalien belastet würde.
"Lass dir ruhig Zeit, ich muss erst einmal richtig wach werden", antwortete ich stattdessen, drehte mich auf die andere Seite und schloss wieder die Augen.
Es half alles nichts, als Ruth kurze Zeit später aus dem Bad kam, blieb mir nichts anderes übrig, als auch aufzustehen. Missmutig nahm ich mein Waschzeug, trottete zum Waschbecken und wusch mich mehr oder weniger gründlich. Manche würden es eine Katzenwäsche nennen, aber ich fand, es reichte. Wir hatten uns für acht Uhr zum Frühstück verabredet und so blieb noch eine Menge Zeit, aber für was eigentlich? Den Ablauf des heutigen Tages hatte ich bis ins Detail im Kopf. Einen kleinen Erkundungsgang am Strand von Macuto entlang, dann mit einem Puesto nach Caracas rein. Zuerst Besichtigung der Altstadt und später mit der Metro in die Neustadt. Damit war der Tag ausgefüllt.
"Lass uns doch noch ein bisschen vor die Tür gehen und die frische venezolanische Luft schnuppern", schlug Ruth vor und da mir auch nichts Besseres einfiel, stimmte ich ihr zu.
Zu unserer Überraschung trafen wir draußen auf Maria und Horst und etwa hundert Meter weiter entdeckten wir auch Gudrun und Willi. Das konnte nur der Jetlag sein, der ihren Schlaf so durcheinander gebracht hatte.
Zusammen flanierten wir am früh morgendlichen Strand von Macuto entlang. Strand konnte man eigentlich nicht dazu sagen, das Ufer bestand aus kleinen Felsen und Steinen, aber ungefähr zweihundert Meter weiter war ein kleiner Sandstrand zu erkennen. Die Männer hatten schon kurze Hosen an, obwohl es zu dieser frühen Stunde noch reichlich frisch war. Horst hatte natürlich seine Videokamera umgehängt und Ruth sah mit ihrem bunten Shirt und dem blauen Käppi richtig putzig aus.
Auf der Straße herrschte schon reger Betrieb. Berufsverkehr und Smog machten auch vor der "Dritten Welt" nicht halt, denn Arbeit gab es hauptsächlich im circa fünfundzwanzig Kilometer entfernten Caracas. Von der Fischerei und den wenigen Touristen, die sich nach Macuto verirrten, konnten die Leute nicht leben. Die meisten von ihnen nutzten eines der unzähligen Puestos, wie man die kleinen Busse hier nannte, die den ganzen Tag zwischen Zentrum und Vororten hin und her fuhren.
Sie waren zwar nicht sehr bequem und fast immer hoffnungslos überfüllt, dafür aber unschlagbar billig. Mit ihnen konnte man in jeden Winkel der Stadt gelangen. Es gab keine festen Haltestellen sondern sie hielten immer dort, wo jemand ein- oder aussteigen wollte.
„Mit so einem werden wir nach dem Frühstück in die Stadt fahren“, sagte ich und zeigte auf einen gerade vorbeifahrenden Minibus.
„Das ist nicht dein Ernst“, ungläubig schaute Ruth mich an.
„Guck doch mal, wie zusammengequetscht die da drin sitzen.“
„Ja, so ist das eben in Südamerika, manchmal muss man eng zusammen rücken. Das ganze Leben hier ist viel intensiver als in Europa“, antwortete ich.
„Was die können, können wir auch, ich möchte dann gerne zwischen zwei Frauen sitzen.“
Das konnte wieder mal nur von Horst kommen. Der erwartete Seitenhieb blieb aber diesmal aus, stattdessen konterte Maria: “Und ich möchte gern zwischen zwei muskulösen Männern sitzen.“
War das wirklich seine Maria, die das sagte? Horst machte einen leicht verwirrten Eindruck, so kannte er seine Frau gar nicht und schließlich waren die beiden schon fast vierzig Jahre verheiratet. Er wusste auch nicht, was er darauf antworten sollte. Schweigend gingen wir zurück zum Hotel. Ab sieben Uhr gab es Frühstück und ein Blick auf die Uhr sagte mir, dass es gleich soweit war. Mir knurrte auch schon der Magen, denn in Deutschland war es bereits fast drei Uhr nachmittags, also längst schon Zeit fürs Mittagessen.
Als ob sie meine Gedanken erraten hätte, sagte Gudrun plötzlich:
“Mensch hab ich einen Hunger.“
„Ja, ich auch“, ertönte es fast gleichzeitig aus vier Mündern.
Ich sah demonstrativ erneut auf die Uhr.
„Noch zwei Minuten, Toilette, Hände waschen und dann treffen wir uns im Speiseraum, okay?“
Ich erwartete nicht wirklich eine Antwort darauf und schloss die Tür unseres Zimmers auf. Nachdem auch Horst die Tür ihres Zimmers geöffnet hatte, schubste Maria ihn zur Seite und rannte die wenigen Meter zum Bad, um augenblicklich darin zu verschwinden. Von dem war nur ein ärgerliches „verdammt“ zu hören.
„Was ist los?“ fragte ich ihn.
„Ständig will sie zuerst ins Badezimmer und hat es auch diesmal wieder geschafft“, beschwerte er sich.
Bloß gut, dass ich allein lebe, dachte ich, dann brauche ich mich zumindest nicht darum zu prügeln, wer zuerst ins Bad darf. Im gleichen Moment huschte Ruth an mir vorbei. Sollte sie ruhig, ich hatte keine Eile. Im Dschungel gab es eh kein Bad und auch auf manch andere Bequemlichkeiten musste man dort verzichten, so sollte sie ruhig noch die letzten paar Tage genießen, an denen es klares, fließendes Wasser gab und man nur auf einen Schalter drücken musste, um Licht zu haben. Ich war sowieso gespannt, wie Ruth sich im Dschungel verhalten würde. In dieser Beziehung konnte ich sie noch nicht richtig einschätzen und sollte mich später noch gehörig wundern.
Der Speiseraum war klein und mit einfachen Stühlen und Tischen aus Holz eingerichtet. Wir waren die einzigen Gäste und der Kellner, der gerade damit beschäftigt war, einen der Tische für uns zu decken, bat uns Platz zu nehmen.
Wie schon erwähnt, waren wir durch die Zeitverschiebung ziemlich hungrig und dem zur Folge intensiv mit dem Frühstück beschäftigt, statt uns zu unterhalten.
„Ich bin satt“, unterbrach Willi als erster die Stille.
„Iss noch einen Toast, wer weiß, wann du das nächste kriegst“, ermahnte ihn seine Frau, aber er winkte nur ab.
„Nein, ich kann nicht mehr.“
Nach und nach legten wir Messer und Gabel beiseite.
„Das tat gut“, seufzte Maria und rieb sich den Bauch.
Besonders gut war der Kaffee, darin waren wir uns einig, aber das war ja kein Wunder, schließlich wurde er hier angebaut und die Leute verstanden was davon.
Kurz darauf standen wir vor dem Hotel am Straßenrand und ich hielt Ausschau nach einem Puesto, das in Richtung Stadt fuhr. Die Destinationen der Minibusse waren mit weißer oder schwarzer Farbe groß auf die Windschutzscheibe geschrieben, so dass man es schon von weitem lesen konnte. Wir brauchten einen wo „Centro“ draufstand, der also ins Zentrum von Caracas fuhr und das waren die meisten. Außerdem musste ich noch darauf achten, dass es mindestens sechs freie Plätze gab und da wurde es schon schwieriger. Inzwischen war es acht Uhr geworden und der Berufsverkehr immer noch in vollem Gange. Immerhin spielte das Wetter mit, kein einziges Wölkchen war am Himmel zu sehen und die Sonne schien mit jeder Minute etwas intensiver zu strahlen.
„Wenn das so weiter geht, werden wir zu Fuß ins Zentrum gehen müssen“, sagte Ruth leicht frustriert.
„Oder ein Taxi nehmen“, schlug Horst vor.
„Da bräuchten wir schon zwei Taxis und das würde ganz schön teuer, bis in die Stadtmitte sind es immerhin achtundzwanzig Kilometer“, gab ich zu bedenken.
Der Reisepreis, den ich veranschlagt hatte, war äußerst knapp kalkuliert und solche Extras waren darin nicht berücksichtigt.
„Außerdem wollen wir doch das normale venezolanische Leben kennenlernen, oder nicht?“
„Da hast du Recht“, stimmte Maria mir zu.
“Ich glaube da kommt eins, „Centro“ steht drauf und genügend freie Plätze scheint es auch zu geben“, sagte ich, während ich die Hand hob, um dem Fahrer ein Zeichen zu geben, dass er anhalten sollte, was dieser auch augenblicklich tat.
Nachdem wir alle eingestiegen waren und ich bezahlt hatte, fuhr er weiter, bis er wieder anhalten musste, weil jemand am Straßenrand stand und mitfahren wollte. Die Fahrt dauerte fast eine Stunde, denn wegen des immer noch andauernden Berufsverkehrs und der ständigen Stopps, wenn Leute ein- oder aussteigen wollten, kamen wir nur langsam voran.
„Wir sind angekommen“, sagte ich endlich und rief laut „bajar“, was auf Spanisch übersetzt, „aussteigen“ hieß. Der Fahrer hielt augenblicklich am Straßenrand und ließ uns aussteigen. Es war nur eine kurze Strecke bis in die Altstadt und bald erreichten wir den Plaza Bolivar. Einen solchen Platz gab es in fast jeder kleinen oder großen Stadt in Venezuela den Mittelpunkt darstellte. In der Mitte stand eine große Statue von Simon Bolivar, dem Nationalhelden, der Venezuela von den spanischen Besetzern befreit hatte und auf der jetzt kleine schwarze Eichhörnchen herumtollten. Seine Gebeine fanden übrigens im Panteon, das sich ebenfalls in Caracas befand, seine letzte Ruhe.
Ruth setzte sich sofort auf eine der Bänke, die rund um die Statue standen.
„Schon müde vom Sitzen?“
Ich brauche wohl nicht extra zu erwähnen, von wem diese Bemerkung kam. Erstaunlicherweise war Ruth nicht wie sonst sofort beleidigt, sondern ignorierte ihn einfach. Anscheinend war sie doch lernfähig, was mich innerlich beruhigte, denn Stress durch so einen Blödsinn konnte ich nicht gebrauchen. Nachdem ich die fünf noch einmal darauf hingewiesen hatte, sehr gut auf Geld, Uhr und alles was wertvoll ist, aufzupassen, konnte es losgehen. Alle wichtigen Sehenswürdigkeiten in der Altsstadt waren bequem zu Fuß zu erreichen, unter anderem das alte Kloster, das Geburtshaus Simon Bolivars, das Casa Amarilla, Sitz des Außenministeriums und nicht zuletzt die nach französischem Vorbild erbaute Kirche Santa Capilla. Der Höhepunkt war ohne Zweifel das Capitolio National, Sitz der venezolanischen Regierung. Die große goldene Kuppel leuchtete majestätisch über der Altstadt. Das Gebäude selbst war von Palmen umsäumt und was das Beste war, man durfte es sogar besichtigen. Wir betraten den großen Kuppelsaal und waren überwältigt. Auch für mich war es das erste Mal, dass ich dieses imposante Bauwerk betrat. Das Innere der Kuppel war mit herrlichen Motiven aus der Geschichte des Landes bemalt und an den Wänden hingen dutzende Gemälde von bedeutenden venezolanischen Personen.
„Das sieht eher aus wie ein Museum, als wie ein Parlament“, meinte Gudrun und in ihrer Stimme war deutlich die Begeisterung zu spüren, die sie empfand.
Wir stimmten ihr zu und genossen noch eine Weile diesen überragenden Anblick.
Unser letzter Besichtigungspunkt in der Altstadt war die schon erwähnte Santa Capilla. Das Besondere an ihr war wohl nur die für Südamerika ungewöhnliche Bauweise, ansonsten hatte ich schon schönere Kirchen gesehen. Interessant dagegen war, was auf dem kleinen Platz vor der Kirche geschah. Horst wollte gerade seine Videokamera wieder einpacken, als unsere Aufmerksamkeit auf eine kleine Familie gelenkt wurde. Vater, Mutter und eine ungefähr zwanzig-jährige Tochter. Sie schrieen sich gegenseitig an und schubsten sich, bis das Ganze schließlich eskalierte und der Vater seinen Gürtel aus der Hose zog. Jetzt ging es erst richtig los. Der Mann schien ziemlich angetrunken und torkelte herum. Dabei versuchte er seine Frau mit dem Gürtel zu schlagen. Im Gegensatz schlug die Tochter mit ihrer Handtasche auf den Vater ein, während die Mutter in Boxstellung ging. Mit geballten Fäusten stand sie ihrem Mann gegenüber und als er das nächste Mal nach ihr schlug, griff sie den Gürtel und zog so kräftig daran, dass der Mann zu Boden fiel. Da sie aber den Gürtel nicht losließ, fiel sie selbst auch mit hin. Während die Beiden noch auf der Erde lagen, versuchte die Tochter ihre Tasche, die der Vater geschnappt hatte, als sie nach ihm schlug, wieder zu bekommen. Ein kurzer Ruck seinerseits und die Tochter fiel ebenfalls um. Das sah so lustig aus, wie sie da wie Maikäfer auf dem Rücken lagen, dass wir unwillkürlich lachen mussten. Inzwischen hatte sich schon eine ansehnliche Gruppe um die drei versammelt, die das Schauspiel ebenfalls gespannt verfolgte. Da sich die Streithähne nicht ernsthaft verletzten, sah auch keiner einen Grund einzugreifen. Die Polizei schien das anders zu sehen. Plötzlich erschienen zwei Polizisten auf Motorrädern und beendeten abrupt den Streit. Sie trennten die Streitenden, ließen dann zuerst die Frauen gehen, während sie den Mann noch dabehielten, später aber auch den laufen ließen.
„Schade“, seufzte Horst und schaltete die Kamera ab.
„Denk dran, du brauchst noch viel Platz für unsere Dschungeltour“, gab ich zu bedenken, „das wird bestimmt interessant.“
Damit war das Morgenprogramm beendet.
Die Sonne brannte heftig, es war fast Mittag, und nach einem Imbiss in einem der kleinen Restaurants wollten wir mit der Metro in die Neustadt fahren. Es herrschte reger Betrieb auf den Straßen und bis zur nächsten Station mussten wir noch ein gutes Stück laufen. Plötzlich blieb Horst stehen.
„Wartet mal, ich muss ganz dringend“, sagte er mit einem quälenden Ausdruck im Gesicht.
Wo jetzt zum Teufel so schnell eine Toilette her kriegen? Ich dachte nach, ob es hier in der Nähe eine öffentliche gab, aber die nächste war unten in der Metro Station und bis dahin waren es noch mindestens zweihundert Meter. Da entdeckte ich in der kleinen Seitenstraße, die wir gerade passierten, eine Kneipe. Horst standen mittlerweile schon Schweißperlen im Gesicht.
„Komm Horst, wir versuchen es da mal.“
Horst folgte mir wie ein kleiner Hund seinem Herrn. Schnell hatte ich dem Wirt die Dringlichkeit erklärt und hinzugefügt, dass wir auch gern dafür bezahlen würden. Der winkte aber ab und zeigte auf eine Tür neben dem Tresen. So schnell wie Horst hinter der Tür verschwunden war, lässt sich kaum beschreiben. Als er nach scheinbar endloser Zeit dann endlich wieder erschien, wirkte er sichtlich entspannter.
„Das war wirklich in allerletzter Sekunde“, schnaufte er.
„Im Dschungel wirst du diese Probleme nicht haben“, versicherte ich ihm, „da gehst du einfach hinter den nächsten Busch.“
„Dann lass uns schnell in den Dschungel gehen, ich glaube, ich habe mir was eingefangen“, erwiderte er grinsend.
Wir verließen den rettenden Ort, nicht ohne uns ein weiteres Mal bei dem Wirt zu bedanken.
„De nada“, war seine Antwort, was frei übersetzt so viel hieß wie, „nicht der Rede wert.“
Wir beeilten uns zu Gudrun, Willi, Maria und Ruth zurück zu gehen, sie würden sich bestimmt schon Sorgen machen, wo wir so lange blieben. Da keiner von ihnen ein Wort Spanisch sprach, waren sie allein auf sich gestellt, in Caracas verloren. Hier gab es immer genügend Ganoven, die die Hilflosigkeit von Ausländern schamlos und brutal ausnutzten, sie in irgendeine dunkle Ecke führten und ausraubten. Man konnte da noch von Glück sagen, wenn man heil aus der Sache wieder raus kam.
Die vier standen noch genau an der gleichen Stelle, wo Horst und ich sie verlassen hatten und waren sichtbar froh, als sie uns kommen sahen.
Also weiter zur Metro Station, Ticket kaufen und weiter in die Neustadt.
Als wir die Metro verließen schien es, als ob wir uns in einem anderen Land befänden. Moderne Hochhäuser, schicke Läden, eine geschmackvoll gestaltete Fußgängerzone und natürlich auch McDonalds und Burger King.
„Das ist vielleicht ein krasser Unterschied“, meinte Gudrun, sichtlich beeindruckt.
„Bei uns ist es nicht viel anders. Da gibt es kleine Gassen mit Häusern aus dem sechzehnten Jahrhundert und einige Meter weiter moderne Hochhäuser“, gab ich zu bedenken.
„Ja, da hast du wieder mal Recht“, stimmte sie mir zu.
Wir bummelten gemächlich durch die Sabana Grande, die Hauptgeschäftsstraße in der Neustadt, gönnten uns, mit Ausnahme von Horst, ein „echt italienisches Eis“, wie auf dem Schild einer kleinen Eisdiele zu lesen war und machten eine ausgedehnte Pause auf einer der zahlreichen Bänke. Die Leute, die hier entlang spazierten unterschieden sich deutlich von denen in der Altstadt, sie waren in der Regel viel besser gekleidet und nicht wenige trugen große Einkaufstaschen mit sich.
Hier und da gab es kleine Verkaufsstände, an denen Artikel für den täglichen Gebrauch angeboten wurden. Während wir noch mit unserem Eis beschäftigt waren, rief plötzlich einer der Verkäufer: „Viene aqua!“ Wasser kommt!
In wilder Hast rafften alle Händler ihre Waren zusammen und verschwanden so schnell sie konnten in einer der kleinen Gassen, die von der Hauptstraße abzweigten.
„Was war das denn?“ fragte Ruth, sichtlich erschrocken.
Ich klärte sie auf.
„Die Leute hier haben keine Erlaubnis etwas zu verkaufen und wenn ein Kontrolleur kommt oder die Polizei, warnen sie sich gegenseitig und rufen: „Viene aqua“, das Zeichen, möglichst schnell zu verschwinden.“
„Gar nicht so dumm“, sagte Maria anerkennend.
Wir blieben noch eine Weile so sitzen und beobachteten schweigend die Menschen die mal hastig, mal betont lässig an uns vorbei gingen.
Mit fortschreitender Zeit wurde die Sonne schwächer, ein Zeichen, dass wir uns langsam auf die Rückfahrt nach Macuto machen mussten, denn ich wollte mit den Fünfen nicht im Dunkeln in Caracas herumlaufen. So nahmen wir die nächste Metro zurück in die Altstadt, wo sich der große Busbahnhof Nuevo Circo befand, dem Start- und Endpunkt aller Busse und Puestos in Caracas.
Bevor wir uns in das organisierte Chaos stürzten, ermahnte ich meine kleine Gruppe zusammenzubleiben und besonders gut auf ihre Wertsachen aufzupassen. Das Menschengewühl war einfach unbeschreiblich. Fahrgäste, Imbissverkäufer, Anwerber der Busgesellschaften, die nach Fahrgästen suchten und natürlich jede Menge Diebe und Betrüger. Obwohl man es nicht vermuten würde, gab es hier doch eine gewisse Ordnung. Busse, die zur Küste hin fuhren, fand man zum Beispiel am nördlichen Rand des Platzes und da gingen wir jetzt hin. Die Fahrzeuge, die dort standen, sahen alles andere als vertrauenswürdig aus und ich bemerkte Ruths zweifelnden Blick.
„Da sollen wir rein?“, fragte sie und sah mich mit ungläubigem Blick an.
„Du wolltest doch Abenteuer“, erwiderte ich grinsend, “hier ist es!“
War sie wirklich für den Dschungel geeignet? Die Antwort darauf würde ich erst bekommen, wenn wir da waren.
Während ich noch überlegte, welches dieser verrosteten Vehikel das richtige war, stand auch schon ein junger Mann vor mir und fragte mich, wohin es denn gehen sollte.
„Macuto“, gab ich ihm zur Antwort.
Er gab uns einen Wink ihm zu folgen und führte uns dann zu einem wirklich schrottplatzreifen, mit Beulen übersäten Bus, der außerdem noch grellbunt bemalt war.
„Können wir nicht ein Taxi nehmen?“, fragte Ruth.
Ihre Stimme klang ängstlich und verunsichert.
„Nein, solche unnötigen, langen Taxifahrten sind im Budget nicht drin“, gab ich zur Antwort, die ihr aber irgendwie nicht zu gefallen schien.
„Die Busfahrer sind sehr erfahren und können auch mit solchen Rostlauben umgehen. Du wirst sehen, wir werden sicher an unserem Hotel ankommen“, versuchte ich sie zu beruhigen.
So ganz glaubte sie mir nicht, stieg aber schließlich doch ein. Maria saß bereits drinnen und winkte uns zu, während Horst filmte und wie immer einen dramatisch übertriebenen Kommentar dazu abgab. In den kommenden zehn Minuten stiegen laufend neue Leute ein, ausschließlich Venezolaner und erst, als auch der letzte Platz besetzt war, fuhren wir los. Ruth saß neben mir und ich hielt ihre Hand, was sie ohne weiteres zuließ.
Und schon wieder befanden wir uns im Berufsverkehr, diesmal aus der Stadt hinaus. Die Schnellstraße Richtung Küste war vollgestopft mit Pkws und Bussen und es ging noch langsamer voran als auf der Hinfahrt. Ein weiterer Grund für den Stau war die Mautstelle, wo jeder für die Benutzung der Schnellstraße anhalten und zahlen musste. So blieb uns viel Zeit die Umgebung zu betrachten. Kleinere Gebirgszüge umsäumten die Stadt und wer genauer hinsah, bemerkte auch die vielen Wellblechhäuser und Bretterbuden, die in die Hügel hineingebaut waren. Diese Slums waren ein großes Problem für Caracas, denn viele der Menschen, die hier lebten, kamen meist nachts in die Stadt um zu rauben und morden, denn ein Menschenleben war ihnen nicht viel wert und bevor sie bei einer Gegenüberstellung wiedererkannt werden konnten, brachten sie ihre Opfer, ohne lange zu überlegen, einfach um.
Als wir in Macuto ankamen, war es bereits stockdunkel und wir gingen ohne Umwege sofort ins Hotel. Der Hunger nagte schon wieder an uns und außerdem mussten wir noch unsere Sachen packen, denn morgen früh ging es mit dem Flugzeug weiter nach Ciudad Bolivar, wo wir Carlos treffen sollten.