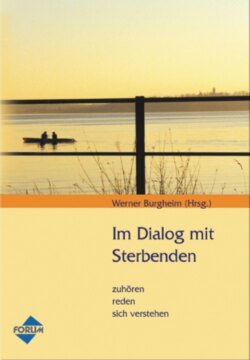Читать книгу Im Dialog mit Sterbenden - Gerda Graf - Страница 10
Die Symbolsprache Sterbender
ОглавлениеCarola Otterstedt
Definition Wirklichkeit
Was ist Wirklichkeit, was ist Phantasie? In der Definition von Wirklichkeit orientieren wir uns zunächst am sozialen Miteinander: Was viele als wirklich ansehen, das muss wohl auch wirklich sein. Es gibt somit einen Konsens von Wahrnehmungen, der durch langwierige Interaktionen sich immer wieder neu entwickelt. Es besteht keine feste Objektivität, denn aufgrund veränderter sozialer Situationen und sozialem Miteinander verändert sich auch die Wahrnehmung des Einzelnen und die Wirklichkeit der sozialen Gemeinschaft.1 Neben der Wirklichkeit, welche mit der eigenen und sozialen Erlebniswelt verglichen wird, gibt es auch die Illusion, welche wir z. B. in Träumen, Halluzinationen erleben können.
Definition Illusion
Eine Halluzination ist eine Wahrnehmung mit Realitätscharakter unter Einbeziehung einzelner bzw. mehrerer Sinne. Aber wie können Halluzinationen als wahrhaftig erlebt werden, wenn doch die Umwelt sie nicht wahrnehmen, dadurch oft nicht annehmen, akzeptieren kann? Eben weil wir unsere individuell erlebte Wirklichkeit immer auch mit der unserer sozialen Umwelt vergleichen und im Fall einer Halluzination notwendigerweise eine Differenz im Erleben unserer Wirklichkeit erfahren, führen Halluzinationen auch immer zu einer physischen, psychischen, mentalen und sozialen (mitunter auch spirituellen) Irritation in uns. Diese Irritation hat eine unmittelbare Wirkung auf unser Ich-Bewusstsein und unser Selbstvertrauen: Habe ich wirklich einen schwarzen Raben auf meinem Bettholm sitzen gesehen? Vielleicht war es ja nur ein dunkler Schatten?
Kriterien
Mithilfe einiger Kriterien versuchen wir uns der Wirklichkeit zu versichern (s. a. Balgo 1998: 143):
Strukturell (u. a. Helligkeit, Kontrast, Schärfe, Dreidimensionalität, Lokalisierbarkeit, Art und Tempo der Bewegung): War es nicht etwas zu dunkel für einen echten Raben? Er hat sich ja eigentlich gar nicht bewegt;
Inhaltlich (u. a. Bedeutungsinhalt, Kontextstimmigkeit, Aufforderungscharakter): Was sollte denn auch ein Rabe auf meinem Bettholm?
Praktisch (u. a.: „Kann man es begreifen, ist es wirklich, steht es in Bezug zu dem Wahrnehmenden?“): Was sollte denn auch ein Rabe in meinem Zimmer?
1. Begegnungen mit der Symbolsprache
Mit Hilfe der Symbolsprache versuchen wir das Extrakt des Erlebten in einem Bild wiederzugeben. Dieses Bild mag die Wirklichkeit oder auch eine Illusion widerspiegeln. Wichtig scheint, dass der Mensch einen Ausdruck findet, welcher über die rationale Sprachebene einen Ausdruck v. a. für seine erlebten Emotionen findet. „Der Mensch in der Krise versucht, sich auszusprechen, und da seine Krise in seiner Befindlichkeit zum Ausdruck kommt, wird er über seinen Zustand kaum sachlich objektiv argumentierend reden. Diese auf die Sachebene reduzierte Sprache reicht nicht aus für das, was ihn bewegt.“ (Piper 1993: 61).
Klassifizierung
Begegnen wir einem Menschen, der sich uns gegenüber in einer Symbolsprache mitteilen will, reagieren wir mitunter irritiert. Schnell wird dieser Mensch als verwirrt eingestuft. Diese Klassifizierung dient in erster Linie der Beantwortung unserer Irritation: Was wir nicht verstehen, wehren wir ab, und dies gelingt uns am besten, wenn wir den anderen als verwirrt darstellen. Aber eigentlich sind es ja wir, die in diesem Moment verwirrt über das Verhalten des anderen sind. „Nachträglich erklären Angehörige oft, der Sterbende habe sein Sterben geahnt. Aber meist hat niemand diese Ahnung aufgenommen. Auch in dieser Hinsicht sind sterbende Menschen oft isoliert. Die Sprache, die um sie her gesprochen wird, ist die Sprache der Befunde, der medizinischen Technik, der Behandlungsabläufe – die Sprache der Vermeidung. Das Ziel mechanischer Lebensverlängerung verdeckt oft das Gespür für die emotionalen Lebensbedürfnisse. Auf die Signale der Todesahnung reagiert die Umwelt meist beschwichtigend oder verwehrend.“ (Lückel 1994: 83). Es gilt die Sprache in ihrer Mehr- und Tiefendimensionalität zu lernen, damit wir Sterbende besser verstehen und die Betroffenen nicht sprachlos, ohne begleitenden Dialogpartner, einsam sterben müssen (vgl. Piper, 1993: 66).
Mehr- und Tiefendimensionalität
Nicht die Eindeutigkeit des Wortes,
sondern seine Mehrdeutigkeit begründet eine lebendige Sprache.2
Dialog
In der Kranken- und Sterbebegleitung gilt es sowohl mit den Träumen als auch mit den Halluzinationen, die uns Betroffene berichten, sehr einfühlsam und äußerst behutsam im Dialog umzugehen.3 Holen Sie den Betroffenen nicht notwendigerweise aus seiner Phantasiewelt und vermeiden Sie Illusionen zu korrigieren oder auch zu bestätigen. Sie können dem Betroffenen besser helfen, indem Sie in Ruhe herausfinden, welche möglichen Gefühle, verborgene Bedürfnisse u. a. seinen Wahrnehmungen als Basis dienen könnten. Wenn Sie diese einfühlsam in einem gemeinsamen Dialog mit dem Betroffenen zum Ausdruck bringen können, kann sich dieser angenommen fühlen und seine Wahrnehmungen werden sich auflösen, da ihnen die Basis fehlt.
2. Wahrnehmen und Erkennen vom Symbolcharakter einer Rede
Traumsymbole
In der Symbolsprache ändert sich der Sprachausdruck und ähnelt in seiner Bildhaftigkeit der Poesie oder auch biblischen Gleichnissen. Oft enthalten diese Bilder uns bereits bekannte Symbole. Diese Vertrautheit mit der aus unserer kulturellen Erfahrung stammenden Symbolik kann uns helfen unsere Gefühle zu akzeptieren.4 „In den Traumsymbolen sind Erfahrungen von Generationen kondensiert. Nicht von ungefähr ist die Sprache der Träume mit der Sprache von Mythen und Märchen verwandt, in deren Symbolsprache die Lebenserfahrungen von Generationen eingefangen sind“ (Lückel 1994: 86). Die Inhalte der Bilder sind beispielsweise Themen wie Furcht, Einsamkeit, Ohnmacht, Hoffnung, Zweifel, Glaube, Ahnung und Ungewissheit.
Definition Träume
Träume sind verdichtete Emotionen und Erfahrungen, die in einer bildreichen Sprache sich uns mitteilen. Mithilfe von Träumen finden wir einen Weg, unsere Kreativität auszudrücken, und mit ihrer Hilfe versuchen wir z. B. Erlebtes und Konflikte zu gestalten, Wünsche und Nicht-Erlebbares zu leben. Träume geben uns die Möglichkeit, schöpferisch zu handeln, Lösungen in Konflikten und Problemen zu finden. Gerade in Situationen des Lebens, wo der Mensch an der Schwelle von einer Lebensphase in eine andere steht (bzw. vom Leben in den Tod), nimmt er in seinen Träumen oft einen anderen Akteur wahr, der für ihn die Problemlösung erlebt. Mit viel schöpferischer Kraft erlaubt uns dieses traumhafte Rollenspiel Lösungsentwürfe durchzuspielen, bevor wir die passenden für unser eigenes Leben annehmen können. Dies kann v. a. dann besonders hilfreich sein, wenn der Mensch, wie in der Sterbephase häufig, so genannte unerledigte Lebenssituationen noch einmal durchlebt.
Wahrnehmungen
Die Wahrnehmungen in Träumen oder Halluzinationen können für den Betroffenen aus unterschiedlichen Perspektiven erlebt werden, wie z. B. auch der Vogelperspektive, im veränderten Tempo (z. B. Zeitraffer, Slow-Motion), oder der Betroffene spürt beispielsweise, wie er seine alten Kräfte wiedererlangt. So erzählte beispielsweise eine Patientin, die seit vielen Jahren an einer schweren chronischen Erkrankung litt und nur mehr eine eingeschränkte Motorik besaß, dass sie in ihren Träumen nicht nur wieder wie früher Ski fahren könne, sondern auch in ihren Träumen erstmals Sportarten ausüben könne, welche sie in der Realität nie ausprobiert hatte. Ein anderer Patient, der aufgrund seiner Erkrankung nicht mehr Auto fahren konnte, berichtete, dass er im Traum ab und zu wieder Auto fahren würde, es ihn aber sehr anstrengen würde, da das Auto wie in einem Stummfilm sehr schnell und unharmonisch fahren würde.
Individualität der Symbolsprache
Jeder Mensch hat aufgrund seiner persönlichen Lebenserfahrung immer auch individuelle Träume und eine individuelle Symbolsprache. Und doch erleben wir in der Begleitung von Schwerkranken und v. a. von Sterbenden oft, dass bestimmte Bilder den Betroffenen erscheinen. Dies ist u. a. aus dem gemeinsamen Kulturkreis und seiner Symbolik erklärbar. Im Folgenden finden Sie eine kleine Auswahl von Bildern, denen Sie so oder in einer Variante v. a. in der Begleitung von Sterbenden begegnen können. Wichtig ist jedoch, dass wir daran denken, dass jedes Bild einen individuellen Sinngehalt besitzt, wir also nie sagen können: „Ach, das kenn‘ ich schon, ich weiß schon, worum es geht …“. Bleiben wir doch ruhig offen für das, was der Betroffene uns möglicherweise in einem vertraulichen Gespräch erzählen mag. Denn nur er wird die Symbolkraft des Bildes für sich entdecken können und uns vielleicht mitteilen.
Sorge um die wirtschaftliche Absicherung
Fallbeispiele – Sorge um die finanzielle Absicherung
Ein älterer Patient drückt gegenüber einer Krankenschwester seine große Sorge aus, dass das Geld nicht reichen könnte. Er zählt das Geld nach und ist beruhigt, dass es noch vier Tage reichen wird. Vier Tage später stirbt er.
Eine schwerkranke Patientin bittet entlassen zu werden, da sie Angst hat, dass der Klinikaufenthalt zu teuer wird. Ihre Nichte kann sie beruhigen, dass sie alles Finanzielle regeln wird.
Ein 72-jähriger Patient macht sich große Sorgen, dass die Familie nach seinem Tod finanziell nicht ausreichend versorgt sein könnte. Er ist sehr unruhig und möchte wieder zur Arbeit gehen. Er studiert intensiv die Stellenanzeigen. Nach vielen unruhigen Tagen und Nächten wacht er nach einem ruhigen Mittagsschlaf nicht mehr auf.
Ein älterer Patient möchte das Krankenhaus verlassen, weil er sich sorgt, dass die Rente nicht weiter bezahlt werden würde. Nach einer Nacht erzählt er beruhigt einer Krankenschwester, die Rente sei ihm ausbezahlt worden. Er stirbt am gleichen Abend.
Weitere mögliche Bilder: Furcht, dass
der zurückbleibende Ehepartner sich nicht alleine versorgen kann,
das Geld von Angehörigen o. a. vom Sparbuch, Konto entwendet wird,
der Besitz veräußert wird oder
das Bargeld aus dem Schrank gestohlen wird.
Die Schwierigkeit für den Begleiter besteht gerade auch bei diesen Bildern darin, zu unterscheiden: Hat die Rede einen Symbolcharakter oder besitzt sie einen handlungsnötigen Realitätsbezug? Es gilt, sich einfühlsam und vertraulich zu informieren und in keinem Fall einfach zu denken: „Ach, das ist ja doch nur so ein Symbol …“. Wenn Sie keine realen Gründe für die Äußerung des Betroffenen erkennen können, werden Sie hinter dem geäußerten Bild eine andere Not entdecken.
Nach Hause zurückkehren
Fallbeispiele – Heimkehr
Eine 62-jährige Krebspatientin bittet die Krankenschwester beim Ordnen der Wäsche im Schrank zu helfen: Sie würde am Nachmittag die Klinik verlassen und nach Hause gehen. Die Krankenschwester ist irritiert und fragt die Stationsschwester, ob diese Patientin schon entlassen wird. Dies wird verneint. Die Schwester verspricht der Patientin später die Wäsche zu ordnen und setzt sich für ein ruhiges Gespräch zu ihr ans Bett. Die Patientin erzählt ihr, dass sie ihre Blumen und Pflanzen so vermisst. Gemeinsam mit der Krankenschwester hat sie ein schönes Gespräch über ihre Blumen und Pflanzen. Am Abend stirbt die Patientin.
Eine alte Bewohnerin spricht seit drei Tagen sehr bestimmt davon, dass sie aus dem Pflegeheim gehen und nach Hause zurückkehren wird. Sie würde sich dort um ihre Familie und Tiere kümmern müssen. Jeden Morgen fragt sie die Pfleger, ob jetzt der Tag gekommen ist, wo sie heimkehren kann. Einige Tage später kehrt sie heim und ist ruhig gestorben.
Das reale Zuhause kann sich im Bild wandeln zu einem so genannten übergeordneten Zuhause, wo man Geborgenheit und Erlösung findet, ganz und heil werden kann.
Sich auf eine Reise vorbereiten
Fallbeispiele – Reise
Eine ambulant betreute ältere Patientin plant sehr vergnügt eine große Kreuzfahrt. Sie erzählt ihrem Mann, dass sie bereits übermorgen die Reise antreten wird und noch viel besorgen muss. Er könne ja später nachkommen, wenn es ihm jetzt zu schnell ginge. Sie schreibt eifrig kleine Merkzettel, was sie alles mitnehmen möchte. Zwei Tage später stirbt sie ruhig.
Ein 46-jähriger Krebspatient, welcher sehr große Angst vor dem Sterben geäußert hatte, erzählte eines Morgens von einer wunderschönen Reise, die er gemacht hat. Er kann viele Einzelheiten von dem Ort erzählen, den er besucht hat, und meint, er würde gerne einmal wieder dorthin. In der folgenden Nacht stirbt er.
Weitere mögliche Bilder: …
Koffer packen
Rucksack und Proviant packen
Sich auf eine Wanderung begeben
Begegnung mit der Natur
Fallbeispiele – Natur
Als am Morgen der Pfleger ihn fragte, wie er geschlafen hätte, erzählte der 81-jährige Patient, dass er gar nicht geschlafen hätte. Er hätte eine wunderschöne Wiese gesehen und hätte dort eigentlich Blumen pflücken wollen. Aber dann habe er sie doch stehen lassen. Er wolle noch einmal dorthin zurückkehren. Der Patient starb noch am gleichen Tag.
Eine junge Patientin erzählte, dass sie die letzten Tage immer wieder einen ähnlichen Traum hatte. Sie versuchte aus einem Wald herauszukommen und eine weite Ebene zu erreichen. Aber immer wieder musste sie in den Wald zurück. In der vorangegangenen Nacht hatte sie in dem Wald eine Lichtung erreicht, wo sie sich hatte ausruhen können. Nach einigen Rückschlägen erholte sich die Patientin und konnte das Krankenhaus verlassen.
Ein 18-jähriger Patient träumte von einem schmalen Heckenweg, der durch die Dünen zum Meer führte. Als er das Meer erreichte, ließ er sich erschöpft in den Sand fallen. Dann habe es Sterne geregnet. Er habe jetzt keine Angst mehr vor dem Sterben, meinte er zu einem Pfleger, aber er wolle gerne noch einmal zum Meer. Seine Eltern bemühten sich eine Reise zum Meer zu arrangieren. Der junge Mann aber starb ruhig in der folgenden Nacht.
Als die Ärzte ihm sagten, dass sie nichts mehr für ihn tun könnten, hatte ein 46-jähriger Patient den Eindruck, dass Pfleger und Ärzte nur noch selten in sein Zimmer kamen. Während eines Tagesschlafes erlebte er, dass er sehr schnell in eine Felsspalte hinabfiel und dabei immer wieder sehr schmerzhaft an die rauen Felswände schlug. Er konnte den Fall nicht aufhalten und sah weit unter sich einen großen Strudel. Ihm wurde übel und er wachte auf. Der Patient malte seinen Traum in der kunsttherapeutischen Begleitung und sprach von dem Gefühl, von Pflegern und Ärzten abgelehnt und allein gelassen zu werden.
Ein älterer Herr erzählte seiner ihn besuchenden Nichte, er habe in der letzten Nacht versucht den Fluss zu überbrücken. Seine Nichte dachte zunächst, er sei draußen spazieren gegangen. Ihr Onkel erzählte, dass er gerufen worden sei. Erst habe er gar nicht seinen Namen verstanden, aber als der Wind sich etwas gelegt hatte, habe er ganz deutlich seinen Namen verstanden. Aber es sei keine Brücke da gewesen. Er wolle wieder an den Fluss gehen und schauen, ob nicht doch irgendwo eine Brücke sei. Die Nichte verstand und blieb die Nacht über bei ihrem Onkel. Dieser starb gegen Morgen.
Weitere mögliche Bilder: …
Um einen Hügel herumgehen, bis man freie Sicht hat
Ins Gebirge, einen Felsen besteigen
Einen Graben überqueren
Wassermassen, Wellen
Auf der anderen Seite einer natürlichen Barriere bereits Verstorbene sehen, zu ihnen wollen
Die Bilder der Natur können sowohl große Herausforderungen darstellen als auch Geborgenheit vermitteln.
Ein (Lebens-) Weg, der plötzlich abbricht
Fallbeispiele – (Lebens-) Weg
Eine ältere Patientin kam mit der Reinemachefrau, die das Klinikzimmer säuberte, ins Gespräch. Als die Reinemachefrau die Schuhe der Patientin wieder ordentlich unter das Bett stellen wollte, meinte die Patientin, die Schuhe würde sie nicht mehr brauchen, ob die Reinemachefrau Interesse an dem Paar Schuhe hätte. Diese versuchte die Patientin zu überreden, dass sie doch bestimmt bald wieder aufstehen könne und dann ihre Schuhe bräuchte. Die Patientin erzählte, dass sie wisse, dass ihr Weg zu Ende sei: Sie habe in der Nacht dort nichts mehr gesehen, nur Licht. Da sei kein Weg mehr, wo man gehen könne. Sie brauche keine Schuhe mehr. Zwei Tage später starb die Patientin.
Einladung zum Gehen
Fallbeispiele – Einladung zum Gehen
Eine 57-jährige Patientin berichtet der Hospizhelferin, dass in der Nacht ihre verstorbene Schwester zu ihr gekommen sei und erzählt hätte, dass sie sich freut, wenn sie bald komme. Der Patientin hatte diese Begegnung Angst gemacht und sie hatte die Hospizhelferin gefragt, ob sie jetzt sterben müsse. Im gemeinsamen Dialog entdeckte die Patientin, dass ihre Schwester ihr im Sterben beistehen würde und sie sich so mit dem Gedanken des Sterbens langsam anfreunden könne.
Eine alte Dame erzählt ihrer Pflegerin, dass ihr Mann sie am Nachmittag wieder besuchen wolle. Der Ehemann war eine Woche zuvor gestorben. Die Pflegerin vermied den realen Tod des Ehemannes erneut zu erwähnen und fragte stattdessen: Freuen Sie sich schon auf den Besuch Ihres Mannes? Die alte Dame bejahte und starb am Nachmittag ruhig.
Eine 38-jährige Patientin hat eine Operation überstanden. Als sie aus der Narkose aufwacht, sieht sie am Ende ihres Bettes den Knochenmann sitzen. Er sagt nichts. Aber die Patientin entdeckt sofort ihre Wut und weist ihn entschieden ab: Geh, ich bin noch nicht dran! Hau ab! Der Knochenmann verschwindet. Die Patientin schläft die nächsten Tage unruhig, aber der Knochenmann erscheint nicht wieder. Die Patientin ist wieder wohlauf, leidet aber daran, dass sie ihre Erfahrung nicht Familie und Freunden mitteilen kann. Sie hat Angst, dass man sie wahrscheinlich für verrückt hält.
Eine junge Mutter liegt im Krankenhaus im Sterben. Sie kämpft gegen die Krankheit, da sie weiter für ihre kleinen Kinder da sein möchte. Eines Nachts ruft sie in Panik ihren Vater an und sagt, man würde sie abholen kommen. Sie sei in großer Gefahr und er müsse kommen, sonst würde sie mitgenommen werden. Der Vater und die ganze Familie bleiben abwechselnd bei der jungen Mutter. Als ihr Vater an ihrem Bett ist, fragt sie, ob sie denn mitgehen müsse. Der Vater sagt, sie dürfe gehen, wenn es so weit sei. Ein paar Stunden später stirbt seine Tochter.
Nachlassende Lebenskraft und stummer Zuschauer (Pastellkreide)
Fallbeispiele – Nachlassende Lebenskraft
Eine Patientin erlebt einen schweren Schwächeanfall. Sie malt später, wie ihre Lebenskraft aus dem Körper geflossen ist. Von außen schaut ein Beobachter zu, bleibt aber untätig. Die sie betreuenden Ärzte und Pfleger waren gegenüber dem Schwächeanfall hilflos gewesen. Auch das Fehlen einer gemeinsamen Sprachebene spiegelt sich in dem Bild der Patientin wider.
Engel
Fallbeispiele – Engel
Eine 44-jährige Zahntechnikerin mit einer schweren chronischen Erkrankung erzählt, dass sie seit vielen Jahren sich beschützt und begleitet fühlt. Sie könne den Beschützer nicht sehen, aber manchmal habe sie das Gefühl beobachtet zu werden und schaue dann zum entsprechenden Hausdach hinauf. Sie fühle sich geborgen und könne sich vorstellen, dass sie von Geistwesen oder Engeln begleitet würde. Wenn sie um Hilfe bittet, spüre sie einen geborgenen Halt an ihrem linken Schulterblatt.
Ein 63-jähriger Krebspatient liegt in der Klinik. Er vertraut sich einer Seelsorgerin an. Ein Engel käme wiederholt in sein Zimmer und würde ihn einladen mit ihm zu kommen. Er wolle aber nicht. Die Seelsorgerin unterstützt ihn mit dem Engel zu sprechen. Nach mehreren Tagen und Gesprächen mit dem Engel geht der Patient ruhig mit. Er ist gestorben.
Engel haben traditionell eine große Bedeutung für uns Menschen: Sie sind Boten einer Botschaft, weisen und begleiten uns auf unserem Weg. Engel und Geistwesen vermitteln Geborgenheit, Schutz, Trost und Vertrauen. Ihre Anwesenheit löst weniger Furcht als Ehrfurcht und Achtung aus. Sie begleiten im Leben wie beim Sterben.
Licht sehen
Fallbeispiele – Licht sehen
Viele Menschen haben inzwischen Kenntnis über die Nahtoderlebnisse anderer Menschen. Einige der Nahtoderlebnisse sind sogar kulturübergreifend. Darunter ist z. B. auch die Wahrnehmung, dass der Mensch beim Sterben durch einen Tunnel, eine Röhre oder einen anderen dunklen Raum schreitet und an dessen Ende von einem hellen Licht empfangen wird. Dieses Bild taucht mitunter auch in den Träumen mancher Patienten auf.
Kombination aus verschiedenen Bildern möglich
Fallbeispiele – Kombination verschiedener Bilder
Eine 20-jährige Patientin mit einer chronischen Erkrankung träumte einen Traum, in dem sie allen Menschen begegnete, welche ihr im Leben wichtig waren. Plötzlich brach ein Feuer aus und sie war gemeinsam mit vielen Menschen durch das sich ausbreitende Feuer eingeschlossen. Die meisten Menschen versuchten sich vom Balkon aus zu retten. Einige von ihnen rutschten eine große steinerne Treppenbalustrade herunter. Sie wurden unten von einer kleinen Gruppe Menschen empfangen. Einer aus dieser Gruppe bestimmte nach einer Namensliste, wer von dem Balkon hinabrutschen durfte. Die Patientin selber war überrascht, dass sie rutschen sollte, denn sie war trotz des Feuers nicht auf die Idee gekommen vor diesem zu flüchten. Sie rutschte auf der Balustrade hinab, vorbei an Szenen und Orten ihres Lebens, wurde unten von lieben Menschen empfangen, die sie zu kennen schienen. Als die Patientin zum Balkon zurückblickte, war dieser sehr weit entfernt. Sie spürte Trauer und Mitgefühl für die, die auf dem Balkon zurückbleiben mussten. Als sie sich umblickte, war sie in einem endlos großen in blaugrünes Licht getauchten Park. Sie wurde zu weißen Brunnen geführt und entdeckte, dass sie wieder tanzen konnte. Sie spürte ihre Kräfte wiederkommen und genoss dieses sehr. Aber sie vermisste die Menschen um sich herum und der Traum löste sich auf.
Die Patientin entdeckte insbesondere durch diesen Traum, dass gerade in Zeiten, in denen ihr Körper stark entkräftet war, ihre Träume einen besonderen Symbolgehalt hatten. Mithilfe dieser Art Träume konnte die Patientin sich ein Stück aus der Last einer chronischen Erkrankung herausnehmen (z. B. Abschied von Schmerzen und körperlichen Einschränkungen, das Genießen der neuen körperlichen Kräfte) und gleichzeitig Entscheidungsprozesse wahrnehmen, die für ihr weiteres Leben wichtig waren (z. B. Sehnsucht nach Mitmenschen, Rückkehr ins Leben).
Fallbeispiele – Symbolsprache von Gleichnissen
In der Begleitung von Schwerkranken und Sterbenden kann man bewusst auch Bilderbücher (für Kinder und / oder Erwachsene) mit symbolreicher Sprache anbieten. Auch die symbolreiche Sprache von Gleichnissen (in der Bibel, aber z. B. auch in Form von humorigen Texten aus der jüdischen und islamischen Religion) kann als Anregung zur Entwicklung der eigenen Phantasien dienen. Wie immer gilt auch hier: Als Begleiter bieten wir an, der Betroffene darf wählen.
3. Annehmen und Mitgehen in einem sensiblen Dialog
Um Träume und symbolhafte Wahrnehmungen annehmen und verarbeiten zu können, ist ein Dialogpartner sehr hilfreich:
Hilfestellungen für den Dialog
Als einfühlsamer und vertrauensvoller Gesprächspartner, dem man seine Träume anvertrauen mag
Als Bestätigung, dass man nicht verrückt geworden ist
Als emotionales und soziales Ventil über das eigene Erschrekken vor der Wahrnehmung und vielleicht Ahnung bezüglich der Botschaft
Als Resonanz: Ich bin noch real und existiere noch in der Wirklichkeit
Als Übersetzungshilfe: Um Geborgenheit zu geben und das Schutzbedürfnis in dieser sehr verletzungsanfälligen Situation (andere Menschen sprechen vielleicht abfällig über die Wahrnehmungen, bagatellisieren die Träume und kränken den Betroffenen dadurch)
Wenn der Begleiter die Andeutungen des Betroffenen aufnimmt und mit Zeit und Ruhe, vor allem mit wahrhaftigem Interesse ihm zuhören mag, dann kann sich dies zu einem befreienden Gespräch für den Betroffenen entwickeln.
Einige praktische Tipps 5
Wenn der Betroffene Sorgen oder Ängste äußert, versuchen Sie ihm diese nicht auszureden. Da seine Sorgen emotional begründet sind, würde die Ansprache auf der Sachebene dem Betroffenen nicht weiterhelfen.
Vermeiden Sie die Träume, Symbole, Sorgen und Ängste des Betroffenen zu interpretieren. Dem Betroffenen helfen nur seine eigenen Assoziationen.
Sie können aber dem Betroffenen helfen, indem Sie ihm Geborgenheit vermitteln, ihn mit seinen Sorgen und Ängsten annehmen, ihn ermuntern seine Gedanken auszusprechen. Lassen Sie ihm dafür Zeit und unterstützen Sie ihn mitunter durch Wiederholung seiner eigenen Ausdrücke oder Spiegelung seiner Gedanken. Sagen Sie ihm, dass er Ihnen gegenüber alles aussprechen darf.
Ermuntern
Ermuntern Sie den Betroffenen bei wiederholt auftretenden Träumen mögliche Veränderungen wahrzunehmen (z. B. der Schatten wird heller, sieht nicht mehr so furchterregend aus).
Vermitteln
Vermitteln Sie dem Betroffenen die Phantasie, dass er Geistwesen direkt anschauen, mit ihnen sprechen, seine Gefühle zeigen und Forderungen stellen darf (Ich kenne jetzt die Figur. Jetzt habe ich weniger Angst vor dir! Zieh‘ nächstes Mal nicht einen so dunklen Mantel an, das erschreckt mich!). So kann der Betroffene erleben, dass er nicht nur vor Furcht gelähmt sein muss, sondern im direkten Dialog mit den Geistwesen Einfluss auf seine Träume nehmen kann. Träume, welche in einen Dialog einbezogen werden, verändern sich und kehren in dieser Form oder überhaupt nicht wieder.
Begleiten
Begleiten Sie einen Schlafenden, der von schlimmen Träumen belastet wird, dann haben Sie die Möglichkeit, durch das Summen leiser und ruhiger Melodien (mit aufmunterndem Charakter) dem Betroffenen eine Alternative anzubieten. Die Melodie vermittelt ihm Geborgenheit und Halt, lässt ihn neue phantasievolle Wege im Traum finden (Eine plötzliche körperliche Berührung könnte hingegen den Betroffenen irritieren und aufwachen lassen). Sobald der Betroffene ruhiger wird, beenden Sie auch Ihre Melodie.
Als Kranken- und Sterbebegleiter erleben wir immer wieder den Moment, da uns der Betroffene in seiner eigenen Ohnmacht um Antworten bittet. Diese Fragen nach dem Sinn und dem Werden des alten oder versehrten Lebens werden vor allem in Momenten geäußert, wo der Betroffene schwere körperliche oder seelische Not leidet. Es gibt Fragen, auf die wir noch keine Antworten finden. Und gerade auf diese für den Betroffenen so bedeutsamen Fragen wird er eines Tages selber Antworten finden können.
Geduld und Zuversicht
Aber als Begleiter können wir dem Betroffenen helfen Geduld und Zuversicht zu bewahren, ihm eine heilsame Geborgenheit schenken. Vermeiden Sie eine mögliche Atemlosigkeit des leidenden Betroffenen zu übernehmen. Atmen Sie ruhig und suchen Sie z. B. in der Natur, im Gebet oder in der Meditation Ihre eigene innere Ruhe. Besinnen Sie sich auf Ihre Kraftquelle. Versuchen Sie in sich stimmig zu werden, denn Ihre Ruhe wird sich auch auf die Stimmung des Betroffenen übertragen. Dies wird Ihnen besonders gut mithilfe einer ruhigen dialogischen Körpersprache (z. B. Hinwendung des Körpers, ruhiger Lidschluss, Ihre Hand trägt die des Betroffenen, Streicheln, Handauflegen o. a.) gelingen.
Vielleicht verbinden Sie mit Ihrer Kraftquelle eine spirituelle Kraft, die Sie trägt. Und vielleicht erfahren Sie auch, dass nicht Sie allein den Betroffenen begleiten, vielmehr für den Betroffenen, wie für den Begleiter und alle anderen beteiligten Menschen, gesorgt ist. Wenn Sie in einem besonders nahen Moment mit dem Betroffenen dies wahrhaftig empfinden, dann können Sie – mit ruhiger Bestimmtheit und Gelassenheit zugleich – allein die folgenden vier Worte sagen:
Für Sie ist gesorgt.
Literatur
Balgo, R. (1998): Bewegung und Wahrnehmung als System in der Psychomotorik, Reihe Motorik Bd. 21, Schorndorf.
Ebert, A.; Godzik, P. (Hrsg.) (1993): Handbuch zur Begleitung Schwerkranker und Sterbender, Rissen.
Lückel, K. (1994): Begegnung mit Sterbenden, Gütersloh.
Otterstedt, C. (2001): Tiere als therapeutische Begleiter (u. a. Sterbebegleitung), Kosmos, Stuttgart.
Otterstedt, C. (2004): Kommunikation mit Schwerkranken und Koma-Patienten, verlag modernes lernen, Dortmund.
Piper, H. Chr. (1993): Die Sprache der Sterbenden, in: Ebert / Godzik (1993:59 – 72).
1 Vgl. hierzu auch Balgo (1993:144).
2 In Anlehnung an Martin Buber.
3 Literatur zum Thema: Gruber (1998), Piper (1993).
4 Ad. Symbolik in der Abschiedsgestaltung, s. a. Otterstedt (1995: 31 ff.).
5 Hilfreiche Übungen zur Einübung des Dialoges mit Betroffenen bietet auch das Buch Ebert / Godzik; 1993.