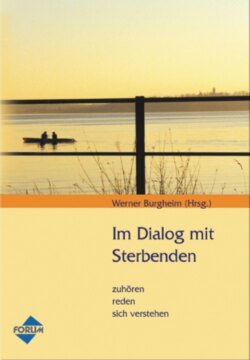Читать книгу Im Dialog mit Sterbenden - Gerda Graf - Страница 8
Verbale und nonverbale Kommunikation bei Sterbenden
ОглавлениеRoland Hofmann
Immer noch ein Tabu?
Tod, Trauer, Sterben, unerträgliche Schmerzen sind in unserer Leistungsgesellschaft Themen, die sehr häufig mit einem Tabu belegt sind.
Was aber „machen” Menschen, die sich freiwillig – ob professionell oder ehrenamtlich – an das Sterbebett setzen, um Schwerstkranke und Angehörige zu trösten, mit ihnen zu weinen oder einfach nur zuzuhören?
Sie begleiten Sterbende in der letzten Phase ihres Lebens, erleben hautnah den Kampf gegen Schmerzen, Ängste, Verzweiflung, aber auch Hoffnungen und letzte wirkliche Botschaften.
All dies auszuhalten wird nicht dadurch einfacher, dass ein Hospizhelfer, Arzt, eine Krankenschwester, Angehörige die Grundlagen der Kommunikation beherrschen.
„Was den existenziellen Grund eines Menschen berührt”, so schreibt Martin Weber (2000), „muss belastend, muss schwierig bleiben” (S. 34), „und doch kann es befriedigender sein als das Gelingen einer komplizierten Operation“.
Kommunikative Kompetenz
Hierzu bedarf es kommunikativer Kompetenz. Ein gelingendes Gespräch wird sich dabei nicht auf bloße „Gesprächstechnik” reduzieren lassen, sondern der Schwerstkranke wird – günstigenfalls – erleben, ob er ein echtes Interesse, eine tatsächliche Wertschätzung seiner Person erfährt und spürt.
Helene Mayer (2001), die Vorsitzende der österreichischen IGSL, Internationale Gesellschaft für Sterbebegleitung & Lebensbeistand, betont in ihrem Editorial die Bedeutung und Überlegenheit der nonverbalen Kommunikation im Umgang mit Schwerstkranken und Sterbenden.
Die Bedeutung nonverbaler Kommunikation
Gerade hier geschieht das Senden einer Nachricht sehr häufig – oft wegen des Fehlens anderer Möglichkeiten der Übermittelung – durch Blickkontakt, aber auch Lächeln, Gesten, veränderte (etwa plötzlich distanzierte) Körperhaltung usw.
Ob den schwerstkranken Menschen jemand anlächelt, anstarrt, weint, führt sehr häufig zu spontaner Reaktion – mehr oder weniger ausgeprägt auf allen vier Ebenen einer Nachricht.
Mayer (2001, S. 3) versucht durch ein kleines Fallbeispiel einiges zu verdeutlichen:
„Rote Schuhe“
„Als Angela im Krankenhaus lag, weil ihr der Blinddarm entfernt werden musste, wurde zwei Tage später eine junge Patientin zu ihr ins Zimmer gelegt, der bei einem schweren Verkehrsunfall beide Beine gebrochen worden waren. Diese Patientin war überzeugt davon, dass sie nie wieder würde laufen können. Sie war unglücklich, unwillig und launisch. Kaum ein freundliches Wort war den ganzen Tag über von ihr zu hören. Sie weinte oder schlief den ganzen Tag. Nur morgens, wenn die Post kam, schien sie ihrer Umwelt etwas freundlicher gesonnen. Doch trotz aller Geschenke blieb sie traurig und unglücklich. Eines Tages erhielt sie ein größeres Päckchen von ihrer Tante, die weit entfernt wohnte. Als die junge Patientin das Paket geöffnet hatte, fand sie ein wunderschönes Paar roter Schuhe mit kleinen Absätzen.
Die Krankenschwester murmelte etwas von „Leuten, die überhaupt kein Feingefühl hätten …“, und räumte die Verpackung weg. Doch die Patientin schien sie gar nicht gehört zu haben. Sie steckte die Hände in die Schuhe und ging mit ihnen auf der Bettdecke spazieren. Ab diesem Tag änderte sie ihr Verhalten. Sie nahm die Anweisungen der Krankenschwester bereitwillig an, und bald schon konnte die Therapie intensiviert werden.
Eines Tages sah Angela zufällig ihre ehemalige Zimmernachbarin, wie sie lachend mit einer Freundin in eine Eisdiele ging; an den Füßen trug sie rote Schuhe mit kleinen Absätzen.”
Das Hygieneund Distanzgebot gilt heute als Unfug
War es vor zehn bis zwanzig Jahren noch der Pflegekraft / dem Arzt „verboten”, sich auf oder nah an das Bett eines Patienten zu setzen (etwa um seinen Arm, seine Stirn zu streicheln, seinen Kopf an sich zu drücken) – und dies geschah häufig unter dem Aspekt der Hygiene oder des Distanzgebots –, so gilt dies heute als Unfug.
Denn sehr viele Patienten versuchen durch nonverbale Kommunikation ihre Ängste, Hilflosigkeit, Trauer, Aggression und Schmerz auszudrücken und sollten in diesem Bedürfnis nicht allein gelassen werden, denn nonverbale Botschaften sind der Sprache überlegen.
Medizinische Information
Stellen Sie sich vor, Sie beteuern vielfach – etwa als Krankenschwester, Arzt, Sozialpädagogin: „Sie brauchen vor der OP keine Angst zu haben; dies ist nur ein kleiner, unbedeutender Eingriff. Dr. M. hat den schon hundertfach durchgeführt. Die Misserfolgsquote liegt nur bei 0,5 %….”
Was bedeutet das für sehr viele Patienten – nach dieser doch sachlich vorgetragenen Information? „Ich bin bei diesen 0,5 %…!” Neben diese (notwendige) medizinische Information sollte die nonverbale Kommunikation treten.
Eine andere Qualität
Bevor die Pflegekraft, der Arzt oder andere vielfach beteuern: „Sie brauchen keine Angst zu haben” u.s.w., erhält das „In-den-Arm-nehmen”, den „Patienten an sich drücken” eine völlig andere Qualität, selbstverständlich nur, wenn die Beziehung zwischen beiden dies hergibt und wenn die Patienten dieses Bedürfnis auch (nonverbal) ausdrücken.
Der Wunsch nach aktiver Sterbehilfe kommt bei Schwerstkranken erst gar nicht auf, wenn sie ein verlässliches Gefühl dafür entwickeln können, dass ihre körperlichen Schmerzen mit modernsten Methoden zuverlässig gelindert und ihre begleitenden (seelischen) Schmerzen durch entsprechende Betreuung und psychosoziale Unterstützung begleitet werden. Nonverbale Anteile – gerade auch in der professionellen Arbeit – können hierbei einen unschätzbaren Anteil beitragen.
Letztendlich muss der „Hospizler”, der „Profi” rüberbringen:
„Mich interessierst du. Ich verstehe, warum du so fühlst, dich so verhältst. Du interessiert mich als Person….”
Der Wert des Zuhörers
Fazit: Er ist ein guter Zuhörer! Über den Wert des Zuhörens ist schon viel nachgedacht und geschrieben (z. B. Hofmann, 1995) worden. Dort wird die Frage gestellt: Lässt sich dieses Gesprächsverhalten lernen? Ich meine: Ja! Jeder, der will, kann ein guter Zuhörer werden. Die Kommunikation im Berufsalltag des Krankenpflegepersonals bedarf der professionellen Gesprächsführung. Nun haben sich seit vielen Jahren Wissenschaftler und Praktiker darum bemüht herauszuarbeiten, was die Grundlagen der zwischenmenschlichen Kommunikation, der Psychologie der Gesprächsführung, sind. Diese Theorienentwicklung und Systematiken haben in ein Konzept Eingang gefunden, das sich unter „Gesprächspsychotherapie / klientenzentrierte Gesprächsführung” zusammenfassen lässt.
Professionelle Gesprächsführung
Das Gegenüber, der Mensch, der Partner, der Patient, der / die Mitarbeiter stehen dabei im Vordergrund. Als deren Partner / Zuhörer will ich mich bewähren und nicht als Experte, der vorschnelle Ratschläge gibt, wie hilfesuchende Personen ihr Leben oder auch ihr Sterben besser „in den Griff bekommen”. Denn der Schlüssel zur Problembewältigung liegt bei jedem selbst. Man kann ihn nur beraten, begleitend im helfenden Gespräch unterstützen. Die Bedeutung des Gesprächs in der zwischenmenschlichen Beziehung auf der Station ist allen, die dort arbeiten, bekannt. Der amerikanische Psychologe Carl Rogers hat die wissenschaftliche Gesprächsführung begründet. Nach einigen Jahren in der Praxis der Beratung und Psychotherapie hat er zusammen mit seinen Mitarbeitern eine Vielzahl von Tonbandprotokollen aus Beratungssituationen abgehört, analysiert und drei Variablen gefunden, die immer wieder auftauchten, wenn ein Gespräch gut verlief. Es sind die Elemente einer einfühlsamen Haltung:
Was macht ein „gutes“ Gespräch aus?
Positive Wertschätzung
Einfühlung / Empathie
Verbalisierung der emotionalen Erlebnisinhalte
Die zentrale Voraussetzung für das Gespräch ist das Zuhören.
Der Partner muss die Gelegenheit bekommen, seine Sichtweise ausführlich darzulegen. Dabei kann man helfen, indem man sein Interesse zeigt: „Erzähl weiter! Wie war das genau?” usw.
Ein weiterer Schritt ist dann, dem Partner seine Gedanken und Aussagen widerzuspiegeln. Dies geschieht durch Sätze wie: „Du meinst also, dass…”, durch Wiederholungen seiner Aussagen oder Zusammenfassung mehrerer Aussagen mit eigenen Worten.
Schließlich soll man die Gefühle des Partners ansprechen. Dies können sowohl direkt geäußerte Gefühle sein als auch Gefühle, die beim Erzählen mitschwingen („Du hast Angst, dass…”, „Bei deinen Worten klingt Hoffnung mit”).
Klientenzentrierte Grundhaltung
Grundsätzlich ist aber wichtiger als jede psychologische Technik, dass man die partnerzentrierte / klientenorientierte Grundhaltung so zeigt, wie sie für einen selbst echt ist. Echtheit heißt: Sie muss sich in die eigene Person und in das eigene Verhalten einfügen. Partnerzentriert sein bedeutet dann, dass man sich in den Partner hineinversetzt.
Exkurs: Was bedeutet ein Lächeln?
Dass Gesichter, die Gefühle zeigen, die Macht haben, ein bestimmtes Ausdrucksverhalten auszulösen und uns zu bestimmten subjektiven Erfahrungen bringen können, ist seit langem belegt (z. B. Deutsch, Le Baron & Fryer, 1991.) Allerdings gibt es demnach geschlechtsspezifische Unterschiede, wonach in Sachen „Lächeln” für Männer und Frauen unterschiedliche Maßstäbe angesetzt werden.
Bedeutung des Lächelns
Wenn Frauen kein ausdrucksstarkes und herzliches nonverbales Verhalten zeigen, werden sie strenger bewertet als Männer. Alexander Lowen, dem Begründer der Bioenergetik, wird folgende Behauptung nachgesagt:
Körperausdruck
„Keine Worte sind so klar wie die Sprache des Körperausdrucks, wenn man erst einmal gelernt hat, sie zu verstehen.”
…und dazu gehört im Bereich der Mimik neben dem unverzichtbaren Blickkontakt die Bewegung des Mundes. Denn ein Lächeln sagt alles und bewirkt viel. Die positive Gemütsverfassung wirkt sich auf die Gesundheit von Körper und Seele – beim Sender und Empfänger dieser Nachricht – aus.
Supervision als Form der Beratung
Supervision – Beratung und Gesprächsführung
Bei der Pflege von Schwerstkranken oder Sterbenden stehen die Pflegenden und alle anderen patientennah arbeitenden Berufsgruppen unter besonders starker psychischer Belastung. Durch Supervision kann ihnen psychosoziale Entlastung geboten werden. Wenn Supervision der professionellen und systematisierten Bearbeitung von beruflichen Interaktionsproblemen dient und eine Verbesserung und Erweiterung persönlicher und fachlich praktischer Handlungskompetenz zur Folge hat – ist sie damit nicht „nur” eine Form der Beratung? Und wenn daneben das einfühlsame, „heilsame” Verhalten und Verständnis für andere Menschen erlernt und eingeübt werden soll – erkennen wir nicht da die Grundlagen der Gesprächsführung – Akzeptanz, Einfühlung, Echtheit – wieder?
Ist dann Beratung nicht nur eine besondere Form der Gesprächsführung? Diese Fragen sind mit einem klaren JA zu beantworten! Supervision ist eine Form der Beratung, und Beratung ist eine Form der professionellen Gesprächsführung, und allen ist eines gemeinsam: Die Beteiligten in einem solchen Interaktionsprozess müssen einander zuhören – oder sie müssen es lernen. Und dafür gibt es unterschiedliche Supervisionsansätze: Die Einzel-, die Team- und Gruppensupervision sowie die Projektberatung.
Supervisionsbrille
Die Supervisionsinhalte (Gesprächsinhalte) betreffen die Beziehungen des Personals untereinander und zu Führungskräften, des Pflegepersonals zu den Patienten und deren Angehörigen, zur Krankenhausorganisation und zur Gesellschaft und können dann durch die so genannte Supervisionsbrille betrachtet werden. Partnerzentrierte Gesprächsführung, Beratung und Supervision sollten in der Praxis der Sozial- und Gesundheitsberufe eine Selbstverständlichkeit sein. Sie ist kein Allheilmittel. Ihre Einführung im Krankenhaus, Altenheim, Hospiz ist aber ein humanistischer Ansatz, um die bestmöglichen Hilfen für Patienten und Personal bereitzustellen.
Sterbebegleitung – ein Kommunikationsproblem?
Sterbebegleitung ist eben sehr häufig auch ein Kommunikationsproblem. So ist es ein weit verbreiteter Irrtum, davon auszugehen, Schwerstkranke würden bereits lange vor ihrem Tod das Bewusstsein verlieren. Sehr viele Patienten – so zeigen Praxiserfahrungen und Untersuchungen immer wieder überzeugend – bleiben bis kurz vor ihrem Tod erreichbar, wenn auch nicht immer ansprechbar (etwa direkt-verbal, symbolisch-verbal oder auch in der Form einer „Symbolsprache” wie sie z. B. Inger Hermann (2000) unter dem bezeichnenden Titel „Die Koffer sind gepackt!” beschreibt).
Zentral bleibt gerade in diesen Phasen, dass sich der Sterbebegleiter auf die dem Patienten noch mögliche Art der Kommunikation einlassen kann und sie verstehen lernt.
Dies mögen z. B. Symbol- oder Traumsprache sein, die das Nacherleben von vielleicht Unaussprechlichem möglich machen, etwa durch Weiterassoziieren und -phantasieren oder die gemeinsame Suche nach Wort- oder Bildmetaphern, die Trost spenden und entlasten (Mennemann, 1998).
Die berühmte amerikanische Sterbeforscherin Elisabeth Kübler-Ross beschreibt solche Gleichnisse, Parabeln und Symbolsprachen (1990) sehr anschaulich anhand zahlreicher Fallbeispiele – auch unter Verwendung von Zeichnungen –, angefertigt in einer Lebenskrise. Bekannt wurde sie insbesondere einem breiten (Fach-) Publikum dadurch, dass sie die vielfältigen Phänomene des Sterbens bestimmten typischen Abschnitten zuordnet.
Zum Nutzen der Phasenmodelle
Aber – so schreibt Mennemann (1998, S. 256):
„Eine Orientierung an Phasenmodellen, dies sei noch einmal kurz wiederholt, ist in der Praxis wenig hilfreich, da die Phasen nicht deutlich nacheinander ablaufen. Allerdings sind ein Wissen um unterschiedliche Verarbeitungsphasen und daraus folgend unterschiedliche Interventionsstrategien wichtig.”
Biografiearbeit, Erzählstunden, kreative Verfahren können das Gelingen der Kommunikation mit Sterbenden sehr bereichern und erleichtern und dies ist nur in sehr geringem Ausmaß abhängig von der richtigen Wortwahl. Im Vordergrund steht die Konsequenz: Das Zusammenspiel verbaler und nonverbaler Ausdrucksformen (vgl. Axiom 3, Modelle und Grundlagen der Kommunikation).
Ein alter Grundsatz: Schweigen ist oft ausdrucksstärker als Reden
Und ein weiteres Axiom gab den Hinweis:
„Auch wenn verbale Verständigung versagt, besteht weiterhin Kommunikation: Gelebtes Schweigen ist oft ausdrucksstärker als Worte. Erst die innere Abkehr vom sterbenden Menschen führt ihn in die Isolation, nicht jedoch Schweigen oder Stille. Erlebnisformen der Stille können sein: Nähe (Verringerung des körperlichen Abstandes) und innere Anwesenheit, auditive Kommunikation (Töne, Lieder, Musik), Zuhören („Die meisten sterbenden Patienten möchten keine Antworten, weil sie wissen oder spüren, dass es auf die Geheimnisse des Todes keine Antworten gibt”), Blickkontakte (Kommunikation ist über Blicke möglich zwischen vertrauten Menschen), Körperkontakt (Streicheln), einfühlende Solidarität (vorbehaltlose Begegnung, Einbringen der eigenen ganzen Person…) (Mennemann, 1998, S. 260).
Der Körper als Kommunikationsträger
Schweigen und Zuhören sind gleichrangige zentrale „Sprachkompetenzen”, und es wird immer wieder in Theorie und Praxis der Sterbebegleitung völlig zu Recht auf den Körper, die Körpersprache, als wichtigen Kommunikationsträger hingewiesen.
Neben klassischen körperorientierten Methoden (wie Yoga, autogenes Training, progressive Muskelentspannung) treten in jüngster Zeit auch „Konzentrative Bewegungstherapie – KBT” (Hausmann & Neddermeyer, 1996) und „Focusing”.
Focusing
Dieses Focusing – so schreibt Agnes Wild-Missong in ihrem Vorwort zur deutschen Ausgabe 1981 des vom Begründer dieser Methode (des Chicagoer Psychologieprofessors Eugene T. Gendlin) herausgegebenen Standardwerks – ist „als eigentlicher Prozess psychischer Veränderung eine Neuentdeckung. Es ist ein körperlich spürbar ablaufender Prozess, bei dem sich aus Körperempfindungen Sinngehalte ergeben. Dieser Prozess bringt ein Evidenzerleben mit sich, das demjenigen, der es erfährt, absolute Sicherheit vermittelt, das eigentliche Bedeutsame einer Sache gefunden zu haben. Dieses spezielle Sprechen-Lassen aus dem Körper, um die eigentliche Bedeutung eines Problems in evidenter Weise zu erfahren und zu erkennen, ist Focusing.” (S. 7)
Gefühle in Worte fassen
„Focusing wurde im Rahmen der klientenzentrierten Psychotherapie entwickelt. Carl Rogers, der Begründer der klientenzentrierten Psychotherapie, postuliert das empathische Verstehen, das wirkliche Zuhören-Können. Indem er sich in den Bezugsrahmen des Klienten versetzt, versucht Rogers, die Gefühlsbedeutung der Aussage eines Klienten zu verstehen und dem Klienten sein Verständnis mitzuteilen. (…) Wenn Rogers die Gefühle, die eine Aussage begleiten, widerspiegelt, lässt Gendlin die Aussage zuerst körperlich empfinden, bis aus der Körperempfindung die gefühlte Bedeutung spricht.” (S. 7/8)
Bereits diese prägnanten Formulierungen skizzieren den unschätzbaren Wert dieser professionellen Interventionsmöglichkeit: Hier wird das Körpererleben auch an Worte gebunden und eine ganzheitliche Kommunikation hergestellt, und damit tragen körperliche Entspannung und bewusstes Wahrnehmen eines Schmerzes zur psychischen Erleichterung bei; aktuelle Publikationen sind beispielhaft folgende:
Cornell (1997); Feuerstein; Müller & Weiser-Cornell (2000), und zum Thema „Schmerzbewältigung”, „Umgang mit chronischen Schmerzen” liegt auch eine CD-ROM beim FZK (Focusing Zentrum Karlsruhe / Weingarten) vor.
Burgheim (1994) macht an sieben methodischen Gestaltungselementen – verbunden mit vielen Beispielen und Praxisbezügen – die Aufgaben eines „Lernhelfers” (so nennt er ihn) in der qualifizierten Begleitung von Sterbenden und Trauernden deutlich.
Burgheims Lehr-Lern-Prozess
Dazu bedient er sich folgender methodischer Elemente im Lehr-Lern-Prozess als Weg des Lehrens und Lernens (S. 167 – 251):
Verstehen (Sprache und Verstehen)
Hineinhören (Erzählung und Hineinhören)
Schreiben (Schreiben und Vorlesen)
Schauen (Bilder und Schauen)
Gestalten (Gestalten und Begreifen)
Berühren (Körper und Berühren)
Bewegen (Leib und Bewegen)
Damit wird den Beteiligten im Krisen-Lehr-Lern-Prozess ein methodisches „Rüstzeug” an die Hand gegeben um „überleben zu lernen, und das ist wesentlich.” (Burgheim, S. 247)
Ein Beispiel: Das „Apallische Syndrom”
Ein Fallbeispiel
Im so genannten „Wachkoma”(=„Apallisches Syndrom”) befindet sich der Patient in einem schlafähnlichen Zustand, hält aber die Augen offen. Ursachen für diesen Zustand sind mannigfaltig: Etwa ein Herzinfarkt, Schlaganfall, Unfall, Komplikationen in Verbindung mit einer Reanimation oder infolge eines Narkosezwischenfalls. Ca. 100.000 Menschen – so schätzt man – erleiden pro Jahr ein solches schweres Schädel-Hirntrauma in Deutschland (laut Angaben des Vereins „Dornröschen” in Bad Honnef).
In einer großen Regionalzeitung (Rhein-Zeitung, Koblenz vom 22.09.2001) wird folgender Fall beschrieben:
Willi Zeck, ein 57-jähriger Maschinenbauer, fällt bei Arbeiten „rund um sein Haus” plötzlich um. Er wird reanimiert, im Krankenhaus ein zweites Mal. Wie lange er unter Sauerstoffmangel gelitten hat, weiß seine Frau nicht. Die Ärzte versetzen den Patienten in ein künstliches Koma. Nach zwei Wochen atmet Zeck wieder selbst, aber das Bewusstsein erlangt er nicht wieder. Seine Frau ist dennoch optimistisch, schaut ihn immer wieder an und denkt: „Er muss doch gleich aufwachen.” Die Ärzte bleiben skeptisch, „ich müsste abwarten”, sagten sie. „Und sie wollten mir nichts versprechen, keine zu großen Hoffnungen machen.”
Gertrud Zeck lässt sich die Hoffnung nicht nehmen. Bis heute nicht. „So einfach geht das nicht.” Ihr Mann wird in die Akut-Rehabilitation nach Trier verlegt. Sein schlafähnlicher Zustand hält an. Mit geöffneten Augen starrt Willi Zeck zur Decke. Seine Frau sitzt jeden Tag neben ihm, stundenlang hält sie seine Hand. Und sie erzählt, erzählt. Von Tochter Sandra, vom neuen Haus. Von den Rechnungen, die endlich bezahlt sind, und dass das Geld sogar noch fürs Verputzen reichen wird. Gertrud Zeck muss sich erst daran gewöhnen, dass sie keine Antwort bekommt. Fragen stellt sie dennoch, und mit ihrem Mann vereinbart sie: „Wenn du ja sagen willst, dann mach die Augen ein Mal zu.” Als das funktioniert, ist die 46-Jährige endgültig überzeugt, dass ihr Mann im Wachkoma seine Außenwelt wahrnimmt.
… und die Meinung der Experten
Ein Experte, der Oldenburger Mediziner Andreas Zieger, wird in dem Artikel der Zeitung wie folgt zitiert:
„Bei Wachkoma-Patienten handelt es sich um lebende und empfindsame Menschen, deren Leben konsequent gefördert oder begleitet, nicht aber durch Maßnahmen zur Sterbehilfe beendet werden sollte. Menschen im Wachkoma sind weder unheilbar Kranke noch Sterbende oder gar (Teil-) Hirntote, sondern sie sind neurologisch (Langzeit-) Schwerstkranke. Ihre Behandlung, Förderung und Begleitung ist an den gleichen Kriterien zu messen wie der Umgang mit anderen chronisch Schwerstkranken oder Schwerstbehinderten.”
Die Sprache der Sterbenden
Die Beschäftigung – eben auch nonverbal – mit der „Sprache der Sterbenden” setzt voraus, dass sich die Begleitenden die Zeit und die Ruhe nehmen, um genau hinzusehen, hinzuhören und sich in den sterbenden Menschen hineinzufühlen (Klessmann, 1994).
Demnach können sprechunfähige Menschen durchaus noch sehr wahrnehmungsfähig sein und sind auf vielfache Weise noch zu erreichen.
Klessmann (1994. S. 171) führt dazu aus:
Wahrnehmungsfähigkeit
„Hör-, Seh-, Riech- und Geschmackssinn sind mehr oder weniger intakt und natürlich kommen auch die Wahrnehmung von Hautkontakt, Mimik, Gestik, Zeichensprache und die Sprache der Berührung hier voll zum Zug. Krankenschwestern, die darin Erfahrung und Übung haben, berichten erstaunliche Dinge über die Differenziertheit, die in der Verständigung mit solchen Patienten möglich ist.”
Modulation der Stimme
Vor diesem Hintergrund ist es sinnvoll, wenn Menschen, die Sterbende begleiten, etwas über ihre eigene Mimik und Gestik sowie über ihre Stimme wissen. Ebenso wichtig ist es, dass sie wissen, was sie ausstrahlen und wie sie Zuwendung oder Ablehnung, Gleichgültigkeit oder Freude ausdrücken oder wie sie zu Schwerkranken oder Sterbenden sprechen: Wie klingt meine Stimme? Eher hart oder flüchtig oder warm? Wie rede ich mit einem Schwerkranken? Mache ich ihn zum Kind, oder rede ich mit ihm wie mit einem Erwachsenen?
Seit langem ist bekannt:
„Trost und Zuwendung heilen!”
Dies wird durch die Distanziertheit in der modernen medizinischen Versorgung, aber auch durch Routineabläufe in Krankenhäusern / Altenheimen allzu häufig verhindert.
Hilft Vertrauen heilen?
Ein großes Krankenhaus in Mecklenburg-Vorpommern firmiert seit kurzer Zeit unter dem Logo „Vertrauen hilft heilen!”. Dies tragen die Beschäftigten auch im Namensschild ihrer Dienstkleidung. Während dies dem einen allzu plakativ-aufgesetzt vorkommen mag, wird der andere daran vielleicht Gefallen finden und Zutrauen fassen.
So berichtet die Zeitschrift „Psychologie Heute” (04/1992, S. 41) über eine „Stanford-Untersuchung mit Brustkrebs-Patientinnen, die zusätzlich zur medizinischen Therapie an Selbsthilfegruppen teilnahmen”.
Demnach berichteten diese Frauen nicht nur von einem wesentlich verbesserten Befinden, sondern sie überlebten auch durchschnittlich 18 Monate länger als eine vergleichbare Kontrollgruppe, die ausschließlich in ärztlicher Behandlung war.
Beides muss zusammenkommen
Natürlich können Wärme, Akzeptanz, Zuwendung die medizinische Therapie und Diagnostik nicht ersetzen. Kombiniert und ganzheitlich kann beides aber ganz offentsichtlich deutliche Fortschritte im Heilungsprozess bewirken.
Und abschließend:
„Gesagt ist nicht gleich gehört, gehört ist nicht gleich verstanden, verstanden ist nicht gleich akzeptiert; diese Grunderfahrung professioneller Gesprächsführung weist darauf hin, dass Beraten mehr und anderes ist als Informationen weitersagen.” (Quelle unbekannt)
Wer sich mit dem Thema „Beratung” umfassend und allgemein beschäftigen will, sei auf die Zeitschrift „BERATUNG AKTUELL – Zeitschrift für Theorie und Praxis der Beratung” (Hrsg.: Sanders, R. Paderborn: Junfermann-Verlag) hingewiesen oder auf die wissenschaftliche Reihe „Beratung” (Hg.: Nestmann, F. & Thiersch, H., Band 1 – 7; Tübingen: dgvt-Verlag).
Wusstest Du schon?
Wusstest Du schon,
dass die Nähe eines Menschen
gesund machen,
krank machen,
tot oder lebendig machen kann?
Wusstest Du schon,
dass die Nähe eines Menschen
gut machen,
böse machen,
traurig und froh machen kann?
Wusstest Du schon,
dass das Wegbleiben eines Menschen
sterben lassen kann,
dass das Kommen eines Menschen
wieder leben lässt?
Wusstest Du schon,
dass die Stimme eines Menschen
einen anderen Menschen wieder aufhorchen lässt,
der für alles taub war?
Wusstest Du schon,
dass das Wort oder das Tun eines Menschen wieder
sehen machen kann,
einen, der für alles blind war,
der nichts mehr sah
in dieser Welt und in seinem Leben?
Wusstest Du schon, dass das Zeit-Haben
für einen Menschen mehr ist als Geld,
mehr als Medikamente,
unter Umständen mehr
als eine geniale Operation?
Wusstest Du schon,
dass das Anhören eines Menschen
Wunder wirkt, dass das Wohlwollen Zinsen trägt,
dass ein Vorschuss an Vertrauen
hundertfach auf uns zurückkommt?
Wusstest Du schon,
dass das Tun mehr ist als Reden?
Wusstest Du das alles schon?
Wusstest Du auch schon,
dass der Weg vom Wissen über das Reden zum Tun
unendlich weit ist?
aus: Wilhelm Willms „Roter Faden Glück“, Kevelaer 1988