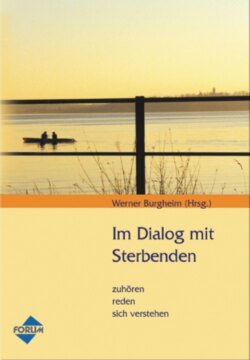Читать книгу Im Dialog mit Sterbenden - Gerda Graf - Страница 7
Einführung
ОглавлениеJeder, der heute was auf sich hält, ist kommunikativ und steht im Dialog. Doch nicht jeder Dialog ist wirklich das, was eigentlich gemeint ist.
Dialog ist ein Prozess in einer offenen, unabgeschlossenen Gestalt, der dem Für und Wider unter gleichberechtigten Partnern Raum gibt und eigenes Urteilen ermöglicht.
Dialog unterscheidet sich von anderen Formen verbaler Kommunikation wie Rhetorik, die durch gezielten und überlegten Aufbau überreden, versüßen (lat. persvadere) und von der Debatte, welche nach harter Auseinandersetzung durch Abstimmung beendet wird und Sieger und Verlierer bestimmt.
Dialog ist partnerschaftliche Begegnung zwischen Menschen. Eine Indianerweisheit aus dem Stamme Dakota sagt: „Die wahrhaft höfliche Art und Weise, ein Gespräch zu beginnen, war eine Zeit gemeinsamen stillen Nachdenkens und auch während des Gespräches achteten wir jede Pause, in denen der Partner überlegte und nachdachte.“ Für die Dakota war das Schweigen bedeutungsvoll. Im Unglück und Leid, wenn Krankheit und Tod unser Leben überschatteten, war Schweigen ein Zeichen von Ehrfurcht und Respekt. Für die Dakota war Schweigen von größerer Kraft als das Wort.
„Weil Dialog Begegnung zwischen Menschen ist, die die Welt benennen, darf er keine Situation bilden, in der einige Menschen auf Kosten der anderen die Welt benennen. Vielmehr ist er ein Akt der Schöpfung1 … Dort, wo man sich begegnet, gibt es weder totale Ignoranten noch vollkommene Weise – es gibt nur Menschen, die miteinander den Versuch unternehmen, zu dem, was sie schon wissen, hinzuzulernen2 “, so der bekannte brasilianisch Erwachsenenbildner Paulo Freire.
Martin Buber geht davon aus, dass Leben sich nur in der Gemeinschaft entfalten kann. „Alles wirkliche Leben ist Begegnung.“3 Im Ich-Du-Verhältnis wird diese Begegnung erfahren und zwar im Sicht-Erschließen. Es ist ein zweiseitiger Vorgang zwischen Ich und Du. Im Es-Verhältnis wird ein / eine oder ein anderes (das Es) dem eigenen Zweck unterworfen, es wird, besessen. Im begrenzten Ich, durch Dinge und Menschen, auf die es stößt, erfährt es die anderen, das Du und zugleich sich selbst und kommt damit zum Bewusstsein der anderen und seiner selbst.
Nina Herrmann berichtet aus ihrer Arbeit als Klinik-Seelsorgerin in den USA in ihrem Buch: Mit Trauernden reden“ von zwei Kollegen. Der Priester „hält im Vorübergehen eine Minute bei einem Menschen an, und der hat hinterher das Gefühl, er hätte gut und gern fünf Minuten mit ihm gesprochen. Ein Pfarrer redet fünf Minuten mit einem Kranken und hinterlässt das Gefühl, mal eben eine flüchtige Minute vorbeigekommen zu sein. Der Priester bleibt stehen, stellt sich bequem hin oder setzt sich, nimmt eine Hand, hält Blickkontakt und gibt dem Kranken das Gefühl, seine ungeteilte Aufmerksamkeit zu bekommen. Der Pfarrer kann nicht stillstehen, setzt sich nicht hin, kann nicht entspannen, fasst niemand an, guckt in der Gegend umher und vermittelt den Eindruck, schrecklich beschäftigt zu sein, und schon damit einen Gefallen getan zu haben, dass er mal eben vorbeigekommen ist.4
Wahres Zuhören ist echte Teilnahme an dem, was der andere sagt, was er oder sie vielleicht nur andeutet, und darauf, was sie nicht anspricht. Das ist Arbeit, harte Arbeit sogar, die manchmal einen alle Kraft kostet.
Der Dialog lebt vom Geben und Nehmen, vom Reden, Hören und Antworten, vom Impuls geben und aufnehmen, vom Warten, Schweigen, von Meinung und Widerspruch, von Streitkultur, Dialektik und Synthese. Zwei oder mehrere Menschen begegnen sich. Das aktive Zuhören hat im Dialog einen wichtigen, zu übenden Anteil.
Keiner der Partner hat den Dialog allein in der Hand. Er liegt im wörtlichen Sinne „zwischen“ den Partnern, die Silbe „dia“ sagt es. Gegenüber allen einzelnen ist er ein Drittes, das wahrgenommen und gepflegt sein will und in dessen Medien sie erst zum Partner werden… Für jedes Eigene, das im Dialog „zwischen“ den Sprechenden geschieht, muss durch sprachliche Bildung das „Organ“ entwickelt werden.
Darum lässt Antoine de Saint-Exupéry den Fuchs im „Kleinen Prinzen“ zum Flieger sagen: „Du musst sehr geduldig sein… Du setzt dich zuerst ein wenig abseits von mir ins Gras. Ich werde dich so verstohlen, so aus dem Augenwinkel anschauen, und du wirst nichts sagen. Die Sprache ist die Quelle der Missverständnisse. Aber jeden Tag wirst du dich ein bisschen näher setzen können…“ Und wenig später: „Hier ist mein Geheimnis. Es ist ganz einfach: Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für das Auge unsichtbar.“5
In der Begleitung Sterbender erleben die BegleiterInnen in der letzten Phase des Lebens hautnah den Kampf gegen Schmerzen, Ängste, Verzweiflung, aber auch Hoffnungen und letzte wirkliche Botschaften.
Alltagserfahrungen zeigen, wie oft es zu Missverständnissen kommt. In der Sterbebegleitung ist dies tragisch. Von Sterbenden wird oft eine nonverbale Sprache verwendet und dafür ist ein Wissen und eine Sensibilisierung der Begleiterinnen und Begleiter erforderlich.
Auch das Verhältnis des Sterbenden zu seinen Angehörigen ist und wird oft bis an die Grenze belastet. Wie Brücken schlagen? Wie die Situation verstehen? Wie kann ein Dialog mit dementen und verwirrten Menschen überhaupt noch gelingen?
„Was den existenziellen Grund eines Menschen berührt“, so der Hospizarzt Martin Weber, „muss belastend, muss schwierig bleiben“, und doch kann es befiedigender sein als das Gelingen einer komplizierten Operation.
Hierzu bedarf es kommunikativer Kompetenz. „Ein gelingendes Gespräch wird sich sabei nicht auf bloße „Gesprächstechnik“ reduzieren lassen, sondern der Schwerstkranke wird – günstigenfalls – erleben, ob er ein echtes Interesse, eine tatsächliche Wertschätzung seiner Person erfährt und spürt“, so schreibt der Kommunikationswissenschaftler Roland Hofmann in diesem Buch.
Der Dialog braucht auch Anstöße und Ausdrucksmittel: Das vergangene Leben noch einmal in strukturierter Biografiearbeit zu reflektieren, mit Kunst und Musik Gefühle zum Ausdruck verhelfen und verarbeiten, Tiere und Humor als Medien und als Helfer einsetzen, und Humor als Haltung heilend wirksam werden lassen.
Rituale sind Stützungen der Seele. Anregung zu Formen des Abschiednehmens, der letzten Stunde und Rituale bis zur Bestattung werden hier zahlreich gegeben und an vielen Beispielen verdeutlicht. Die Autoren/-innen haben mit Engagement viel Nützliches aus ihren Erfahrungen in diesem Buch aufgeschrieben.
Möge es den Sterbenden und seinen Begleitern zu einer echten Begegnung verhelfen, Basis und Ausgangspunkt für alle weiteren Gestaltungsprozesse.
| September 2005 | Prof. Dr. phil. Werner Burgheim |
1 Freire, P. Pädagogik der Unterdrückten, Reinbek Hamburg, 1973, 72.
2 A. a. O. 74.
3 Buber, M.: Das dialogische Prinzip, Heidelberg, 1984, 14.
4 Herrmann, N., 1990, 149.
5 A. a. O. 127.