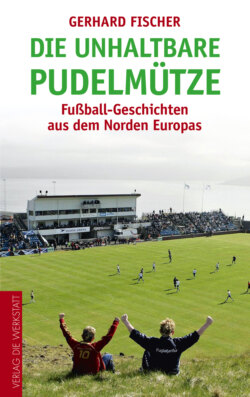Читать книгу Die unhaltbare Pudelmütze - Gerhard Fischer - Страница 6
ОглавлениеEINLEITUNG
Der schwedische Name für Einwechselspieler heißt „Inhoppare“ (Deutsch: Hineinhüpfer). Als Hansa Rostock in der Bundesliga spielte, hat der Trainer im Herbst 2002 zwei Schweden eingewechselt: Arvidsson und Persson. Auf dem Platz standen bereits die Schweden Jakobsson, Lantz, Wibrån und Prica. Arvidsson und Prica spielten im Sturm, Angreifer heißt in Schweden „Anfallare“. Sechs Ausländer, die aus dem gleichen Land kommen, in einer Bundesligaelf – das gab es noch nie. Und dann waren sie auch noch alle aus Schweden. Kommen die Bundesligalegionäre nicht eher aus Brasilien oder Serbien?
Es gibt nicht nur eine ewige Bundesligatabelle, bei der die Punkte der Mannschaften summiert werden; es existiert auch eine Rangliste, welche die Einsätze ausländischer Spieler seit 1963 zählt. Schweden liegen auf Rang neun. Erste sind die Brasilianer – vor den Dänen. Mehr als 100 Dänen haben seit 1963 in der Bundesliga gespielt, Ole Bjørnmose, der in den 1960er und 1970er Jahren bei Werder Bremen und dem Hamburger SV kickte, hielt mit 323 Bundesligaspielen lange den Rekord für Legionäre – ehe ihn 2008 der Bosnier (und langjährige HSV-Spieler) Sergej Barbarez ablöste. Und wer erinnert sich nicht an Ebbe Sand, den Schalker? An Morten Olsen, den Kölner?
Die Norweger sandten Charismatiker wie Rune Bratseth oder Jan Åge Fjørtoft nach Süden. Stopper Bratseth, den sie in Bremen „Elch“ nannten, verkörperte das Ruhige, Unerschütterliche eines Nordmannes, Spaßvogel Fjørtoft das Heitere, das man in Norwegen antrifft, aber auch in Dänemark.
Finnen, Isländer, Grönländer oder Färinger spielten bisher eine geringere oder gar keine Rolle in der Bundesliga.
Und die Nationalmannschaften der Nordeuropäer? Schweden wurde 1958 Vize-Weltmeister bei der WM im eigenen Land, im Finale gewann Brasilien – mit dem 17-jährigen Pelé. Im Halbfinale hatten die Schweden die Deutschen besiegt, Sepp Herbergers Mannschaft musste lange mit zehn Mann spielen, denn Erich Juskowiak hatte sich ein Revanchefoul gegen Kurt Hamrin geleistet und war in der 58. Minute vom Feld geflogen. „Da wird Juskowiak vom Platz gestellt!“, rief Reporter Herbert Zimmermann, der schon das WM-Finale 1954 in Bern übertragen hatte. In der Stimme Zimmermanns schwang immer etwas Schicksalhaftes mit. So war es auch dieses Mal.
Schweden gewann 3:1, die fast 50.000 Fans im Nya-Ullevi-Stadion in Göteborg feierten die eigene Mannschaft um die Legenden Gunnar Gren und Nisse Liedholm, die als Profis in Italien Karriere gemacht hatten. Und auf Linksaußen wirbelte ein ganz besonderer Fußballspieler: der pfeilschnelle Lennart „Nacka“ Skoglund, über den die Süddeutsche Zeitung unter der Überschrift „Am Ball genial, unfähig im Leben“ einmal schrieb: „Wie Libuda beherrschte Skoglund sein Leben nur, wenn er Sicherheit in engen Grenzen fand – zwischen den vier Eckfahnen eines Fußballplatzes. Er hat getrunken, und er ist mit 45 Jahren in der Ein-Zimmer-Wohnung seiner Mutter gestorben.“ Vor dem Haus in der Katarina Bangata 42 in Stockholm „steht heute eine Skoglund-Statue, und jedes Jahr am 24. Dezember, wenn Nacka Geburtstag hat, treffen sich dort Hunderte und singen und essen Pfefferkuchen“.
Bei der WM 1994 in den USA wurde Schweden Dritter, es war eine starke Mannschaft mit den Stürmern Dahlin und Brolin, die ähnlich berühmt wurden wie Gren und Liedholm, und mit einem Torwart, der starke Reflexe hatte und einen stechenden Blick: Thomas Ravelli. Es war ein sehr heißer Sommer damals in Schweden, das ganze Land saß vor dem Fernseher, um die WM zu gucken. Henning Mankell hat das in seinem Wallander-Krimi Die falsche Fährte beschrieben. Kommissar Kurt Wallander versteht nichts von Fußball, er interessiert sich auch nicht für die WM, aber er macht beim internen Tippspiel des Polizeipräsidiums mit. Nach dem Spiel Schweden gegen Kamerun zog Kollege Martinsson ein Stück Papier aus der Tasche und sagte zu Wallander: „Wie du weißt, ist Fußball-Weltmeisterschaft . 2:2 gegen Kamerun. Du hattest 5:0 für Kamerun getippt, damit bist du Letzter.“
Foto: Edgar Wangen
Gedenkstatue von Nacka Skoglund in Stockholm, Katarina Bangata am Nackas-Hörna-Plats.
Norwegen hat dreimal bei Weltmeisterschaften mitspielen dürfen (1934, 1994 und 1998), aber niemals das Achtelfinale überstanden; bei der einzigen EM-Teilnahme im Jahr 2000 scheiterten die Norweger schon in der Vorrunde. Finnland, Island, die Färöer und Grönland warten noch auf ihre erste Teilnahme an einer großen internationalen Meisterschaft.
Den einzigen Titel einer nordeuropäischen Mannschaft hat Dänemark gewonnen: Die Dänen wurden 1992 in Schweden Europameister – im Finale besiegten sie die Deutschen 2:0. Dänemark, wo erst 1971 Profifußballer im Nationalteam zugelassen wurden, hatte in den 1980er Jahren eine famose Nationalmannschaft. Die Helden hießen Laudrup, Olsen und Elkjær Larsen und der erste hauptamtliche Nationaltrainer kam aus Deutschland: Sepp Piontek. Bei der EM 1984 kamen sie ins Halbfinale, scheiterten erst im Elfmeterschießen an Spanien. 1986, bei der Weltmeisterschaft in Mexiko, blieben sie erneut an Spanien hängen, diesmal im Achtelfinale.
Als sich Dänemark 1990 nicht für die WM und 1992 nicht für die EM qualifizieren konnte, dachte man, die Zeit von „Danish Dynamite“ sei vorbei. Doch 1992 durften sie nachrücken, weil Jugoslawien wegen des Balkankonflikts ausgeschlossen worden war. Die Dänen kamen direkt aus dem Urlaub und hatten noch Pommesreste zwischen den Zähnen, aber sie bezwangen im Finale die Deutschen, „und die Legende war geboren, dass man im Profi-Fußball Spaß haben muss und nicht die richtigen Laktatwerte“, schrieb die Süddeutsche Zeitung. Das Endspiel fand in Göteborg statt. Es war nicht nur der einzige Sieg einer nordeuropäischen Mannschaft bei einem großen Turnier, es war auch bislang die einzige Fußball-EM in einem nordeuropäischen Land. 2008 wollten Dänemark, Schweden, Finnland und Norwegen als Team NORDIC die Europameisterschaft 2008 veranstalten. Vier Länder gemeinsam – so eine Bewerbung gab es noch nie. Doch die Schweiz und Österreich bekamen die EM.
Der Stellenwert des Fußballs in Nordeuropa ist passabel, auch wenn die Schweden vielleicht noch lieber Eishockey gucken, die Norweger Skilanglauf oder die Finnen Skispringen. Vor allem achten die Fußballverbände auf eine gute Ausbildung der Jugendlichen – der Gotha-Cup in Schweden und der Norway Cup in Norwegen gehören zu den weltweit größten Jugendturnieren, was die Anzahl der Teilnehmer betrifft.
In diesem Buch geht es nicht darum, Bundesligaspieler aus Schweden oder Dänemark zu porträtieren; auch nicht darum, die Geschichte der nordeuropäischen Nationalmannschaften zu erzählen; und schon gar nicht darum, die sportlich mittelmäßigen ersten Ligen aus dem hohen Norden vorzustellen. In Finnland etwa kommen im Schnitt nur knapp 2.000 Zuschauer zu den Partien der höchsten Spielklasse. Dort heißt es, keiner wolle Rechts- oder Linksaußen spielen – er könnte von Wölfen angefallen werden.
Es geht vielmehr darum, schöne Geschichten zu erzählen, skurrile und manchmal auch nachdenkliche – vom großen und vom kleinen Fußball aus dem Norden Europas. Die Geschichte vom achtjährigen Fimpen, der – natürlich nur im Film – in der schwedischen Nationalmannschaft spielte, ist schon fast 40 Jahre alt. Aber sie ist spannend und lustig, und der schwedische Torwart Ronnie Hellström lacht heute noch darüber, wie er dem Jungen im Trainingslager Märchen vorlesen musste.
Und Sepp Piontek lacht darüber, wie er als Trainer der grönländischen Nationalmannschaft bezahlt wurde: mit seltenen Lebensmitteln und Robbenjagden. 2001 fand übrigens ein außergewöhnliches Fußballspiel zwischen Grönland und Tibet statt. Auf Island spielte 2005 eine Mannschaft afrikanischer Einwanderer in der dritten Liga mit, der ehemalige Bundesliga-Keeper Claus Reitmaier wurde im selben Jahr zum besten Torwart in Norwegen gewählt – als 41-Jähriger. Warum ist Ole Gunnar Solskjær in Norwegen und England ein Held, und warum fliegen Woche für Woche tausend Skandinavier nach England, um Spiele der Premier League zu sehen?
In einem Moor im Nordosten Finnlands, in Hyrynsalmi, treffen sich jeden Sommer 30.000 Menschen – die einen spielen den Weltmeister im Schlammfußball aus, die anderen gucken dabei zu. Auf den Färöern leben Zehntausende Schafe und ein paar Holzhändler und Eisverkäufer, die Fußball spielen – und gegen Österreich gewinnen oder Berti Vogts mit seiner schottischen Mannschaft ärgern. In Schweden hat sich der schwule Fußballer Anton Hysén geoutet, und in Dänemark gibt es ein Fußballspiel, das einzigartig ist auf dieser Welt: Kicker aus der Hippie-Kolonie Christiania spielen gegen eine Betriebsmannschaft der Polizei. Normalerweise sind die Beamten damit beschäftigt, den Haschisch-Handel in Christiania zu überwachen. Aber zweimal im Jahr – im Hin- und Rückspiel – wird in einer richtigen Liga gegeneinander gekickt. Da kommt es dann schon mal vor, dass Christiania-Fans am Spielfeldrand einen ganz tiefen Zug von ihrem Joint nehmen – und den Rauch ins Ohr des Polizisten pusten, wenn der einen Einwurf macht.
Gerhard Fischer